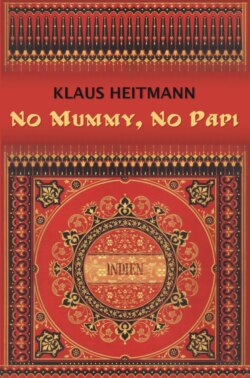Читать книгу No Mummy, No Papi - Klaus Heitmann - Страница 11
9.
ОглавлениеAm Samstag der ersten Woche in Bangalore ging Raju auf seinen ersten Wochenendausflug. Unser Ziel war die alte Hauptstadt Mysore, die früher dem Bundesstaat Karnataka den Namen gegeben hatte. Der Butler hatte für die Reise große Pakete zurechtgemacht mit gebratenen Hühnchen, Schnitzeln, Kartoffelsalat, gekochtem Wasser und allen sonstigen Utensilien, die man für ein Picknick benötigte. Wir kamen uns ein wenig vor, als ginge es auf eine jener opulenten Landpartien, die man auf Bildern und vergilbten Fotos in den Palästen der indischen Potentaten abgebildet sieht, wobei unser VW-Bus die Stelle des Elefanten einnahm, der die Ausflugsgesellschaft transportiert. Es fehlte eigentlich nur noch der Angriff eines zähnefletschenden Tigers.
Unterwegs versuchten wir Raju noch einmal davon zu überzeugen, dass er jetzt nicht mehr in Tamil Nadu sei, die Menschen aber, die hier wohnten, dennoch Inder seien. Es gelang uns aber nicht, ihm klarzumachen, was Indien ist. Er meinte, jenseits von Tamil Nadu liege England, wo alle Menschen weiß seien. Solange die Menschen dunkelhäutig und ärmlich und wie er gekleidet wären, Ochsenkarren benutzten und Tempel hätten, sei man in Tamil Nadu.
Wir wollten Raju etwas von der Kultur und Geschichte seines Landes zeigen. Daher steuerten wir den Tempel von Somnathpur an, dessen Besuch man uns in Bangalore als etwas Besonderes empfohlen hatte. Hinweisschilder auf diese Sehenswürdigkeit waren auf der großen Strasse Richtung Süden allerdings nicht zu finden. In einem Dorf, wo wir nach dem Weg fragten, gab man uns zu verstehen, dass wir an der nächsten Kreuzung von der großen asphaltierten Strasse abbiegen sollten und bedeutete uns mit einer jener indischen Handbewegungen, die ins Ungefähre zeigen, dass wir auf diese Weise schließlich Somnathpur erreichen würden. Wahrscheinlich war der holprige und staubige Feldweg, auf den wir kamen, tatsächlich der kürzeste Weg nach Somnathpur, wenn man mit dem Ochsenkarren unterwegs war und einen halben Tag einsparen wollte. Für uns bedeutete es aber, dass wir nur unwesentlich schneller als ein Ochsenkarren vorankamen und dass das Fahrgestell unseres Gefährts einem schier endlosen Belastungstest unterworfen wurde. Es ging im wahrsten Sinne des Wortes über die Dörfer, ja halbwegs geradezu durch die Wohnstuben der Bewohner, die verwundert aus ihren dürftigen Hütten herauskamen und uns zuwinkten. Kurz vor Somnathpur stellte sich heraus, dass es auch noch eine weniger strapaziöse, wenn auch längere Strecke gegeben hätte.
Somnathpur unterschied sich nicht wesentlich von den armseligen Dörfern, die wir bisher passiert hatten. Allerdings stand dort völlig unvermittelt und ohne jede touristischen oder denkmalschützenden Vorkehrungen ein figurenübersäter und ornamentüberwucherter hinduistischer Tempel aus dem Hochmittelalter, dessen Anblick einem schier den Atem verschlug. Seine Erbauer hatten in diesem abgelegenen Dorf ein unglaubliches Feuerwerk feinster Steinschnitzkunst aus übereinander geschichteten, unendlichen Reihen von Göttern, Kriegern und Elefanten sowie Darstellungen mythologischer Szenen entfaltet, wie man sie selbst in den größten religiösen Zentren des Landes nicht zu sehen bekommt. Offenbar hatte die gottverlassene Gegend während der Herrschaft der Hoysala, unter denen der sternförmige Tempel gebaut wurde, einmal wesentlich bessere Zeiten gesehen. Raju nahm das architektonische Großereignis mit Gelassenheit und meinte, in Madras gäbe es auch schöne Tempel, zum Beispiel in Mylapore.
Eigentlich wollten wir vor dieser grandiosen Kulisse unser Picknick einnehmen. Wir waren aber bald so von Bettlern umlagert, dass wir weiterfuhren und uns mitten in der Landschaft an einem Kanal niederließen. Dort installierten wir unseren Tisch, deckten ihn richtig und speisten um so vorzüglicher, als wir im Vertrauen auf unseren Koch die hygienischen Befürchtungen beiseite lassen konnten, die man in Indien immer haben musste, wenn man außerhalb des Hauses etwas zu sich nahm. Auch hier hatten wir bald Zuschauer. Einige Jungen kamen mit ihrem Vieh, um ihm samt Hakenpflug im Wasser des Kanals eine gründliche Wäsche zu verpassen. Die Rinder schienen damit nicht so recht einverstanden zu sein und versuchten immer wieder zu entkommen, was die Jungen durch kräftiges Ziehen am Schwanz verhinderten. Die Tiere durften das Wasser erst verlassen, nachdem sie vollständig, auch unter dem Schwanz, abgeschrubbt waren. Anschließend schauten uns die Jungen beim Essen zu.
Wir nutzten die Gelegenheit, ein paar Jungen vom Land um uns zu haben, um Raju endgültig zu demonstrieren, dass dies keine Tamil-Men seien. Dieses Mal hatten wir Glück. Raju versuchte mit ihnen zu sprechen und fand keine Resonanz. Er war verwirrt und wusste nicht so recht, was er davon halten sollte.
Danach steuerten wir Srirangapatna an, einen Ort, der Berühmtheit durch den - letztendlich vergeblichen - heldenhaften Widerstand erlangte, den der beherzte Sultan Tipu in der zweiten Hälfte des 18. Jh. von hier aus dem Expansionsdrang der East India Company entgegensetzte, was ihm den Ehrentitel „Tiger von Mysore“ einbrachte. Obwohl der Ort jedem indischen Schulkind bekannt sein dürfte, war er alles andere als leicht zu finden. Wir hielten dutzende Male an und sprachen den Namen fragend aus, stießen aber, vermutlich weil wir irgendeinen Teil des vielsilbigen Wortes zu lang, zu kurz oder im falschen Tonfall ausgesprochen hatten, auf wenig Verständnis. Raju amüsierte sich über unsere erfolglosen Versuche, den sperrigen indischen Namen in den Griff zu bekommen. Er versuchte immer wieder zu intervenieren, gab aber mangels der Möglichkeit, mit den Menschen von Karnataka zu kommunizieren, bald auf. Wir schafften es schließlich mit der erprobten Methode, die Auskunftsfähigkeit möglicher Informanten an Hand der Kleidung und sonstiger Indizien, die für einen gehobenen Stand oder höhere Bildung sprachen, vorab zu klären.
In Srirangapatnam erwartete uns eine jener gewaltigen indischen Festungen, die schon durch ihre Zahl und Größe mehr als genug über die wechselvolle und komplizierte Geschichte des Landes aussagen. Einzelheiten erfuhren wir von einem sauber gekleideten und gut gekämmten Schuljungen, der kaum größer als Raju aber vielleicht etwas älter war. Er spulte mit wohlgesetzten Worten und in bestem Englisch ein kleines geschichtliches Kolleg über die großen Ereignisse ab, die in und um Srirangapatnam stattgefunden hatten. Von hier aus hatten die Sultane Hayder Ali und Tipu in der zweiten Hälfte des 18. Jh. unter der formellen Oberherrschaft der hinduistischen Maharadschafamilie der Wodeyars, die in Mysore seit dem Mittelalter etabliert war, die faktische Macht im Staate errungen und das Herrschaftsgebiet auf große Teile Südindiens ausgedehnt. Inspiriert durch die Versuche der Amerikaner, die Engländer loszuwerden, die sich bis Indien herumgesprochen hatten, suchten sich die beiden Sultane in vier Kriegen der Engländer zu erwehren, welche beim Aufbau ihrer Machtposition in Südindien von der moslemischen Konkurrenz, die sich in ihrer Nachbarschaft etablierte, wenig begeistert waren. Dabei bedienten sich die Sultane, einer fatalen Tradition der indischen Fürstenhäuser folgend, der Hilfe anderer Mitkonkurrenten um die Macht, im vorliegenden Fall der Franzosen, die nicht viel Besseres im Schilde führten als die Engländer. Stolz zeigte uns der Junge das Gefängnis, in dem Sultan Tipu es gewagt hatte, Vertreter seiner englischen Majestät gefangen zu halten, freilich mit der Folge, dass die Engländer, die über derartige Unbotmäßigkeiten „not amused“ zu sein pflegten, ihn 1799 mit einer gewaltigen Streitmacht überfielen und sein und des Sultanates Ende besiegelten. Die Briten schnitten sich danach ein gutes Stück von Tipus großem südindischen Reich ab und installierten in Mysore wieder die Wodeyars. Dabei bedienten sie sich, wenn auch in gemäßigterer Form, des Modells der faktischen „Unterherrschaft“ unter der formalen Oberherrschaft lokaler Machthaber, das sich bereits im Verhältnis zu den späten Moghulen und anderen indischen Potentaten bewährt hatte. Wegen der andauernden Kooperations- um nicht zu sagen Kollaborationsbereitschaft seiner Maharadschas ließ man Mysore in der Folge mehr oder weniger unbehelligt. Die Wodeyars regierten das Land offenbar recht ordentlich, was ihnen das Lob eines englischen Lords einbrachte, der sagte, Mysore sei das am besten regierte Land der Welt. Noch ordentlicher mehrten sie ihr Vermögen und auch nach der Abdankung im Jahre 1947 und bis dato mussten sie Vorteile ihrer früheren Stellung nicht missen.
Wir gaben dem Jungen, der uns die Fakten in gut einstudierten Worten mitteilte, einen ordentlichen „Tip“. Mir ging durch den Kopf, dass Raju mit seinem Talent, andere Menschen in seinen Bann zu ziehen, auch einen guten Fremdenführer abgeben würde.
Sultan Tipu hatte, wie hierzulande viele seiner Glaubensgenossen, nicht nur erstaunliche militärische und administrative Aktivitäten, sondern auch eine rege Bautätigkeit entfaltet. Das zeigten die mehr oder weniger gut erhaltenen Reste von verspielten Gebäuden, die sich hier und da fanden. Er ließ für seinen tatkräftigen Vater Hayder Ali, der die Grundlagen für seine Herrschaft gelegt hatte, ein reich verziertes Mausoleum samt feinem Garten erstellen. Es reichte zwar in Größe und Ausstattung nicht unbedingt an die gigantischen Bauten seiner großen Brüder in Nordindien heran, zeugte aber ebenfalls von einem nicht gerade unterentwickelten dynastischen Selbstbewusstsein. Nach seinem frühen Tod wurde er dann selbst darin zur Ruhe gelegt. Wir hielten noch bei einer Art Wasserpalast an, der ähnlich wie manche Schlösser der Loire, malerisch über den felsendurchsetzten Fluss Kauvery gebaut war, der die Stadt umfließt. Eine Schar Kinder verfolgte uns. Sie liefen in geschlossener Formation hinter uns her und stießen im Chor einen merkwürdig tonlosen Laut aus, der je nach unserer Reaktion mal lauter mal leiser reflexartig durch die ganze Gruppe lief, was an das Verhalten der landesüblichen Entenscharen erinnerte.
Die alte Residenzstadt Mysore zeigte in vieler Hinsicht, dass den Wodeyars die Kooperation mit den Engländern nicht geschadet hat. Schon vor ihren Toren empfing sie uns mit einem großen, weiß-leuchtenden Palast, der prachtvoll auf einem Hügel platziert war. Der Maharadscha Krishnaraja Wodeyar IV., der es, ohne seinem Ruf als großzügigem Wohltäter zu schaden, zu einem der reichsten Männer seiner Zeit gebracht hatte, hatte das weitläufige Anwesen in den 20-er Jahren des 20. Jh., zu einem Zeitpunkt also, als Ghandi und der Indian National Congress schon nachdrücklich für die Unabhängigkeit des Landes kämpften, noch zu Ehren und zum ausschließlichen Gebrauch des britischen Vizekönigs im englisch-palladianischen Stil errichten lassen - St. Pauls in London und englische Landhäuser ließen unverkennbar grüssen. In der Stadt gab es einen weiteren Palast, der noch wesentlich größer war. Diesen hatte sich Krishnaraja Wodeyar IV. ein paar Jahre früher im indo-sarazenischen Zuckerbäckerstil gebaut. Er wurde dabei vermutlich tatkräftig von den Engländern unterstützt, welche die alten indischen Herrschergeschlechter noch im 20. Jh., als man zu Hause längst keine Schlösser mehr baute, politisch gerne mit Märchenschlössern und dem dazu gehörigen Lebensstil ruhig stellten. Der Palast, dessen Konturen aus Tausendundeine Nacht bei Nacht im Glanze tausender Glühbirnen erstrahlten, wurde noch immer von der Familie des Maharadschas bewohnt. Dies wurde ihr einschließlich des elektrischen Glanzes ohne Zweifel durch die Apanage erleichtert, welche der indische Staat der herrschaftlichen Familie Jahr für Jahr dafür zahlte, dass sie, wie alle indischen Fürsten, „ihr“ Territorium an die 1947 neu gegründete Indische Union abgetreten hatten.
Allerdings schien es so, als könnten die Lichter des Maharadschas bald ausgehen. Indien, das seine Bevölkerung nicht satt bekam, war gerade in der heftigsten Diskussion darüber, ob es sich den Luxus einer derartigen Alimentierung alter Dynastien leisten konnte. Erstaunlich viele Inder, vermutlich allerdings nicht die Ärmsten, waren dabei mit inzwischen europäisch geschultem Rechtsbewusstsein der Auffassung, dass man die seinerzeit geschlossenen Verträge nicht so einfach brechen könne. Der herrscherfamilienfeindliche Vorstoß zur Abschaffung der Apanagen kam von der energischen Premierministerin Indira Ghandi, der Tochter des ehrenhaften Staatsgründers Nehru, welcher den Deal mit den Fürsten mit ausgehandelt hatte. Merkwürdigerweise zeigte die gleiche Dame zugleich aber viel Verständnis für neue Formen familiärer Dynastie- und Besitzbildung. Sie schob gerade eines der größten voll subventionierten Industrieprojekte des Landes, den Bau eines neuen Kleinwagens, mit der reinsten Unschuldsmiene ihrem 23-jährigen Sohn Sanjai mit der Begründung zu, sie könne keinen jungen Menschen in Indien mehr zu unternehmerischer Tätigkeit ermutigen, wenn sie diesem talentierten jungen Mann nicht die Chance zum Bau des Autos gebe. Sanjai bekam also die Chance, die ihm zustand. Da er aber weder eine Ahnung vom Autobau noch von Unternehmensgründung hatte, hat er sie nicht genützt und hat das Autoprojekt nach allen Regeln der Kunst in den Sand gesetzt. Da jeder eine zweite Chance verdient, wurde er danach zum Nachfolger seiner Mummy aufgebaut, fiel aber 34-jährig seinem eher fürstlichen Lebensstil zum Opfer. Er kam bei einem Sport zu Tode, den er offenbar für sich und dem Zustand seines Landes angemessen hielt: er stürzte mit einem Kleinflugzeug bei dem Versuch ab, über seinem Büro ein Looping zu drehen. Nach dem Tode Sanjais schlug die Neigung zu politischer Dynastiebildung, die in ganz Südasien endemisch ist, noch erstaunlichere Loopings. Die Stelle des Kronprinzen übernahm nun flugs sein älterer Bruder Rajiv ein, der sich bislang nur als, allerdings kommerzieller, Flugzeugkapitän, hervorgetan hatte. Als solcher „erbte“ er, nachdem seine Mutter ermordet worden war, deren politische Positionen als Vorsitzender der altehrwürdigen Congress Party und als Premierminister. Und nachdem auch er gewaltsam zu Tode gekommen war, musste dessen Ehefrau die Familientradition fortführen und den Parteivorsitz der Congress Party übernehmen, und dies obwohl sie keine Inderin, sondern eine gebürtige Italienerin war.
Wie konnte Raju, musste man sich fragen, in einer solchen Gesellschaft ohne Familie zurechtkommen?
Wir besichtigten in Mysore, das für indische Verhältnisse einen ziemlich geordneten Eindruck machte, noch einige weitere Beispiele dynastischer Prachtarchitektur. Raju, der ähnliches aus Madras kannte, war auch davon nicht sonderlich beeindruckt. Ein Führer wies uns darauf hin, dass in der Nähe ein Naturreservat sei. Dort bekomme man bei einem Elefantenritt allerhand wilde Tiere, darunter Tiger und Büffel, zu sehen. Dies sei etwas, was Raju sicher interessieren würde. Wir beschlossen daher, das Abenteuer zu suchen und eine Landpartie nach dem Muster der Maharadschas zu machen. Vor unseren Augen standen dabei natürlich die Bilder des Filmes „African Safari“, den wir ein paar Tage zuvor gesehen hatten.
Das Reservat lag am Fuße der Nilgiri-Berge, in denen sich die Western Ghatts, die Bergkette, welche sich die ganze indische Westküste entlang zieht, mit über 2600 Metern zu ihren höchsten Höhen erheben. In das Reservat führte eine Straße, die sich endlos durch ein zerklüftetes Waldgebiet schlängelte und immer schlechter wurde. Schließlich war sie nur noch ein einfacher Weg. Abgesehen von der totalen Einsamkeit - jemand anderes als wir schien nicht auf die Idee zu kommen, das Reservat zu besuchen - ließ das Abenteuer auf sich warten. Der Wald hatte wenig von dem, was man sich unter einem saftigen tropischen Dschungel vorstellt. Er bestand im Wesentlichen aus Laubbäumen, deren Blätter in dieser Saison vertrocknet und weitgehend abgefallen waren. Dementsprechend sah er aus, als sei er von einer verheerenden Krankheit befallen. Einzig die riesigen Bambusgebüsche, welche die tiefen Flussschluchten überspannten, erinnerten daran, dass wir uns in tropischen Gefilden befanden. Wilde Tiere suchten wir vergebens. Ranger, die wir danach befragten, bedeuteten uns, dass sie wegen der Trockenheit auf die andere Seite des Parks gezogen seien, die im Staat Tamil Nadu liege. Dort würden wir sicher welche sehen. Wir drangen daher in der beginnenden Dämmerung weiter in den Wald vor, bis wir tief unten in einem Tal an die Grenze zwischen den Bundesstaaten Tamil Nadu und Karnataka kamen, wo es mit Schlagbäumen und Kontrollposten wie bei einer Staatsgrenze zuging. Irgendwann durften wir nur noch in Begleitung eines bewaffneten Soldaten weiter fahren, wofür wir einen nicht eben bescheidenen Obolus zu errichten hatten. Da der Mann kein Wort Englisch sprach, musste Raju dolmetschen. Er zeigte sich dabei, wiewohl er die Sprache beider Seiten nicht beherrschte, recht erfinderisch. Spätestens jetzt schien Abenteuer angesagt. Angestrengt hielten wir in der beginnenden Dämmerung Ausschau nach wilden Tieren, für deren Abwehr wir die bewaffnete Macht benötigen würden. Gelegentlich sahen wir ein Schild, das vor Elefantenpassagen warnte. Ansonsten sichteten wir nur ein paar Pfauen, die man im Norden überall sieht, und Affen, für deren Anblick man in Indien nicht in ein abgelegenes Reservat fahren muss. Raju, der sich mit Affen auskannte, warf Steine nach ihnen, worauf sie sich in rasendem Tempo durch die Baumwipfel schwangen. Von dort sprangen sie aus großer Höhe auf die Enden von Bambusstangen, die sich dadurch weit in die Tiefe eines Bachbettes bogen, um anschließend wieder in die Höhe zu schnellen. Das war immerhin so rasant, dass man es wild life nennen konnte. Raju und ich versuchten es den Affen nachzumachen und auch in den Bambusstangen zu schaukeln. Aber da wir nicht aus Baumwipfeln springen konnten, kamen wir nicht mal in die Nähe der Bambusrohre, die hierfür dick genug gewesen wären. Das kleinere Bambusgebüsch, das ihnen vorgelagert war, erwies sich als so stachlig, dass wir bald ziemlich verkratzt aufgaben. Raju inspirierte dies später zu einem Bild, in dem er dieses Dschungelabenteuer festhielt. Höhepunkt des wilden Tierlebens war schließlich eine Herde von spotted dear, Rehen mit hellbraunem Fell, das recht malerisch mit weißen Punkten besetzt ist. Die Tiere, wohl vierzig an der Zahl, schauten uns eine Weile verwundert an. Als wir uns auf sie zu bewegten, flüchteten sie. Richtig wilde Tiere bekamen wir nicht zu sehen. Auf dem Hintergrund von „African Safari“ konnte all das natürlich weder uns noch Raju sonderlich überzeugen.
Den Abend verbrachten wir neben einem Touristenbungalow, wo wir unter den Augen der neugierigen Dorfbevölkerung das köstliche Mahl einnahmen, das der Koch für uns eingepackt hatte. Seit langer Zeit nächtigten wir wieder einmal in unserem Wagen. Raju schlief, gegen die Kühle der Nacht gut in Decken verpackt, vorne auf der Sitzbank, was ihm offensichtlich großes Vergnügen bereitete.
Am nächsten Morgen fragten wir bei der Reservatsverwaltung, wo denn nun Wild-Tiere zu sehen seien. Ein Ranger führte uns zu einem Platz, wo wir sicher Tiger beobachten könnten. Dort angekommen war von den Raubkatzen aber weit und breit keine Spur. Der Ranger deutete auf eine Stelle am Boden und meinte, gestern habe hier ein Tiger gelegen. Unter diesen Umständen verzichteten wir auf den geplanten Wild-life-Elefantenritt, bei dem wir vermutlich nur weitere Stellen gesehen hätten, wo gestern wilde Tiere gewesen waren. Es blieb dabei, dass es bei unserer Landpartie am Angriff eines zähnefletschenden Tigers fehlte - wenn man mal von der geistigen Begegnung mit dem „Tiger of Mysore“ absieht.
Zurück in Mysore setzten wir unser Kulturprogramm fort. Wir besuchten die Chamundi hills, die sich gleich neben der Stadt auf über 1000 Meter erheben und die, wenn man nicht, wie wir, mit dem Auto hinauffährt, über 1000 Stufen zu erklimmen sind. Von den Hügeln, die zu den heiligsten Bergen Südindiens gehören, hat man einen umwerfenden Blick auf die Stadt, ihre Paläste und allerhand sonstige Prachtgebäude. Hier besiegte nach der Sage eine Göttin mit dem Namen Chamundi in einer wilden Schlacht einen jener zahlreichen Dämonen, welche die Hindumythologie bevölkern. Diese Kreaturen erscheinen den Menschen in Indien noch heute gefährlich und können nach ihrer Vorstellung selbst den Göttern ziemlich lästig werden. Da die Göttin mit ihrer Tat das Gebiet um die heutige Stadt Mysore, das der Dämon einmal beherrscht und tyrannisiert hatte, befreite, baute man ihr hier oben einen schönen Tempel mit einer prachtvollen Eingangspyramide. Als wir uns demselben näherten, fand dort gerade eine Zeremonie statt. Die gedrungene schwarze Statue der Göttin, die von bunter Kleidung und Blumenbändern fast ganz zugedeckt war, wurde, begleitet von greller Musik, in feierlicher Prozession um den Tempel getragen und durch eines seiner prachtvollen silbernen Portale wieder zurück in das Allerheiligste gebracht. Raju, der solche Zeremonien sicher schon oft erlebt hatte, beobachte alles mit großem Ernst.
Von Chamundis Tat profitierte nicht zuletzt das Geschlecht der Maharadschas von Mysore, da erst so die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, dass sie ihre Herrschaft über das Territorium etablieren konnten. Chamundis Tempel ist daher auch das Hausheiligtum der Herrscherfamilie. Krishnaraja Wodeyar IV. wusste die Hügel aber nicht nur unter dynastisch-spirituellen Gesichtspunkten zu schätzen. Er hatte sich hier nach all den anderen Palästen noch Ende der 30-er Jahre in schönster Aussichtslage einen dringend benötigten ansehnlichen Sommerpalast gebaut, ebenfalls im indo-sarazenischen Stil. Ehrfurchtsvoll berichtete man, dass der Mann, der als Philosoph auf dem Thron galt, seine hochgeistigen Studien hier auf der Höhe über seiner prächtigen Hauptstadt betrieben habe.
Auf dem Weg zurück in die Stadt gab es noch tierische Höhepunkte. Zunächst passierten wir einen außerordentlichen Nandi-Bull, das Reittier Shivas, dem in den Tempeln für diesen großen Gott regelmäßig ein Pavillon gegenüber dem Allerheiligsten gewidmet ist. Mit fünf Metern Höhe und acht Metern Länge ist der Bulle von den Cahmundi hills der drittgrößte in ganz Indien. Der Auftrag für die Erstellung des Kolosses, der vor dreihundert Jahren in einem Stück direkt aus dem Felsen geschlagen worden war, kam von einem Maharadscha der Familie Wodeyar, in der man schon damals groß dachte. Derselbe veranlasste auch den Bau der tausend Stufen, die auf den Berg hinauf führen. Schließlich gab es auch noch wild life. Zwei Mungos huschten über die Straße. Da die kleinen Raubtiere nicht einmal vor Giftschlangen Angst haben, kann man sie als wilde Tiere bezeichnen.
Um unseren Weekend-Ausflug komplett zu machen, besuchten wir noch die prachtvollen Gärten des Maharadschas. Man hat sie geschickterweise unterhalb eines großen Dammes angelegt, mit dem man das Wasser des Kauvery-Flusses, der Lebensader von Karnataka und im Übrigen auch von Tamil Nadu, aufstaute, um damit die Stadt Mysore und die ganze Gegend zu versorgen. Als Nebenprodukt konnte man damit auch die Gärten bewässern und alle möglichen Wasserspiele betreiben einschließlich einer gewaltigen Fontäne, die, den Druck des Stausees nutzend, weit in die Höhe schoss. Wir erlaubten uns mitten in den Gärten des Maharadschas unter den großen Bäumen zu speisen. Während Judi das Mahl bereitete, kühlten sich Raju und ich in den Wasserspielen. An diesem Sonntag waren auch viele wohlhabende Inder mit ihren Ambassadors unterwegs, die meist ziemlich voll gestopft waren - aus einem der fünfsitzigen Wagen kletterten nicht weniger als zehn Personen heraus. Unser geräumiges Gefährt, das nur mit zwei und, was die Platzverdrängung betrifft, einer weiteren allenfalls halben Person besetzt war, war für sie eine Sehenswürdigkeit, zumal in Indien Fahrzeuge mit Küche, Toilette, Dusche und Betten völlig unbekannt waren. Mehrere Personen kamen, um unseren Wagen zu besichtigen und baten um die Erlaubnis, ihn fotografieren zu dürfen, was Raju natürlich mächtig stolz machte.
Anschließend ging es durch ausgetrocknete karge Landschaften wieder zurück nach Bangalore, wo uns der Koch, obwohl wir viel früher ankamen als angekündigt, schon mit einem gut bürgerlichen deutschen Mahl erwartete. Raju war sichtlich erfreut, wieder „zu Hause“ zu sein. Er plauderte mit den Dienern, denen er sich zugehörig fühlte. Gleichzeitig genoss er, dass er von diesen der Herrensphäre zugeordnet wurde. Abends waren noch einmal heimische Brettspiele angesagt. Raju entwickelte eine Vorliebe für Halma, das ein gewisses strategisches Denken verlangt.