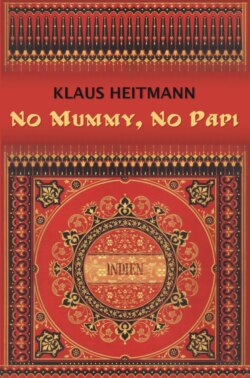Читать книгу No Mummy, No Papi - Klaus Heitmann - Страница 3
1.
Оглавление„No mummy, no papi, very very hungry" rief uns ein kleiner dunkelhäutiger Junge im November 1970 auf der Mount Road von Madras zu und streckte uns die Hand entgegen. Unsere Antwort war der Beginn einer langen und ziemlich turbulenten Geschichte.
Wir hatten die sieben Worte, die uns der Junge entgegen warf, in Indien schon oft gehört. Unzählige zerlumpte, kleine Wesen plapperten sie geradezu mechanisch vor sich hin, wo immer sich Europäer zeigten. Dass diese Kinder hungrig oder schlecht ernährt waren, traf in der Regel sicher zu. Wir glaubten aber nicht, dass der erste Teil des Satzes stimmte. Die Verhältnisse unter den zahlreichen Menschen, die in Indien auf der Straße wohnten, waren nach unserer Beobachtung nicht ohne jede Ordnung. Es schien uns daher wenig wahrscheinlich, dass die bettelnden Kinder, die häufig erst wenige Jahre alt waren, weder Vater noch Mutter hatten oder auch nur, dass sich niemand um sie kümmerte. Im Gegenteil - vieles sprach dafür, dass die Kinder im Auftrag von Erwachsenen bettelten, die auf diese Weise ihren Lebensunterhalt bestritten.
Wir hatten uns eigentlich entschlossen, das Betteln, vor allem bei Kindern, nicht zu unterstützten. Wir glaubten, dass die Menschen, wenn man darauf einging, davon abgehalten würden, bessere und würdigere Methoden der Lebensvorsorge anzustreben. Außerdem hatte sich im Laufe der Zeit bei uns Resignation breit gemacht. Was konnte ein Einzelner angesichts des allgegenwärtigen Elends in Indien ausrichten?
An diesem Abend im November 1970 aber muss uns der Teufel geritten haben – oder war`s ein Gott? Denn wir wichen von unserem Vorsatz ab. Warum wir es taten, ist uns nie ganz klar geworden. Vielleicht lag es daran, dass der kleine Tamile nicht einfach eine milde Gabe verlangte. Er hatte, wiewohl es nicht nötig war, die Scheiben unseres Wagens geputzt und sein Betteln als die Forderung nach Entgelt für seine Leistung dargestellt. Vielleicht lag es auch an dem erfrischend offenen Blick, mit dem uns der Junge in die Augen sah. Wahrscheinlich hat aber auch der Umstand eine Rolle gespielt, dass uns in der indischen Gesellschaft etwas vom Allmächtigkeitsnimbus der alten Kolonialherren umgab. Davon abgesehen befanden wir uns in einer persönlichen und sozialen Situation, die etwas Phantastisches und Exotisches hatte. Das verleitete uns zur großen Geste und zu Dingen, die man eigentlich nicht tat.
Spontan ließen wir dem Jungen über Shamela, eine indische Bekannte, die uns begleitete, sagen, dass er von uns zwar kein Geld bekomme; wenn er aber Hunger habe, dann solle er zum Essen mit uns nach Hause kommen. Der Junge bedeutete uns, einen Moment zu warten. Er verschwand um die Ecke, kehrte kurz darauf mit einem kleinen Paket unter dem Arm zurück und erklärte, dass wir losfahren könnten.
In diesem Augenblick wurde uns klar, worauf wir uns eingelassen hatten. Die kurze tropische Abenddämmerung hatte gerade begonnen. Wenn wir den Jungen, der sechs bis acht Jahre alt sein mochte, in unsere Wohnung, die eine halbe Stunde entfernt in einem Vorort lag, mitnähmen, käme er erst lange nach Anbruch der Dunkelheit zurück. Selbst bei einem Straßenkind war zu befürchten, dass die Erwachsenen, die sich für ihn verantwortlich fühlten, beunruhigt sein und uns später Vorwürfe machen würden. Außerdem wussten wir nicht, was man in der bürgerlichen Vorstadt, in der wir wohnten, von unserem Vorhaben dachte. Wir hatten, das war klar, ein Wort gegeben, dass wir so unmöglich halten konnten.
Was sollten wir also tun mit dem kleinen Tamilen, der uns mit großen Augen so erwartungsfroh anblickte? Der erlösende Gedanke kam beim näheren Anblick des Jungen. Seine Kleidung bestand aus einer kakifarbenem kurzen Hose, die ihm einige Nummern zu groß war, und einem Hemd von undefinierbarer dunkler Färbung. Schuhe besaß er nicht. Die Hose wurde am Bund mit einer einfachen Stecknadel zusammengehalten. Das Hemd hing offen, weil knopflos, über der Hose. In dem Paket unter seinem Arm, das nach seinen Angaben seine ganze Habe enthielt, befand sich ein Ersatzhemd, das auch nicht besser war. Der Junge konnte also ein neues Hemd gebrauchen. Wir entschlossen uns daher, ihn mit dem Kauf eines Kleidungsstückes zu vertrösten. Essen, so erklärten wir ihm, könne er bei uns ein anderes Mal.
Der Kauf eines Hemdes für den Jungen war nicht so einfach, wie wir uns das vorstellten. Wir befanden uns auf der vornehmen Mount Road, der Hauptstrasse von Madras, die nach dem Berg benannt ist, wo im Jahre 72 n. Chr. der Apostel Thomas den Märtyrertod gestorben sein soll. Als wir den nächstgelegenen Kleiderladen betraten, wurde der Junge vom Türwächter am Kragen gepackt und auf ziemlich unchristliche Weise wieder auf die Straße befördert. Erst als wir versicherten, er gehöre zu uns, durfte er eintreten. Man beobachtete ihn aber mit einer Mischung aus Argwohn und Amüsement.
Wir fanden ein Hemd, das nicht schon beim ersten Tragen allen Schmutz abbilden würde, mit dem ein Straßenjunge konfrontiert wird. Der Junge zog es an und schien hocherfreut. Allerdings hatte er über diese textile Vertröstung das Wesentliche nicht vergessen. Kaum hatten wir den Laden verlassen, wollte er wissen, ob er morgen zu uns nach Hause kommen könne. Wir versprachen, ihn am nächsten Nachmittag um drei Uhr abzuholen. Als Treffpunkt machten wir die große Bushaltestelle auf der Mount Road aus.
An jenem Tag im November 1970 wurde Raju zum zweiten Male geboren, ein Privileg, das die Brahmanen, die man in Indien die Zweimalgeborenen nennt, eigentlich für sich reserviert haben.