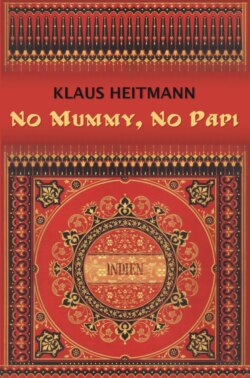Читать книгу No Mummy, No Papi - Klaus Heitmann - Страница 12
10.
ОглавлениеDie zweite Woche unseres Aufenthaltes in Bangalore konnten wir nicht mehr in „unserem“ gastlichen Haus verbringen, da es anderweitig belegt war. Wir wurden im Gästehaus der Fa. Mico untergebracht, das sich in einem Viertel am Rande der Stadt befand, das mit seinen prächtigen Villen den Wohlstand der indischen Mittelschicht besonders anschaulich spiegelte. Das Gästehaus war zwar modern und zweckmäßig eingerichtet, ihm fehlte aber ein Garten und überhaupt der familiäre Charakter. Eine kleine, exotisch schöne, fröhliche Tamilin versorgte uns und das Haus. Sie bereitete auch die Mahlzeiten, wobei sie sich um europäischen Geschmack bemühte, diesen aber meist verfehlte.
Während Judi und Raju den Tag im Gästehaus oder in der Stadt verbrachten, hielt ich mich bei der Fa. Mico auf. Schon beim Betreten des Firmengeländes war man in einer anderen Welt. Statt des Durcheinanders, das sich bis unmittelbar vor die Tore der Firma ausbreitete, herrschte hier deutsche Ordnung. Sie wurde allerdings in einer Weise zelebriert, die man in Deutschland selbst kaum finden dürfte. Gepflegte Rabatten umgaben die Verwaltungsgebäude, nirgends lag ein Gegenstand, der nicht dort war, wo er hingehörte. Man war offensichtlich darum bemüht, der indischen Neigung zum Chaos einen überdeutlichen Kontrapunkt entgegenzusetzen. Ich wurde als der „Gentleman from Germany“ äußerst zuvorkommend behandelt. Für die Erfüllung meiner Wünsche und Bedürfnisse stand immer ein Angestellter bereit, der mir mit der größten Ehrfurcht begegnete. Er begleitete mich selbst noch auf dem Gang zu „Officers Toilet“. Für mich zuständig war ein Sekretär, dem wiederum allerhand Untersekretäre zur Verfügung standen, die vor ihm eine große Bandbreite von Unterwürfigkeitsgesten zeigten. Der Mann neigte angesichts der indischen Malaise zu schwermütigen Spekulationen. Irgendwann zog er einmal einen Satz von Schopenhauer hervor, dessen Pessimismus wahrscheinlich seiner Seelenlage entsprach. Der Sekretär schickte mich zu den verschiedenen Abteilungen vom Marketing über den Verkauf bis zur Fertigung. Dabei lernte ich unter den höheren Angestellten der Firma, mit denen ich ausschließlich zu tun hatte, eine Menge blitzgescheiter und sehr eloquenter Leute kennen. Sie kamen so gut wie ausschließlich aus den hellhäutigen obersten Kasten. Eine Firma wie Bosch konnte sich offensichtlich die besten Leute aus dem großen Reservoir intelligenter und gut ausgebildeter Inder aussuchen.
Die Gespräche drehten sich immer um die Probleme, welche die unternehmerische Tätigkeit in Indien so sehr erschweren. Man beklagte den notorischen Devisenmangel, der daraus resultierte, dass sich das Land in staatssozialistischer Weise vom kapitalistischen Weltmarkt abschottete und daher über keine frei konvertierbare Währung verfügte. Dies führe, wie man mir berichtete, absurderweise etwa dazu, dass Mico Komponenten, welche man von der deutschen Mutterfirma benötigte, über die kommunistische Tschechoslowakei bezog, weil man dort über ein Devisenkontingent verfügte, aus politischen Gründen aber auch indische Rupien als Zahlungsmittel annahm. Eine erhebliche Erschwernis sei die Unzuverlässigkeit der Arbeiter. Sie fehlten nicht nur an den zahlreichen offiziellen Feiertagen, die das Land den verschiedenen religiösen Gruppierungen zugestand. Sie kämen, meist ohne vorherige Ankündigung, auch dann nicht zur Arbeit, wenn ihnen lokale oder familiäre Ereignisse und Feste wichtiger schienen. Hinzu komme das wenig entwickelte Konsumdenken bei der Masse der Bevölkerung. Diese neige, einer tief verwurzelten indischen Haltung entsprechend, dazu, sich mit dem zufrieden zu geben, was man habe oder was schon immer da oder eben nicht da gewesen sei. An die Vorsorge für die Zukunft zu denken, sei einfachen Menschen ziemlich fremd. Viele Arbeiter kämen daher nur, wenn sie Geld zur Deckung des aktuellen Bedarfs brauchten. Das paradoxe Ergebnis sei, dass sie umso unzuverlässiger seien, je mehr sie verdienten. Mico habe deswegen das kostenlose Mittagessen eingeführt, da dies einen aktuellen Bedarf bediene. Danach habe sich die Anwesenheitsrate tatsächlich merklich verbessert. Der indischen Neigung zu abstrakten Spekulationen entsprechend landete man bei diesen Diskussionen meist in einer allgemeinen Erörterung der verschiedenen Sozial- und Wirtschaftsysteme, insbesondere darüber, ob der Weg zwischen kapitalistischer und sozialistischer Marktwirtschaft, den Indien praktizierte, seiner Entwicklung förderlich oder eher hinderlich war. Manch einer der intelligenten Herren glaubte dabei, die Lösung der indischen Probleme sei am ehesten von einem starken Mann zu erwarten, wobei man sich denselben, möglicherweise auch um mir zu schmeicheln, ausgerechnet nach Art des deutschen Superhelden Hitler vorstellte, der in Indien als Feind der Engländer mit ganz anderen Augen als bei uns gesehen wird. Ich fand mich bei all diesen Diskussionen merkwürdigerweise in der Rolle dessen, von dem man erwartete, dass er in der Lage sei, in diesen Fragen einen Erkenntnisgewinn zu vermitteln.
Nach den Höhenflügen in die abstrakte Welt der Sozial- und Wirtschaftsmodelle ging es nach Dienstschluss wieder hinab in die konkreten Niederungen am entgegen gesetzten Ende der sozialen Skala. Die Fragen hier waren freilich nicht weniger grundsätzlicher Natur. Da es in unserer Bleibe keine Spiele gab, war abends Unterricht angesagt. Wir stellten Raju zunächst etwas komplexere Additions- und Subtraktionsaufgaben. Losgelöst von einem konkreten Kontext tat er sich recht schwer, zumal er keine abstrakte Vorstellung vom Dezimalsystem hatte, also nicht wusste, dass sich bei einer Addition oder Subtraktion von 10-er Einheiten die Ziffer am Ende einer Zahl nicht verändert. Er arbeitete mit einem offenbar selbst gebastelten Fünfersystem, das von den Fingern einer Hand ausging. Dabei nahm er, um auf die für ihn „handhabbaren“ 5-er Einheiten zu kommen, die nötigen Subtraktionen vor und rechnete die entsprechenden Beträge nach Abschluss der 5-er Operationen wieder hinzu. Bei komplexeren Rechnungen verlor er aber leicht die Übersicht über seine Zwischenrechnungen, weswegen er Papier und Bleistift hinzuzog. Später gingen wir zum Multiplizieren und Dividieren über, wo er mit seinem System noch viel schneller hängen blieb. Anders als beim Malen, wo er sich lange in die Arbeit an einem Bild vertiefen konnte, war seine Geduld bei abstrakten Problemen dieser Art bald erschöpft. Tausendmal wiederholte er die Fragestellung, als habe er sie gleich nach dem Hören wieder vergessen, wobei sicher auch sprachliche Verständnisprobleme eine Rolle spielten. Bald konnte er kaum mehr still sitzen, machte allen möglichen Fez und zeigte seinen unbegrenzten Einfallsreichtum beim Fratzen- und Schnutenziehen. Zum Ausgleich gab es vor dem Schlafengehen dann eine große Balgerei und Kitzelei. Zum ersten Mal in seinem Leben schlief Raju hier in einem eigenen Bett, was er sichtlich genoss. Es war ein richtiges Bett mit vier Füßen und einem Moskitonetz darüber.
Einer der Leute des mittleren Managements von Mico sollte für uns und Raju noch bedeutsam werden. Es handelte sich um Mr. Sheshadri, einen gelernten Journalisten, der die Abteilung Public Relations leitete. Als solcher gab er das Mitteilungsblatt der Firma „Mico Wheel“ heraus, in dem er kundige und gut geschriebene Aufsätze zu allen möglichen Themen veröffentlichte. Mr. Sheshadri war einer jener eloquenten Brahmanen, mit denen man sich über alles unterhalten konnte. Er war Mitte Dreißig, weit gereist, höchst belesen, an allem interessiert und über alles informiert, was in der Welt passierte oder irgendwann einmal passiert war. Als wir ihm erzählten, wir hätten zuletzt in Berlin gewohnt, verblüffte er uns mit der Kenntnis von Straßennamen und allen möglichen sonstigen Details der Stadt, obwohl er noch nie dort gewesen war. Mr. Sheshadri lud uns in sein Haus ein, das er mit seinen Eltern samt einer Reihe von Hausangestellten bewohnte. Das Haus hatte sein Vater, ein pensionierter Arzt, der offensichtlich einmal gut verdient hatte, in einem Villenviertel der Stadt gebaut. Vom Wohlstand seiner aktiven Zeit zeugte nicht nur das großzügige Anwesen, sondern auch ein alter, amerikanischer Wagen der Marke Buick, der völlig verstaubt in der Garage stand. Diese Herkunft hinderte Mr. Sheshadri aber nicht, großen Anteil an Rajus Schicksal zu nehmen, das er außerordentlich faszinierend fand. Raju wiederum spürte das Wohlwollen und Interesse, das ihm Mr. Sheshadri entgegenbrachte und zeigte sich ihm gegenüber von seiner besten Seite. Großzügig bot uns Mr. Sheshadri an, bei der Gestaltung von Rajus Zukunft behilflich zu sein, was später noch Bedeutung erlangen sollte.
Bei unserem Besuch im Hause von Mr. Sheshadri kamen wir auch auf Musik zu sprechen. Sachkundig erklärte er uns die Faktur der klassischen indischen Musik, deren Rhythmik und Harmonie so überaus komplex und für unsere Ohren so verwirrend wie die meisten Ausformungen der indischen Hochkultur ist. Seine Frau spielte uns dazu einiges auf der Veena, dem südindischen Gegenstück zur Sitar vor, was Raju mit großem Interesse verfolgte. Danach legte Mr. Sheshadri auf seiner Stereoanlage, auf die er besonders stolz war - ein Kollege hatte sie ihm aus Japan mitgebracht -, eine Schallplatte mit Musik von Mozart auf. Da man in der europaklassikfreien Zone Indien solche Musik nicht zu hören bekommt, erschien mir dies wie ein wahres Wunder. Raju hörte verwundert zu, konnte mit dieser Musik allerdings nicht viel anfangen. Spätestens nachdem ich auch noch Mr. Sheshadris überquellende Bibliothek, wo die Bücher in Doppelreihen standen, gesehen hatte, war klar, dass wir in vieler Hinsicht auf der gleichen Wellenlänge lagen.
Mr. Sheshadri machte mich im Übrigen auch darauf aufmerksam, dass es in Bangalore einen Antiquar gebe, der recht ausgefallene Bücher habe. Er begleite mich zu dem kleinen Laden in der Innenstadt, in dem in chaotischer Unordnung alle möglichen Bücher gestapelt lagen. Ich fischte aus den verstaubten Haufen unter anderem eine alte, englische Ausgabe des Hauptwerkes von Shankara, dem großen indischen Philosophen vom Anfang des 9. Jh. nach Chr., der die spezifisch indische Weltsicht auf den Punkt brachte, wonach die tatsächliche Welt nur Schein, die geistige Welt aber wirklich sei. Mit dieser Vorstellung, die dem Denken Platons ähnelt, das sich wiederum im Christentum niedergeschlagen hat, legte Shankara die theoretische Grundlage für jene Geringschätzung der Tatsachen, die es den Indern mitunter noch heute erschwert, sich den Problemen dieser Welt zuzuwenden. Die Ausgabe war Teil der monumentalen Edition der „Sacred Books of the East“, die so etwas wie die intellektuelle Ergänzung des politischen Weltmachtanspruchs der Engländer war. Sie wurde Ende des 19. Jh., als sich das Empire auf seinem Höhepunkt befand, von Max Müller herausgegeben, der seine große englische Karriere als vergleichender Religionswissenschaftler mit der Herausgabe des Rigveda, des ältesten und grundlegenden Religionstextes Indiens, begann, welche im Auftrag der East-India-Company erfolgte. Eine weitere bemerkenswerte Entdeckung war die - äußerst seltene - erste Ausgabe von H.G. Wells Erstlingsroman „Die Zeitmaschine“ aus dem Jahre 1895, die ein englischer Verwaltungsbeamter nach Indien verschleppt haben mochte. Im Mittelpunkt dieses ersten Science-Fiction Romans der Moderne steht eine Maschine, mit deren Hilfe man sich in eine andere Zeit und Welt versetzen kann. Der Held gelangt darin in eine Gesellschaft, in welcher die Klassenunterschiede auf die Spitze getrieben sind, was merkwürdig auf unsere Situation zu passen schien.