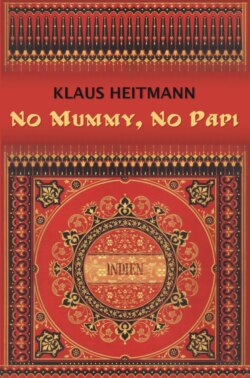Читать книгу No Mummy, No Papi - Klaus Heitmann - Страница 4
2.
ОглавлениеJudi und ich befanden uns seit etwa zwei Monaten in Indien. Der Aufenthalt dort war vordergründig beruflich bedingt. Ich konnte damals im Rahmen meiner Ausbildung als Rechtsreferendar eine Station im Ausland absolvieren. Dass dabei die Wahl auf Indien gefallen war, hatte sicher viel mit der Sehnsucht des Okzidents nach dem sagenumwobenen Land am Ganges zu tun, die schon Alexander den Großen nach Osten und Kolumbus nach Westen getrieben hatte. Hinzu kam bei mir möglicherweise die Spätwirkung einer Jugendlektüre. Als Kind hatte ich einige Bücher von Sabine Wörishöffer gelesen, in welchen Jungen, bei denen es sich meist um Waisenkinder handelte, in fernen Ländern in allerhand Abenteuer verwickelt wurden. Besonders beeindruckt hatte mich dabei das Buch „Kreuz und quer durch Indien“, in dem es um die Erlebnisse zweier Leichtmatrosen aus Deutschland in der Wunderwelt Südasiens ging. Darin wurden geheimnisvolle Zeremonien in düsteren Felsenhöhlen geschildert, in denen sich Bildnisse von vielarmigen Göttern und von merkwürdigen Wesen befanden, die teils Mensch teils Tier waren. Seitdem hatte Indien für mich eine Aura von Geheimnis und Abenteuer.
Im Übrigen lag die Beschäftigung mit Indien damals in der Luft. Unbefriedigt vom westlichen Aufklärungs-, Sicherheits- und Ordnungsdenken und enttäuscht über die Vereinzelung, in der sich das Individuum in den modernen Gesellschaften sah, machten sich im Westen seinerzeit viele Menschen tatsächlich oder in Gedanken auf den Weg nach Osten, wo sie Erlösung durch Aufgehen in einem wie auch immer gearteten großen Ganzen zu finden hofften. Die einen suchten sich in der Meditation, andere verloren sich in tantristischen Sexual- und Drogenexzessen, wieder andere meinten ihre Ewigkeitsbedürfnisse mit der Seelenwanderungslehre befriedigen zu können. Manch einer glaubte auch einfach, die Wiedergeburt eröffne ihm eine zweite Chance, nachdem ihm das erste Leben misslungen schien.
Schließlich gab es noch diejenigen, die das Abenteuer einer Reise in ein Land suchten, das unendlich weit entfernt schien. Die Fahrt nach Indien war nicht nur die längste Landreise, die man vom Westen Europas seinerzeit auf eigene Faust unternehmen konnte. Es war auch die Reise, mit der man sich am weitesten von den gewohnten Lebensverhältnissen zu entfernen schien. Diese Menschen faszinierte der Gedanke, die Welt aus einer fernen, völlig anderen Perspektive betrachten zu können. Zu dieser Sorte von Indienreisenden gehörten wir. Die Reise nach Indien sollte im Übrigen am Anfang unseres Familielebens stehen.
Wir hatten im Sommer 1970 in Berlin geheiratet. Mitte August begaben wir uns mit einem älteren VW-Bus, den der Vorbesitzer in liebevoller Eigenarbeit zu einem mobilen Heim ausgebaut hatte, auf die lange Fahrt nach Osten. Wir reisten durch den Balkan, durchschifften den Bosporus und das Schwarze Meer bis Trabzon, erkletterten von dort auf verschlungenen Wegen die Höhen Anatoliens und fuhren durch die endlosen, sommergelben Hochsteppen Vorderasiens. Im Osten der Türkei passierten wir den majestätisch aus der Hochebene aufragenden Berg Ararat, wo nach der Sage Noa's Arche gelandet sein soll, was nach christlich-jüdischer Vorstellung so etwas wie eine zweite Chance für das junge Menschengeschlecht nach einem misslungenen Anfang war. Es folgten die weiten, leeren Hochebenen des Iran und die Wüsten Afghanistans, wo sich die Berggirlanden kulissenartig endlos in die Tiefe staffelten, um schließlich in die gigantischen Ausläufer des Hindukusch überzugehen.
Mit uns zog eine Karawane westlicher Indiensucher, meist abgerissene junge Leute und Aussteiger, die dem Traum von einem Leben ohne westliche zivilisatorische Vorgaben und Zwänge nachhingen. Da es praktisch nur eine Route in das Land der gemeinsamen Sehnsucht gab, traf man sich unterwegs immer wieder und tauschte mit Anreisenden und Rückkehrern Erfahrungen aus. Schon in Westpersien erfuhr man so, in welchem Lokal man in Nepal den besten Kuchen bekam. Abends bildete man Wagenburgen, zündete ein Lagerfeuer an und philosophierte unter einem Himmel, der in einer Weise von Sternen übersät war, welche man in unseren Breiten nicht kennt, über die Probleme der Welt und des Lebens. In Indien verliefen sich die Orientabenteurer dann in alle Richtungen. Den einen oder anderen traf man an den Stationen wieder, an denen sich Reisende zusammenzufinden pflegen, an Bahnhöfen, in bestimmten Hotels oder an den großen Sehenswürdigkeiten. Dann berichtete man darüber, was man inzwischen erlebt und was man über das Schicksal anderer Mitreisender erfahren hatte.
Der Weg nach Osten war eine Reise in die Ferne und zugleich zu sich selbst. Mit jedem Kilometer entfernte man sich innerlich von der Welt des Westens. Schritt für Schritt verschoben sich die Lebenskoordinaten. Das Leistungs- und Sicherheitsdenken, welches das westliche Empfinden in so hohem Maße prägt, verblasste angesichts von Lebensumständen, die wesentlich fundamentalere Probleme aufwarfen. Beim Anblick von Menschen, die in Lehmhöhlen ohne Strom und eigenen Wasseranschluss lebten, stellte sich unweigerlich die Frage, ob man wirklich alles braucht, was in Europa als unverzichtbar gilt. Nie werde ich den Abend vergessen, den wir in einer afghanischen Karawanserei verbrachten. In düsteren Ziegelgewölben drängten sich im Kerzenlicht verwegen dreinblickende bärtige Gestalten mit weißen Turbanen und vergnügten sich bei Tee mit einem Brettspiel. Kaum einer von ihnen dürfte jemals die Schulbank gedrückt haben.
Wir betraten den indischen Subkontinent über den legendären Kaiberpass, der einzigen gut gangbaren Pforte in den gewaltigen Gebirgsriegeln, welche Indien nach Norden beinahe vollkommen abschirmen. Im Laufe der Jahrtausende waren über diesen Pass die Völker der kargen Steppengebiete Innerasiens immer wieder in die fruchtbaren Flussebenen Indiens vorgedrungen. Dort hatten sie sich als jeweils neue Oberschicht über die vorhandenen Schichten der Bevölkerung gelegt und so zur Bildung jener einzigartigen vertikalen Struktur der indischen Gesellschaft beigetragen, die sich bis heute im System der Kasten und nicht zuletzt in der Hautfarbe der verschiedenen gesellschaftlichen Einheiten spiegelt. Wir konnten den Drang der innerasiatischen Völker auf den Subkontinent nur zu gut verstehen. Nach tausenden Kilometern staubiger Trockenheit löste der Anblick seiner saftig-grünen, von Leben brodelnden Landschaften auch bei uns euphorische Gefühle aus.
Die Fahrt durch Indien war mühsam. Die Regenzeit war in vollem Gange. Das Land war weitgehend überschwemmt. Durch die Flusstäler wälzten sich wild braun-gelbe Fluten. Manche Flussüberquerung mit nicht selten hölzernen Fähren wurde zum Balanceakt, dessen Ausgang schwer zu kalkulieren war. Unpassierbare Brücken zwangen zu Umwegen, die mehrere hundert Kilometer lang sein konnten. Das Asphaltband der Strassen war in der Regel so schmal, dass darauf nur ein Fahrzeug Platz fand. Es wurde von den meist völlig überladenen Lastwagen in Anspruch genommen. Jedes Mal, wenn uns ein Fahrzeug entgegenkam, kam es zur Machtprobe. In der Regel mussten wir als die Besitzer des weniger robusten Gefährts unter schwersten Erschütterungen unserer mobilen Wohnung und des darin befindlichen Hausrates in die tief aufgewühlten schlammigen Bankette ausweichen. Morgens und abends waren riesige Viehherden auf den Strassen unterwegs und verwandelten dieselben mit ihren Exkrementen in Rutschbahnen. Die trägen Tiere, allen voran die urtümlichen Wasserbüffel, waren weder von unserem braven Boschhorn noch von den Stockschlägen sonderlich beeindruckt, die wir aus dem Auto verteilten, um sie zur Räumung der Fahrbahn zu veranlassen. Ohnehin diente die Straße allen möglichen anderen Zwecken. Man trocknete auf ihr Getreide, Chilischoten oder Wäsche und lagerte an ihren Rändern alle möglichen Gegenstände.
Unser Weg schien durch jedes der achthunderttausend indischen Dörfer zu führen. Das bunt gekleidete Volk lebte hier so, als habe die Zeit seit den Tagen Alexanders des Großen still gestanden. Die Strassen waren verstopft von Ochsenkarren, Lastrikshaws und Fahrrädern. Jederzeit musste man mit wiederkäuenden Kühen und Wasserbüffeln, spielenden Hunden und schlafenden Menschen rechnen. Auf diese Weise legten wir an einem Tag, an dem wir von Sonnenaufgang bis -untergang am Steuer saßen, kaum mehr als dreihundert Kilometer zurück.
In den überfüllten und schmutzigen Städten wurde man mit unsäglichem Elend aber auch ungeheurem Reichtum konfrontiert. Wo immer wir erschienen, verfolgten uns Bettler mit abenteuerlich verkrüppelten Gliedmaßen, toten Augen oder leprazerfressenen Gesichtern. Unzählige Menschen schliefen in schmutzige Tücher gehüllt am Straßenrand, der zugleich Küche und Wohn- und Schlafzimmer war. Nicht weit davon sah man gut gekleidete Reiche wohlgenährt und umringt von Dienern auf den Veranden klassizistischer Villen sitzen.
Auf dem Weg nach Süden kamen wir an manchen großen Zeugnissen aus der wechselvollen indischen Vergangenheit vorbei. Wir staunten über die weitläufigen, marmorhellen und figurlosen Bauten der Moghulen, allen voran das Taj Mahal, dessen überirdische Schönheit einen vergessen machen kann, dass es auch von der Ausbeutung des indischen Volkes durch Fremdherrscher zeugt, die aus trockenen und leeren Weltgegenden auf den feucht-heißen und wimmelnden Subkontinent gekommen waren. Dem gegenüber standen die verwinkelten, mystisch-düsteren und figurenüberladenen Heiligtümer der ursprünglichen indischen Religionen, in denen sich das pralle Leben des Subkontinentes aber auch die indische Neigung zur Verneinung des Irdischen spiegelt.
Eine Woche nachdem wir den indischen Subkontinent betreten hatten und vier Wochen nach unserer Abreise von Berlin kamen wir in Madras an, der Stadt, die der Ausgangspunkt für eine der erstaunlichsten Karrieren der Weltgeschichte war. Im Jahre 1743 begann hier der junge Robert Clive mit einer Tätigkeit als Schreiber bei der damals noch kleinen englischen East India Company. Er machte sie unter Ausnutzung der Rivalitäten, welche unter den indischen Potentaten bestanden, zu einem staatsähnlichen Gebilde, welches nach den Grundsätzen einer Handelsgesellschaft schließlich über den ganzen riesigen Subkontinent herrschen sollte. Er ist damit einer der Gründungsväter des „British Raj“, wie die Inder die Zeit der englischen Kolonialherrschaft nennen.
In Madras erfuhren unsere Verhältnisse eine unerwartete Wende. Mr. D., der Anwalt, in dessen ich hospitierte, bot uns einen bequemen Bungalow im Garten seines Hauses an, was für uns, die wir bislang nur in Studentenbuden gelebt hatten, eine neue Lebensqualität bedeutete. Das Anwesen lag in einer gutbürgerlichen und ziemlich ordentlichen Vorstadt, deren Straßen nur mit Nummern benannt waren. Mr. D. rief seine wichtigsten Klienten zusammen und stellte mich ihnen feierlich vor. Wir waren Ehrengäste bei herausragenden Feierlichkeiten, etwa der Einweihung einer neuen College-Bibliothek. Wohlhabende indische Familien luden uns in ihre Häuser ein und ließen uns an ihren prachtvollen Festen teilnehmen. Von der Position eines Rechtsreferendars, der in Deutschland mehr oder weniger als Student angesehen wurde und keine Beachtung fand, war ich plötzlich in den Status eines repräsentativen Gastes aus einem fernen Land geraten, mit dem man sich gerne sehen ließ.
Wir konnten die Rolle, die wir in der indischen Gesellschaft zugewiesen bekamen, nicht zuletzt deswegen mitspielen, weil uns das Gehalt eines deutschen Rechtsreferendars den entsprechenden Lebensstil erlaubte. Unser monatliches Budget betrug ein Vielfaches dessen, was die angestellten Anwälte im Büro von Mr. D. verdienten. Es entsprach nach Schwarzmarktpreisen etwa dem Gehalt des obersten Richters des Staates Tamil Nadu. Wir kauften auf der Mount Road ein, wo sich alles traf, was in Madras Rang und Namen hatte, insbesondere bei „Spencers“, einem Kaufhaus im Kolonialstil, in dem schon die Gattinnen der englischen Offiziere und Verwaltungsbeamten eingekauft hatten. Dort trafen sich nachmittags die Damen der indischen Gesellschaft und tranken Tee, während die Bediensteten des Kaufhauses an Hand von Einkaufslisten die gewünschten Waren zusammentrugen und von Trägern zu den schwarzen Ambassador-Limousinen bringen ließen, in denen die Chauffeure warteten.
Auch als Besitzer eines Autos gehörten wir zu den Privilegierten in der Stadt, schon deswegen, weil sich nur die Reichsten überhaupt einen Wagen leisten konnten. Da der Import von Fahrzeugen in Indien grundsätzlich verboten war, mussten zudem auch die Inder, welche sich ein teures Importfahrzeug hätten leisten können, in der Regel einheimische Produkte fahren. Das höchste der automobilistischen Gefühle war dabei jener „Ambassador“, ein auf der Basis eines englischen Nachkriegsmodells gebauter Mittelklassewagen, der technisch ziemlich veraltet war. Unser VW-Bus, der auch nicht gerade das neueste Baujahr hatte, wirkte dagegen wie ein technisches Wunderwerk. Hinzu kam, dass so etwas wie ein Wohnmobil in Indien völlig unbekannt war und in Übrigen alles, was aus dem Westen kam, bewundert wurde. Auf diese Weise trug ein Gefährt, mit dem man in Europa in der sozialen Hierarchie allenfalls auf der mittleren Ebene der Camping-Urlauber rangieren konnte, dazu bei, uns ein besonderes Ansehen zu verleihen. Nach wenigen Wochen war der Wagen auf der Mount Road allgemein bekannt.
Schließlich bekamen wir auch noch eine Dienerin. Sie wurde uns von Mr. D. vermittelt, der auch die Arbeitsbedingen festlegte - umgerechnet zwei Dollar pro Monat für die Erledigung aller anfallenden Arbeiten im Haus, wofür fünf Stunden am Morgen und weitere ein bis zwei Stunden am Abend veranschlagt wurden. Die junge Frau hieß Liz und lebte einige Straßen weiter in einer wilden Siedlung mit niedrigen Hütten, die aus Palmblättern gebaut waren. Da uns der Lohn absurd vorkam, wollten wir Liz das Doppelte zahlen. Mr. D. bat uns aber dringend, davon abzusehen, weil wir damit Unruhe unter den Dienern der Nachbarschaft erzeugen würden. Wir einigten uns schließlich darauf, dass wir Liz gelegentlich einen Sari schenken. Als wir ihr den ersten Sari gaben, zeigte sie das Geschenk allerdings sofort den Dienern in der Umgebung, mit der Folge, dass Mr. D. seinen zwei Dienerinnen ebenfalls Saris und seinem Diener sowie dem Chauffeur das entsprechende männliche Kleidungsstück, einen Lunghi, kaufen musste, was auch schon eine kleine Revolution war.
Im Laufe der Zeit nahmen wir immer mehr am Leben der indischen Oberschicht teil, ein Bevölkerungsteil, der sich von der Mehrheit schon durch ihre helle Hautfarbe unterschied. Vieles drehte sich in diesen Kreisen um Geld, Konsum und Familie. Man sprach vor allem darüber, wer westliche Waren besaß und was sie gekostet hatten, wie die neuesten amerikanischen Filme waren und wer wen mit welcher Mitgift geheiratet hatte oder demnächst heiraten werde. Uns gegenüber war man sehr offen und weihte uns selbst in Familiendetails ein. Einmal kam ein junger Anwalt aus dem Büro freudestrahlend zu mir und berichtete, er habe gerade erfahren, dass er nach dem Beschluss seiner Familie ein bestimmtes Mädchen heiraten werde. Er wollte mir die junge Dame vorstellen. Ich hatte aber schon vor ihm erfahren, dass und wen er heiraten werde.
Häufig besuchten wir den „Moore Market“, wo man so ziemlich alles kaufen konnte, was Indien zu bieten hatte. Reichlich spontan und ohne die Folgen zu bedenken, legten wir uns hier einen jungen Affen zu. Er war so klein, dass er in zwei Hände passte. Wir hegten und pflegten ihn, so gut wir es konnten. Er war aber, was wir nicht wussten, noch viel zu klein, um von seiner Mutter getrennt zu leben. Mangels einer wärmenden Mutterbrust und wohl auch aus Verzweiflung zog er sich schon bald eine Lungenentzündung zu, gegen die der Tierarzt, den wir verzweifelt mehrfach aufsuchten, nicht ankam. Er wurde immer apathischer und verstarb nach kurzer Zeit. Wir stellten fest, dass uns das kleine Wesen in der kurzen Zeit ans Herz gewachsen war und waren sehr betroffen, es wieder verlieren zu müssen.
Von der indischen Geisteswelt, die Europa so faszinierte, war in den Kreisen der indischen Gesellschaft, in denen wir verkehrten, wenig zu spüren. Auffällig war nur, welche wichtige Rolle man den Sternen gab. Vor allen wesentlichen Handlungen und Entscheidungen prüfte man, ob und wann die Auspizien dafür gut waren. Das führte unter anderem dazu, dass eine Hochzeit, zu der wir und tausend weitere Gäste eingeladen waren, nachts um drei Uhr stattfinden musste. Als ich einmal an einem Gerichtstermin teilnahm, ließ der Richter, dessen Astrologe errechnet hatte, dass der Zeitpunkt des offiziellen Sitzungstermins „unauspiziös“ war, dutzende von Anwälten stundenlang warten, bis die Sterne in der richtigen Position waren. Überhaupt waren nach indischer Vorstellung überall merkwürdige Mächte im Spiel. Ein gestandener Anwalt aus dem Büro von Mr. D etwa kam, kurz nachdem er die Kanzlei zum Mittagessen verlassen hatte, wieder er ins Büro. Auf meine Frage, warum schon wieder zurück sei, antwortete er, dass vor ihm gerade eine Person mit einem Bündel Holz auf dem Kopf über die Strasse gegangen sei, was Unglück bedeute. Er sei zurückgekommen, um ein paar Minuten im Büro abzuwarten. Wenn er danach erneut losgehe, sei das Unglück vorbei.
Meine Tage verbrachte ich, nicht zuletzt der Klimatisierung und der guten Ordnung wegen, zu einem erheblichen Teil im deutschen Kulturinstitut. Es war in Indien nicht, wie in allen anderen Ländern, nach der deutschen Vorzeigefigur Goethe benannt, der angesichts der mangelnden Realitätsnähe ihrer Artefakte nicht nur Lobendes über die indische Kultur gesagt hatte, sondern nach einer Person mit dem schönen deutschen Allerweltsnamen Max Müller, mit dem wiederum die Deutschen wenig anfangen können. Damit versuchte man, den großen deutschen Indologen dieses Namens zu repatrisieren, der im 19. Jahrhundert in England Karriere gemacht hatte. Im Max Mueller Bhavan, wie die Institute in Indien heißen, beschäftigte ich mich stärker als je zu Hause mit der Kultur und Literatur, für die Goethe steht. Die „indische“ Perspektive, aus der ich nun auf meine Heimat sah, hatte mich vor eine Fülle von Fragen über meine eigene Kultur gestellt. Zugleich verlor meine engere Heimat aus der Ferne viel von ihrer besonderen Natur und wurde zu einem nur noch wenig unterscheidbaren Teil des Kulturraumes Europa.
Im Max Mueller Bhavan lernten wir auch Shamela kennen, die uns bei unserem ersten Zusammentreffen mit Raju begleitet hatte. Shamela war Deutsch-Lehrerin am Institut. Sie war eine zierliche kleine Tamilin von exotischer Schönheit und bei aller indischen Prägung von wachem weltbürgerlichem Geist, der berufsbedingt der deutschen Kultur zuneigte. Wenn sie in ihren sorgfältig gefalteten, leuchtend bunten Saris wie alle bürgerlichen indischen Frauen mit gemessener und gewählter Bewegung einher schritt, war sie eine außerordentlich erfreuliche und trotz ihrer geringen Körpergröße beeindruckende Erscheinung. Während ihre Geschlechtsgenossinnen in der Öffentlichkeit jeglichen Augenkontakt mit der Männerwelt vermieden, fiel sie durch ihren offenen Blick auf. In unseren Breiten wäre sie eine hoch begehrte Frau und angesichts einer guten und gesicherten beruflichen Stellung auch eine gute Partie gewesen. In Indien aber war sie schon wegen ihrer dunklen Hautfarbe nicht der Typ, den sich gutbürgerliche Familien für ihre Söhne wünschten. Davon abgesehen hatte sie, nicht zuletzt bei ihren Besuchen in Deutschland, Vorstellungen über die gesellschaftliche Rolle der Frau übernommen, die es ihr zusätzlich schwer machten, in ihrem Heimatland eine Familie zu gründen. Insbesondere war sie nicht bereit, sich nach indischer Sitte einen Mann mittels einer Mitgift zu kaufen, zumal diese angesichts der Stellung, welche derselbe, um der ihrigen zu entsprechen, gehabt haben müsste, nur unter existenzieller Belastung ihrer Familie aufzubringen gewesen wäre. Sie hatte daher auf eine Eheschließung verzichtet und lebte in friedlicher Eintracht in ihrer Großfamilie. Mit Anfang dreißig war sie nach indischen Vorstellungen für eine Ehe inzwischen auch zu alt, ein Schicksal, das sie mit innerer Festigkeit akzeptiert hatte.
Wenn ich mich nicht im Max Mueller Bhavan physisch und psychisch erholte, hielt ich mich im Büro von Mr. D. auf. Es lag in einer Seitenstrasse unweit des High Courts, einem der größten Gerichtsgebäude der Welt, das die Engländer auf dem Höhepunkt ihrer Macht in Indien im indo-sarazenischen Stil erbaut hatten, vermutlich um die Behauptung zu untermauern, dass bei ihrer Herrschaft alles mit rechten Dingen zugehe. Von der Großartigkeit des Gerichtskomplexes war Mr. D.`s Kanzlei allerdings weit entfernt. Sie befand sich im Obergeschoss eines schmuddeligen, zweistöckigen, Geschäftshauses und war ziemlich verwinkelt. Manche Anwaltszimmer waren nicht mehr als drei oder vier Quadratmeter groß. Aushalten konnte man es eigentlich nur im Büro von Mr. D., das von einer rasselnden Klimaanlage mäßig gekühlt wurde. In den anderen Räumen hielten große Ventilatoren nur die schwül-heiße Luft und die Blätter der Aktenbündel in Bewegung, die überall gestapelt waren. Mittags kamen die Diener der Beschäftigten mit auf einander gesteckten Edelstahlbehältern ins Büro und brachten das Essen, das zu Hause zubereitet worden war. Ein Bürodiener, der eine uniformähnliche Schildmütze aber keine Schuhe trug, erledigte alle Besorgungen außerhalb des Büros und bewachte es. Er wohnte mit seiner Frau und fünf Kindern in dem Hohlraum unter dem Treppenaufgang. Wenn ich erschien, stand er stramm und salutierte. In dieser Zeit las ich den exemplarischen europäischen Großstadtroman der Moderne „Berlin Alexanderplatz“ von Alfred Döblin. Von dessen Stil angeregt verfasste ich einen Text über das Straßenleben in einer indischen Großstadt. Er beschreibt die Szenerie vor dem Büro von Mr. D. - Anhang 1
Mr. D war ein Selfmademan, der aus sehr kleinen Verhältnissen stammte. Er war Christ, dunkelhäutig und sprach Englisch mit einer sehr starken Färbung, womit er in der indischen Gesellschaft an sich schon genügend Handicaps hatte. Dazu hatte er aber auch noch eine Frau aus einer höheren Kaste geheiratet, die es merkwürdigerweise auch bei Christen gibt, und damit einen Tabubruch begangen. Da die Ehe gegen den Willen seiner Schwiegereltern erfolgt war, wurde seine Frau, eine Ärztin, zunächst einmal von ihrer Familie verstoßen, was einem Ausschluss aus der guten Gesellschaft gleich kam. Mr. D kompensierte all dies nach Außen mit einem gravitätischen Habitus, mit dem er um sich eine Aura von hintergründiger Verschlossenheit schuf. Nach Innen richteten er und seine Frau ihre ganze Aufmerksamkeit auf die gemeinsame Tochter, die etwa drei Jahre alt war. Mit unendlicher Geduld ertrugen sie ihre Launen und lasen ihr jeden Wunsch von den Lippen ab. Allen Widrigkeiten zum Trotz war es Mr. D. , nicht zuletzt mit Hilfe der Kirche von Südindien, deren Mitglieder überwiegend den unteren Kasten angehörten, gelungen, eine gewisse Stellung in der indischen Gesellschaft zu erlangen. Dabei war ihm sicher zu Gute gekommen, dass er sehr zielbewusst und für indische Verhältnisse ziemlich rational agierte. Seine Reisen etwa legte er grundsätzlich auf Tage, an denen die Sterne angeblich schlecht standen, weil dann die Züge leer waren.
Dies war für uns Indien während der ersten zwei Monate unseres Aufenthaltes. Bettler und Straßenkinder lebten in einer anderen Welt.