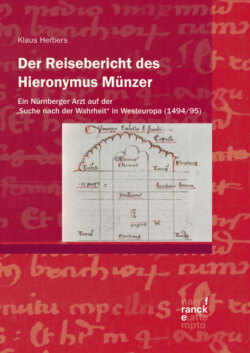Читать книгу Der Reisebericht des Hieronymus Münzer - Klaus Herbers - Страница 9
4. Was ist aufzeichnenswert? Das Itinerarium
ОглавлениеEine Skizze der Kathedrale in Santiago de Compostela steht fast genau in der Mitte des Itinerariums, wie der Bericht sich nennt. Was fand von Münzers Eindrücken Eingang in den Bericht? Konnte Münzer alles angemessen in Worte fassen? Zuweilen greift er – wie in Compostela – zur Zeichnung, obwohl dies nicht sehr oft geschieht. Die Entstehung des Itinerariums ist eine eigene Geschichte, die hier nur kurz resümiert werden kann1.
Ohne Hartmann Schedel wüssten wir von Münzers Reise so gut wie nichts, denn fast alle Informationen entstammen dem Itinerarium, das uns nur in einer Abschrift Hartmann Schedels in der Münchener Handschrift (Clm 431) überliefert ist. Die Entstehung des Berichtes wird dort aber nicht explizit thematisiert, grundsätzlich folgt der Text dem Reiseverlauf. Trotzdem ist die gesamte Handschrift aufschlussreich, denn sie enthält neben dem Itinerarium weiteres Material, das zusätzliche Überlegungen zur Reise und zur Abfassung des Berichtes bereithält. So zeigen die weiteren Teile der Handschrift, dass Hartmann Schedel Materialien Münzers als Beilagen aufgenommen hat, die teilweise eine Grundlage zur Abfassung des Berichtes geboten haben dürften2. Einzelne Schriften wurden aber nicht wie der Liber Sancti Jacobi in den Text integriert, sondern ausgelagert, zum heiligen Mamertus in Vienne, zur Lobesrede des Alfons de Ortiz auf die Katholischen Könige oder zu den Entdeckungsfahrten nach Afrika. Weitere Ergänzungen betreffen die Epigramme des in Portugal von Münzer aufgesuchten Humanisten Cataldus und einige andere kleine Notizen, wie auf Folio 303. Dort wird die Situation in Freiburg im Üchtland beschrieben; dies zeigt, wie ein Notizzettel Münzers ausgesehen haben könnte3. Wer die Verschränkungen und die internen Verweise vornahm, Münzer oder Schedel, bleibt jedoch offen. Da Münzers Itinerarium aber nur über Schedels Abschrift greifbar ist, können Rückschlüsse auf die Eigenheiten im Einzelfall Hartmann Schedel und nicht Hieronymus Münzer selbst betreffen.
Trotzdem suggeriert das Itinerarium, dass Münzers persönliche Reiseeindrücke in die schriftliche Fassung eingingen. Die Struktur variiert: Schon beim schlichten Durchlesen werden unterschiedliche Schwerpunkte erkennbar. Dominieren noch in Frankreich vielfältige Notizen zur Hagiographie, zu den Heiligen, zu Gräbern und ihren Epitaphien, so erscheint der insgesamt sehr lange Teil zur Iberischen Halbinsel deutlich ethnographischer. Die Fremdheit führt auch zu „politischen“ Kommentaren: Judenpolitik, Krieg von Granada, dynastische Entwicklungen oder die sogenannten Entdeckungsfahrten treten in den Vordergrund. Beim Rückweg fällt auf, wie sehr die Universität und die Reliquienschätze das Bild von Paris bestimmten.
Tagesdaten und Distanzen werden in verschiedener Form notiert, Meilenangaben manchmal am Rand wiederholt. Bei längeren Aufenthalten gibt es aber zuweilen Unstimmigkeiten, zuweilen auch Irrtümer (so in Zaragoza). Besonders interessant ist Folio 129, denn an falscher Stelle sind hier Bemerkungen zum nördlichen Navarra in die Handschrift eingebunden. Zuweilen sollte vielleicht noch etwas ergänzt werden, dies zeigen zum Beispiel die halb leeren Folien vor und nach der Rede, die Münzer vor den Katholischen Königen in Madrid hielt. Manche allgemeine Betrachtungen werden bei längeren Aufenthalten eingeschoben, so zum Beispiel zu den „Marranen“, zum Krieg um Granada oder über das Reich Navarra, so als ob man einen passenden Ort im chronologischen Ablauf gesucht hätte. Ob Kirchen oder Institutionen ausführlich oder nur summarisch beschrieben werden, folgt keiner besonderen Systematik und hing vielleicht auch an den Bedingungen und Informationen während der Reise selbst.
Die jeweilige Länge der Schilderungen lässt Unterschiede erkennen: Die Aufenthaltsdauer, die Vermittler und deren Informationsfreude, aber auch das persönliche Interesse und/oder die schon vorher (oder während der Reise) erhaltenen oder im Zuge der Verschriftlichung hinzugekommenen Informationen könnten eine Rolle gespielt haben.
Neue Informationen, besonders hinsichtlich der Größe, der Anordnung und Lage von Städten erschloss Münzer im Vergleich mit Nürnberger oder süddeutschen Verhältnissen. Diente dies nur der Selbstvergewisserung oder betraf das auch Informationen, die zum Beispiel für die Schedelsche Weltchronik relevant waren? Es bleibt auffällig, dass Zeichnungen erst ab seinen Erläuterungen im Reich Granada in nennenswertem Maße erscheinen. Lagepläne, Wappen, Kirchen gehören dazu.
Viel trugen die (deutschen) Personen im Ausland bei, Dolmetscher und Begleiter halfen zudem. Es wird deutlich, wie sich im Laufe der Reise und auch des Berichtes zunehmend ein Netzwerk an Personen etablierte, die mündliche Informationen des Reisenden geradezu legitimierten. Dazu trat klassisches Wissen, das Münzer einstreut, zum Beispiel mit Zitaten aus den Werken des Plinius.
Die Gestaltung des Itinerariums selbst ergibt sich auch aus den vielen Binnenverweisen. Rück- und Vorgriffe, Hinweise auf Früheres und Späteres, also Vor- und Rückverweise kennzeichnen den Bericht und belegen eine grundsätzlich chronologische Anlage der Aufzeichnungen. Die Notizen, die Münzer wahrscheinlich von seiner Reise mitbrachte, mögen dennoch disparat strukturiert gewesen sein.
Natürlich verarbeitete Münzers Itinerarium auch Vorlagen, aber insgesamt eingeschränkt. Neben der resümierenden Abschrift aus dem Liber Sancti Jacobi in Compostela, die darauf hindeutet, dass vielleicht ein anderes und von der heutigen Fassung verschiedenes Exemplar in Compostela vorhanden war, sind es kurze Abschnitte, die übernommen wurden. Inschriften (ein besonderes Interesse Schedels), Epigramme, Reliquienzettel oder Schatzverzeichnisse seien hervorgehoben.
Damit ist die Abfassungsweise des Itinerariums angesprochen. Neben Münzers und Schedels schon vorhandenen Wissensbeständen wurden manche Texte in kondensierter Form aufgenommen, dies gilt zum Beispiel für die hagiographischen Traditionen um Mamertus oder die Auszüge aus dem Liber Sancti Jacobi. In beiden Fällen wurde in humanistischer Manier gekürzt und zugespitzt. Notizen in der Handschrift wie zu den Reliquien und Ablässen in Toulouse entlasteten den Text, es wird im Itinerarium sogar darauf verwiesen. Bücher oder Hefte, die Münzer in Orléans zur Gallia (Anthonius Astensis4) oder in Sevilla (Rede des Alfonso Ortiz an die Katholischen Könige5) gezeigt oder gegeben wurden, boten Material zur Darstellung von Zusammenhängen (wie dem Hundertjährigen Krieg oder dem Krieg gegen Granada), ohne dass diese Materialien zu wörtlichen Vorlagen wurden. Zusätzliche Erläuterungen boten die verschiedenen Schriften des in Portugal getroffenen Humanisten Cataldus oder die eigenständige Schrift zu den portugiesischen Fahrten der Europäischen Expansion.
Diese Hinweise zur Abfassungsweise müssen mit weiteren Informationen verbunden werden, die dem Itinerarium selbst zu entnehmen sind. Ob Inschriften, Epigramme und anderes nur am jeweiligen Ort kopiert wurden, bleibt fraglich, manchmal ist das Itinerarium aber der einzige Überlieferungsträger. Offensichtlich wurden auch die Spuren der Abfassungsweise verwischt, denn dass Münzer den Text des Alfonso Ortiz in Sevilla erhielt, berichtet nicht das Itinerarium, sondern ein späterer Abschnitt der Handschrift6. Neben schriftlichen Vorlagen, Erweiterungen und Hinweisen ist der Beitrag der mündlichen Informanten nicht zu unterschätzen, denn woher kannte Münzer zum Beispiel die Zahlen zu Einwohnern oder zu den Klerikern und Pfründen einer Kirche?
Insgesamt wird deutlich, dass der Reisebericht vielleicht auf Tagebuchnotizen basierte, dann aber in verschiedener Weise „angereichert“ und weiter entwickelt wurde. Wer dies in welchem Maße tat, bleibt wie gesagt offen. Manches deutet darauf hin, dass Münzer vielleicht größere Verantwortung für den spanischen, Schedel für die restlichen Abschnitte besaß. Die Beobachtungen zur Verschriftlichung treffen sich durchaus mit Überlegungen zu den zahlreichen auch neu gefundenen Notizzetteln Hartmann Schedels7 und damit zur Arbeitsweise der Nürnberger Humanisten.
In der Sprache des Itinerariums dominiert ein eher einfaches, umgangssprachliches, zuweilen sogar parataktisches Latein mit grammatischen Eigenheiten. Zahlreiche Floskeln bestimmen den Text, so etwa, dass man etwas – um kurz zu bleiben – nicht weiter ausführen könne. Neologismen (auch aus romanischen Sprachen) finden sich zuweilen, insbesondere ist das Vokabular zu den Südfrüchten bemerkenswert. Dazu treten einzelne deutsche Wörter oder lautmalerische Transkriptionen des muslimischen Gebetsrufes.