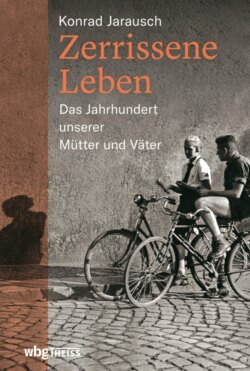Читать книгу Zerrissene Leben - Konrad Jarausch - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Weimarer Kinder
ОглавлениеIn den 1920er-Jahren war die Geburt eines Kindes normalerweise ein freudiges Ereignis, ein Hoch auf das Leben nach dem Gemetzel des Großen Krieges, vor allem wenn es ein Junge war. Die Eltern waren stolz, einen Sohn und Erben bekommen zu haben, auch wenn eine Schwester sich möglicherweise zurückgesetzt fühlte und sich über den kleinen Neuzugang ärgerte. Bürgerliche Familien verschickten gedruckte Geburtsanzeigen, um Freunde und Bekannte über das neue Familienmitglied zu informieren, und engagierten einen Fotografen, der den freudigen Anlass im Bild festhielt. Damit aus dem Kleinen ein rechtmäßiges Mitglied der Gemeinschaft wurde, füllte ein Standesbeamter in akkurater Sütterlinschrift eine Geburtsurkunde mit Angaben über die Eltern, den Geburtsort, das Geburtsdatum und die Religion des Kindes aus. Anschließend fanden sich die Verwandten zu einer förmlichen kirchlichen Taufe ein. Einem loyalen Beamten mochte es gar gelingen, Reichspräsident Paul von Hindenburg zu überreden, als Ehrenpate zu fungieren.1
Solche Geburtsschilderungen stehen am Anfang der meisten autobiografischen Aufzeichnungen, selbst wenn die Hauptperson sich an die näheren Umstände nicht erinnern kann. „An einem sonnigen Frühsommertag des Inflationsjahres 1923, am 18. Juni um 12.15 Uhr mittags, war meine Stunde Null“, konstatiert der Ingenieur Karl Härtel anhand von Geschichten, die in der Familie kursierten. „Ich hatte es relativ leicht, denn vor mir waren immerhin schon meine zahlreichen Geschwister den gleichen Weg gegangen und meine Mutter hatte vor mir bereits 8 Entbindungen nahezu problemlos überstanden.“2 Die ersten „trüben und verschwommenen, ziemlich punktuellen und bruchstückhaften Erinnerungen“ von Gerhard Krapf setzen im Alter von drei Jahren ein. Er erinnert sich, dass er aus einem Fenster auf einen Tanzbären unten im Hof blickte. Die 1929 geborene Christa Wolf staunt in ihrem Roman Kindheitsmuster über das magische Erwachen des Bewusstseins durch die erste, entscheidende Artikulation des Wortes „ICH“.3 Die nachfolgenden Schilderungen zeigen dann die Entfaltung dieser erwachenden Persönlichkeit im Verlauf eines ganzen Lebens.
Angeregt durch das bahnbrechende Werk von Philippe Ariès, sind Historiker der Frage nachgegangen, wie dieses universelle, millionenfach wiederholte Muster sich zeitlich und örtlich ausdifferenziert hat.4 Sie konnten zeigen, dass Kindheit ein kulturelles Konstrukt aus den dieser Lebensphase zugeschriebenen Ideen und Wertvorstellungen ist. Letztere reichen von der Behandlung von Kindern wie kleine Erwachsene bis hin zu ihrer Behütung als schutzlose Minderjährige. Zudem vertreten Demografen die These, dass der Bevölkerungswandel im späten 19. Jahrhundert – von der kinderreichen Familie (aufgrund der hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit) hin zur Kleinfamilie mit wenigen Kindern – auch die emotionalen Einstellungen von Eltern grundlegend veränderte: Aus relativer Indifferenz wurde starke Zuwendung. Zugleich haben Wissenschaftler die fragmentarischen Aufzeichnungen penibel nach Hinweisen auf die Erfahrungen von Kindern bei ihren Bemühungen, Erwachsenen die Kontrolle über ihr Leben zu entreißen, durchforstet.5 Das Ergebnis war ein differenzierteres Verständnis von Kindheit als einer Phase des Ringens um die Entdeckung des eigenen Ich.
Die meisten Erinnerungen an die Kinder- und Jugendjahre in der Weimarer Republik sind überraschend positiv. Der Grundtenor lautet: „Meine Kindheit war sehr glücklich.“ Im Gegensatz zur politischen Lage, die im Zeichen von Dauerkrisen stand, betonen die persönlichen Erinnerungen zumeist, dass es den Eltern gelungen sei, ihren Kindern „ein gutes Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit“ zu vermitteln, das ihnen eine positive Entwicklung ermöglicht habe.6 Die Ideale der Kindererziehung blieben ohne Zweifel umstritten und schwankten zwischen autoritärem Paternalismus und nachgiebigem Liberalismus, während die Familiengröße weiterhin variierte: Ärmere Eltern bekamen wegen fehlender Geburtenkontrolle oft viele Kinder, während bürgerliche Mütter deren Anzahl begrenzten. Allerdings konfrontierte diese widerspruchsvolle Mischung verschiedener Erziehungsideale Kinder mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen, weil sie dafür sorgte, dass diese zugleich gefördert und gefordert wurden, was die Entstehung robuster Persönlichkeiten begünstigte. Nur am Anfang und insbesondere gegen Ende der Weimarer Republik gefährdeten dann wirtschaftliche Schwierigkeiten und politische Vorahnungen sehr stark die Zukunft der Kinder.7
Die „glücklichen, sorgenfreien“ Kindertage wirkten sich nachhaltig auf Lebensverläufe aus – sie erzeugten eine Erwartung von Sicherheit und Normalität, die wiederzuerlangen der Einzelne hernach Mühe hatte. Im Gegensatz zu den Entbehrungen des Ersten Weltkriegs, der Massenarbeitslosigkeit während der Weltwirtschaftskrise sowie dem Leid an der Front und in der Heimat im Zweiten Weltkrieg waren die mittleren Jahre der Weimarer Republik eine Zeit relativer Ruhe. Für viele Arbeiter und Sozialisten war die erste deutsche De mokratie eine Zeit der Hoffnung, als steigender Wohlstand und soziale Re formen ein besseres Leben verhießen.8 Für die Verfechter autoritärer Traditionen und radikale Antisemiten gefährdeten Weimars modernistische Experi mente dagegen eine ganze Weltsicht und Lebensart. Um den Widerspruch zwischen den Erinnerungen an eine „goldene Kindheit“ und den Schilderungen der vielen Probleme Weimars aufzulösen, nehmen wir die Erfahrungen in Elternhaus, Schule und unmittelbarem Umfeld, die das Leben von Kindern bestimmten, genauer in den Blick.9