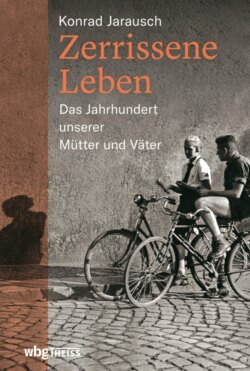Читать книгу Zerrissene Leben - Konrad Jarausch - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LESARTEN
ОглавлениеUm so grundverschiedene Schilderungen zu verstehen, bedarf es einer kollektiven Biografie, die mehr umfasst als eine einzige Person, aber weniger als eine ganze Gesellschaft.5 Eine Möglichkeit der Begrenzung besteht darin, sich auf eine bestimmte Altersgruppe zu konzentrieren, wie etwa die während der 1920er-Jahre Geborenen, deren Leben in besonders starkem Maß von den historischen Ereignissen geprägt wurde.6 Während ihre Eltern den Ersten Weltkrieg durchgestanden hatten und ihre Kindheit in der Weimarer Republik stattfand, traf die NS-Diktatur sie mit voller Wucht: Ihre Jugend fiel in die ersten Jahre des „Dritten Reichs“, wodurch sie gezwungen waren, zur Herrschaft Hitlers Stellung zu beziehen. Im Zweiten Weltkrieg wurde ihr Erwachsenwerden sowohl durch die Gefährdungen von Militär- oder zivilem Dienst als auch durch Verfolgung und Massenmord bedroht. Wer die Zerstörungen des Krieges und die Niederlage überlebte, konnte sein Leben im besten Fall von Neuem beginnen. Das Erwachsenenalter erreichte diese Alterskohorte entweder in der Bundesrepublik Deutschland oder in der Deutschen Demokratischen Republik, nur um am Ende vom Sturz des Kommunismus überrascht zu werden. Statt eine nicht existierende generationelle Einheitlichkeit für sich in Anspruch zu nehmen, ist es die Vielfalt der Verflechtungen zwischen privaten Angelegenheiten und öffentlichen Ereignissen, die diese Kohorte von anderen unterscheidet.
Zur Altersgruppe der zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 und der NS-Machtergreifung 1933 Geborenen gehören zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, die dem 20. Jahrhundert ihren Stempel aufgedrückt haben. In der Politik etwa Bundeskanzler Helmut Schmidt (geboren 1918), sein Nachfolger Helmut Kohl (1930), Bundespräsident Richard von Weizsäcker (1920), Außenminister Hans-Dietrich Genscher (1927), DDR-Spionagechef Markus Wolf (1923), DDR-Ministerpräsident Hans Modrow (1928) und US-Außenminister Henry Kissinger (1923). Schriftsteller wie Heinrich Böll (1917), Günter Grass und Martin Walser (beide 1927) zählen dazu ebenso wie Christa Wolf (1929). Unter den Soziologen sind Niklas Luhmann (1927) und Jürgen Habermas (1929) die wohl bedeutendsten Vertreter. Berühmt sind auch der Fußballer Fritz Walter (1920), der Künstler Joseph Beuys (1921), die Filmschauspielerin Hildegard Knef (1925) und der Dirigent Kurt Masur (1927).7 Da diese Prominenten bereits hinreichend bekannt sind, stehen hier eher die Erlebnisse und Erfahrungen gewöhnlicher Deutscher im Mittelpunkt.
Die rund achtzig ausgewählten Lebensberichte (Kurzvitae der AutorInnen siehe S. 414ff.) decken ein breites Spektrum von Reaktionen auf den Nationalsozialismus ab, das von begeisterter Unterstützung bis zu mutigem Widerstand reicht. Am schwierigsten zu finden waren autobiografische Aufzeichnungen fanatischer Nazis, die Hitler unterstützt hatten. Sie wollten nicht über ihre Mitschuld an den nationalsozialistischen Verbrechen schreiben. Deutlich mitteilsamer ist das gute Dutzend nationalistischer Kollaborateure, die bis 1942 ihre eigenen militärischen Erfolge feierten. Die Mehrzahl der Erinnerungen stammt aber von unpolitischen Leuten, die stolz darauf waren, das „Dritte Reich“ irgendwie überlebt zu haben. Weniger zahlreich sind die Kritiker der NS-Herrschaft. Sie erzählen ausführlich von kleinen Akten der Verweigerung als Beweis dafür, dass sie sich anständig verhalten hatten. Diese Gruppe macht etwa ein Zehntel aus. Nur ein paar autobiografische Berichte stammen von der Minderheit derer, die sich dem „Dritten Reich“ aktiv widersetzten. Da die Stimmen von Juden und anderen NS-Opfern durch den Massenmord größtenteils zum Schweigen gebracht wurden, konnte nur ein Dutzend Berichte von Überlebenden der Konzentrationslager oder Menschen, die sich durch rechtzeitige Emigration retten konnten, in das vorliegende Buch aufgenommen werden. Insofern spiegeln die schriftlichen Zeugnisse eine etwas verkürzte Reihe von Reaktionen wider, die nichtsdestotrotz typisch sind für die Erfahrungen der Mehrheit.8
Die zweite Hälfte des Jahrhunderts verlangte eine Auswahl von anderen Texten, denn die Niederlage des „Dritten Reichs“ zwang die Menschen zur Neuorientierung. Alte Bindungen und Loyalitäten waren auf den Kopf gestellt. Auch machte es einen Unterschied, auf welcher Seite man im Kalten Krieg stand. Entweder man engagierte sich im kapitalistischen Wiederaufbau der Bundesrepublik oder im sozialistischen Experiment der DDR. Die autobiografischen Berichte aus dem Westen belegen in ihrer Mehrzahl, dass der wirtschaftliche Erfolg die Menschen motivierte, die Demokratie zumindest nominell zu akzeptieren, während nur eine kritische Minderheit auf weitere Reformen drängte. Dagegen zeigen die zwei Dutzend ostdeutschen Autobiografien, dass der Antifaschismus der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) anfangs zwar viel Zuspruch fand, die Durchsetzung einer neuen marxistischen Diktatur jedoch eine weitere Gruppe von Opfern schuf und Kritiker zur Flucht zwang. Im Endeffekt stürzten die Ostdeutschen die kommunistische Herrschaft und schlossen sich dem westlichen System mit der Wiedervereinigung an.9 Die gegensätzlichen Geschichten von materiellem Wohlstand und ideologischer Enttäuschung ergänzen die Schilderungen nach dem Krieg um einen anderen Entwicklungsverlauf.
Jenseits der vielfach von einer gesellschaftlichen Elite verfassten Autobiografien will dieses Buch den „ganz normale[n]“ Leuten wieder eine Stimme geben und breite Segmente der deutschen Bevölkerung repräsentieren.10 Es schließt daher Autobiografien von Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten ein: Etwa die Hälfte stammt aus der oberen Mittelschicht, ein Drittel aus dem Kleinbürgertum und ein Zehntel aus der Arbeiterschaft. Weiter wurden Texte aus unterschiedlichen Regionen ausgewählt, um auch die geografische Bandbreite der deutschen Gesellschaft abzubilden: Zwei Dutzend Personen kamen aus dem Westen, achtzehn aus dem Osten und ein Dutzend aus Berlin. Auch unterschiedliche religiöse Sichtweisen sind eingeflossen, da konfessionelle Bindungen eine wichtige Kraft in Mitteleuropa blieben: Die Mehrzahl der Autoren waren Protestanten, eine nicht unerhebliche Minderheit war katholisch und der Rest jüdisch. Nach Möglichkeit wurden Berichte ausgewählt, die eine gesamte Lebensspanne abdecken, um Schilderungen früherer Ereignisse mit der späteren Reflexion über ihre Bedeutung vergleichen zu können. Insgesamt repräsentiert diese gesamtgesellschaftliche Stichprobe im Vergleich zu anderen Studien ein breiteres Spektrum persönlicher und kollektiver Erfahrungen.11
Weil das Leben der meisten Menschen während des 20. Jahrhunderts in geschlechtsspezifisch definierten Bahnen verlief, sind die unterschiedlichen, wenn auch ähnlichen Erfahrungen von Männern und Frauen ebenfalls berücksichtigt. Die Männer, die zwei Drittel der hier ausgewerteten autobiografischen Berichte verfasst haben, neigen dazu, im Ton von Abenteuergeschichten über ihre Berufslaufbahn und ihren Militärdienst an der Front oder über ihre Zeit in der Kriegsgefangenschaft zu schreiben. Sie weichen politischen Fragen keineswegs aus, wenn sie schildern, wie sie mit dem NS-Regime zusammenarbeiteten oder im Gegenteil versuchten, sich seinem Einfluss zu entziehen. Die Frauen wie Ursula Baehrenburg (Abb. 1) hingegen berichten mehr über Familie, Verwandte und Freunde, wobei sie ein dichtes Netz zwischenmenschlicher ,Beziehungen beschreiben. Insbesondere in schweren Zeiten kreisen ihre Geschichten um die Beschaffung von Lebensmitteln, Kleidung und Obdach – also um das grundsätzliche Überleben des eigenen Familienverbunds. Natürlich sind die beiden Erzählstränge in einigen Bereichen, wie etwa der Brautwerbung, Eheschließung und Kinder oder von Abwesenheit und Tod eng miteinander verflochten. Aber oft hat es den Anschein, als lebten Männer und Frauen in verschiedenen Welten, getrennt nicht nur durch Alter oder Beruf, sondern auch durch ihr Geschlecht.12
1 Selbstporträt einer Autorin.
Das Aufspüren der Lebensgeschichten wurde zu einer Entdeckungsreise, die weit über die herkömmliche Quellenrecherche hinausging. Am Anfang stand das Anliegen, Geschichten vor dem Vergessen zu bewahren, die Freunde wie der Komponist Gerhard Krapf, der jüdische Emigrant Tom Angress und der ostdeutsche Historiker Fritz Klein erzählt hatten. Eine Nachfrage der Friseurin Brigitte Stark, ob die Erinnerungen ihrer Mutter für einen Historiker von Interesse wären, trieb die Bemühungen weiter voran; der Text und die Bilder der Mutter erwiesen sich als Fundgrube für Erfahrungen, wie sie breite Schichten der Bevölkerung gemacht hatten. Von dort stieß die Suche weiter vor in ein Reich vergleichbarer grauer Literatur von Autoren wie beispielsweise dem Flusskapitän Hermann Debus, die im Selbstverlag erschienen waren. Das Bemühen, von einzelnen Autoren wie dem Ingenieur Karl Härtel Abdruckgenehmigungen für Zitate und Bilder zu bekommen, fand ein überraschend positives Echo, das zu Telefonaten, E-Mails und bewegenden Interviews mit zwei Protagonisten führte – dem Geschäftsmann Hellmut Raschdorff und dem Pastor Erich Helmer, beide schon Mitte neunzig. Alle diese Befragten waren hocherfreut, einen professionellen Historiker gefunden zu haben, der ihre Geschichten ernst nahm.
Viele handschriftliche Autobiografien befinden sich nach wie vor in Privatbesitz, andere sind öffentlich verfügbar in Magazinen und Archiven. Nachkommen wie Katharina Hochmuth und Ulrich Grothus machten, als sie von meinem Projekt erfuhren, die unveröffentlichten Erinnerungen ihrer Eltern oder Großeltern zugänglich. Das Leo Baeck Institute in New York bemüht sich seit 1955 systematisch, durch die Archivierung von schätzungsweise zweitausend persönlichen Lebensberichten die Kultur der deutschsprachigen Juden zu bewahren.13 In den späten 1970er-Jahren fing der Schriftsteller Walter Kempowski an, solche Berichte als Material für seine Sozialromane zu sammeln, und stellte sogenannte „rote Bände“ zusammen, die auf 3,5 Millionen Blatt unter anderem achttausend deutsche Lebensläufe enthalten und heute im Literaturarchiv der Akademie der Künste in Berlin lagern.14 Gegen Ende der 1990er-Jahre startete Frauke von Troschke ein paralleles Projekt zum Aufbau eines Deutschen Tagebucharchivs in der badischen Kleinstadt Emmendingen. Untergebracht im Alten Rathaus, enthält das Archiv heute mehr als 15.000 Dokumente, etwa zwei Drittel davon Autobiografien.15 Zusammen mit anderen, oft in Kleinverlagen veröffentlichten Berichten bilden diese Texte ein regelrechtes Archiv populärer Erinnerungen, das bislang von akademischen Forschern größtenteils ignoriert worden ist.16