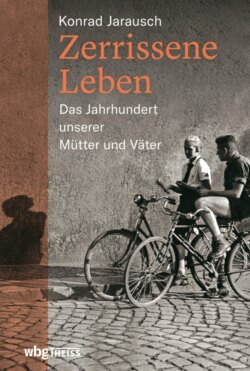Читать книгу Zerrissene Leben - Konrad Jarausch - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DER REIZ DER UMGEBUNG
ОглавлениеWenn sie älter werden, verlassen Kinder allmählich die Sicherheit und Geborgenheit des eigenen Elternhauses und erkunden ihre unmittelbare Umgebung. Weil die Volksschule damals selten in der Nähe lag, mussten selbst jüngere Schüler hinlaufen. Dabei trödelten sie oft herum, guckten in Schaufenster oder musterten neugierig alles, was ihre Aufmerksamkeit erregte. Wenn sie zu spät zum Unterricht erschienen, war der Tadel unausweichlich, damit sie lernten, wie wichtig Pünktlichkeit war. Für Horst Andrée war der Schulweg auf dem Land ein echtes Abenteuer, wenn ein „böser Ganter“ oder eine „Bestie“ von Hund vom Nachbargehöft ihm Angst einjagten. Lag die höhere Schule in der nächsten Stadt, mussten ältere „Fahrschüler“ wie Erich Helmer den Zug nehmen. Immerhin konnten sie so unterwegs schwatzen, Spiele spielen oder Hausaufgaben machen.44 Obwohl der Weg zur Schule bei strömendem Regen oder in tiefem Schnee unangenehm sein konnte, entwickelten diese Schüler, weil sie allein pendelten, mit der Zeit ein Gefühl der Unabhängigkeit.
Am Nachmittag, wenn die Hausaufgaben gemacht oder die Eltern beschäftigt waren, wagten sich die Kinder in die nähere Umgebung, um ihre vielen Geheimnisse für sich zu entdecken. Auf dem Bauernhof gab es Tiere, Arbeitsgeräte und Nutzpflanzen zu inspizieren oder Felder, Wiesen und Wälder zu durchstreifen, sofern einem keine lästige Hausarbeit aufgetragen worden war. In Städten konnten zunächst die angrenzenden Gebäude und irgendwann ganze Viertel ausgekundschaftet werden. So war etwa das historische Gießener Zentrum mit seinen Fachwerkhäusern, welche die Kopfsteinpflasterstraßen säumten, von „geradezu mittelalterlicher Enge“. Heinz Schultheis war unendlich fasziniert von den kleinen Geschäften mit ihren verführerischen Gerüchen und farbenprächtigen Auslagen. Er schlenderte für sein Leben gern über den Markt, bestaunte das mittelalterliche Rathaus und bestieg den Turm des Doms, um den Blick von oben schweifen zu lassen. Diese „kleine Welt der Kindheit“ vermittelte ein Gefühl der Geborgenheit und regte die Fantasie an, wenn technische Wunderwerke, beispielsweise ein Flugzeug oder ein Zeppelin, der Stadt einen Besuch abstatteten.45
In einer Großstadt wie Breslau oder einer Metropole wie Berlin gab es mehr faszinierende Ablenkungen, aber auch echte Gefahren für Kinder, die ihre Unabhängigkeit erprobten. Leierkastenmänner mit ihren Affen postierten sich regelmäßig in den feuchtkalten Höfen von Mietskasernen und dudelten ihre tieftraurigen Melodien, um ein paar Münzen zu ergattern. Freche Bengel spielten Klingelmännchen an den Wohnungstüren. Man konnte durch Parkanlagen stromern, es gab Spielplätze zu erkunden, und am Sonntag konnte man eines der Freiluftkonzerte besuchen. Im Dezember lockten Weihnachtsmärkte mit Lebkuchen und Glühwein. An Silvester gab es vielleicht ein Feuerwerk. Und weil Kunstmuseen und technische Ausstellungen Ermäßigungen für Kinder boten, konnte man immer irgendwohin gehen. Allerdings warnten besorgte Mütter ihre Töchter, „nicht zur Tür [zu gehen] wenn es klingelte oder klopfte“, da es sich bei den Bettlern um Kriminelle handeln könne.46
7 Ferien an der Ostsee.
Zum Heranwachsen gehörte es auch, andere Erwachsene zu treffen, die der kindlichen Entwicklung förderlich sein konnten, soweit sie echtes Verständnis für Kinder zeigten. Manche dieser Begegnungen waren angenehm, wie etwa „eine große Freundschaft mit der Nachbarsfamilie“, weil so an langen Winterabenden mit Bratäpfeln und Kartenspielen für Geselligkeit gesorgt war. Andere waren beängstigender, etwa wenn für Mutter in einem Lebensmittelgeschäft ein fehlendes Gewürz besorgt werden sollte, was bedeutete, dass man seine Schüchternheit überwinden und mit Geld umgehen musste. Für Gerhard Krapf konnten sich selbst die gefürchteten Musikstunden ins Gegenteil verkehren: Ein freundlicher Lehrer schaffte es „ausgezeichnet, [ihm] das Musizieren nahezubringen“. Erich Helmer beeindruckten bei einem Nachbarn, einem geschickten Schuster, „die Achtung und der Respekt vor dem Handwerk, die Achtung vor dem ‚kleinen Mann‘“.47 Während autoritäre Erwachsene Furcht in Kinderherzen einflößen konnten, führten positivere Kontakte zu tiefen Freundschaften, die Vertrauen in die äußere Welt schufen.
Durch Vergleiche ihrer eigenen Situation mit der ihrer Freunde wurden sich die Kinder allmählich der Gesellschaftsschicht bewusst, die ihre Familie von den anderen unterschied. Vor allem in ärmeren Kreisen war das Leben ein täglicher Kampf, damit der magere Lohn bis zum Monatsende reichte, um die Ausgaben für das Lebensnotwendige zu decken. Sobald ein Kind sich nach einem Extravergnügen sehnte, lautete die erste Frage: „Hast Du denn Geld?“ Selbst in mittelständischen Familien waren eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten ein ständiger Zankapfel, wenn etwa ein Ehemann seinen Lohn vertrank oder eine Ehefrau vor einem Urlaub „auf eine Einkaufstour“ ging und eine „ganze Ansammlung von Sommerkleidern“ erstand. Einem Sohn aus großbürgerlichem Haus wie Tom Angress wurden die sozialen Unterschiede bewusst, als er einen Mitschüler zu sich nach Hause einladen wollte, der nicht im Telefonbuch stand; die Eltern des Jungen „waren arm und konnten sich kein Telefon leisten“.48 Obwohl er willens war, Klassenschranken zu ignorieren, machte ihm die Peinlichkeit der anschließenden Geburtstagsfeier klar, dass solche Barrieren nur allzu real waren.
Heranwachsende Kinder knüpften auch Kontakte zu ihresgleichen, wobei sich die Aufmerksamkeit allmählich von den Geschwistern weg auf die eigene Altersgruppe verlagerte. Häufig angeregt durch Bekanntschaften in der Schule, reichten solche Begegnungen von spontanen Spielen auf der Straße bis zu engen Freundschaften. Mädchen unterhielten sich über Kleidung oder kicherten über Witze, während sie ihre Gefühle in Poesiealben ausdrückten, in die sie Verse schrieben, um sich gegenseitig ihrer unsterblichen Freundschaft zu versichern. Jungen, die eher zum Herumtoben neigten, heckten zusammen Streiche aus oder hatten gemeinsame technische Interessen. Wer von Freunden zu Feiern nach Hause eingeladen wurde, dem öffnete sich womöglich die Tür zu den Lebensstilen unterschiedlicher sozialer Schichten. Noch mehr weitete sich der Horizont von Kindern, wenn sie während der Ferien in die Berge oder an die Küste mitgenommen wurden, wie es das Urlaubsfoto von Gisela Grothus belegt (Abb. 7). Eine solche „fast symbiotische Freundschaft“ bot Jungen und Mädchen Ablenkung von den Schularbeiten und Rückhalt, wenn sie von Schulhofrüpeln drangsaliert wurden.49
Was Weimarer Kinder besonders beeindruckte, waren technische Neuerungen wie Eisenbahnzüge, Rundfunkgeräte und Kinos – das war die Zukunft. Als der junge Erich Helmer in Begleitung seines Vaters mit der Straßenbahn quer durch Braunschweig zum Bahnhof fuhr, staunte er: „Von weitem sah ich die Lokomotive mit viel Dampf herankommen.“ Sie kam ihm vor wie ein unaufhaltsames Ungetüm. Benno Schöffski war begeistert von der Anschaffung eines Radios, für das eine Antenne gespannt und der „kleine Detektorapparat“ zusammengebaut werden musste. „Und wir konnten dann an einem Nachmittag aus Kopfhörern die erste Musik hören.“ Karl Härtel freute sich, dass er „vermutlich zur Belohnung“ für gute Noten „am Nachmittag eines verregneten Sommertages mit meiner Mutter zum ersten Mal in ein Kino gehen“ durfte, um sich den Weißen Traum anzusehen, einen Film übers Skilaufen.50 Solche Erlebnisse hinterließen einen bleibenden Eindruck in den Köpfen von Heranwachsenden, suggerierten sie doch, dass die Möglichkeiten der Technik zur Verbesserung der Lebensbedingungen grenzenlos waren.
Im Leben älterer Kinder spielte der Sport eine zunehmend wichtige Rolle, förderte er doch sowohl den Stolz des Einzelnen als auch den Zusammenhalt der Gruppe. Pädagogen unterstützten Mannschaftssportarten, um die körperliche Entwicklung und faires sportliches Verhalten zu fördern. Für manche Kinder hingegen war die Leibeserziehung in der Schule eine echte Qual; nur wenige waren wie Tom Angress in der Lage, schwierige Turnübungen zu meistern. Beliebter war der Schwimmunterricht, bedeutete er doch Sommervergnügen in Schwimmbecken oder Flüssen oder am Meer, auch wenn nicht jeder gleich Vereinsmeister wurde wie Paul Frenzel. Von Oberschichtkindern wurde erwartet, dass sie ritten, Tennis spielten oder segelten, obwohl manche, wie Horst Grothus, „das Reiten gar nicht schön“ fanden.51 Jungen aus der Unterschicht spielten auf improvisierten Plätzen, Wiesen oder auf der Straße Fußball, ohne einem Verein beizutreten. Die meisten Familien nahmen ihren Nachwuchs an Wochenenden mit zum Wandern ins Umland oder während der Ferien mit in die Berge, weil solche Ausflüge, wenn überhaupt, nur wenig kosteten.
Für ältere Kinder war die Mitgliedschaft in einer Jugendgruppe eine Möglichkeit, ihre Freizeit zu strukturieren und sich mit Gleichaltrigen zu treffen. Im Kaiserreich hatten konservative Kreise, die sich um die Radikalisierung von Arbeiterjugendlichen sorgten, Organisationen zur Stärkung einer patriotischen Haltung geschaffen. Während der Weimarer Republik traten manche Mädchen aus der Mittelschicht wie Eva Peters dem „deutschnationalen“ Bund Königin Luise (Luisenbund) bei, während ihre Brüder Mitglied der militaristisch-nationalistischen „Scharnhorstjugend“ wurden. Gerhard Krapf und andere gläubige Jugendliche entschieden sich stattdessen für den Christlichen Verein Junger Männer (CVJM). Heinz Schultheis interessierte sich für den aus Großbritannien importierten katholischen Zweig der Pfadfinder, die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg. Die entscheidende Schwäche all dieser religiösen und politischen Organisationen war, dass sie „keine ‚echten‘ Jugendgruppen“ waren, weil „sie nicht von jungen Anführern geführt“, sondern von Erwachsenen kontrolliert wurden.52
Im Gegensatz dazu rühmte sich die Jugendbewegung, autonome Freiräume zu schaffen, in denen „Jugend durch Jugend geführt“ wurde. Gegründet um die Wende zum 20. Jahrhundert von fortschrittlichen Lehrern in Berlin, war diese Jugendbewegung, deren Protagonisten Rauchen und Alkohol als dekadente Auswüchse wilhelminischer Lebensart strikt ablehnten, ein diffuser Ausdruck der Auflehnung gegen die Welt der Erwachsenen. Während der 1920er-Jahre hieß diese Selbstorganisation „Die Freischar“ und umfasste ein lockeres Sammelsurium von Jugendverbänden der „Bündischen Jugend“. Angelockt von den wöchentlichen Treffen und vor allem von den Wochenendausflügen, schloss sich Paul Frenzel der Gruppe an, weil sie ein selbstbestimmtes Leben versprach. Die Kluft der Freischar bestand aus einem „blaugraue[n] Hemd mit einem schwarzen Halstuch und grauen kurzen Hosen“. Die Organisation war attraktiv, weil ihre Mitglieder an Kameradschaft glaubten und mit dem Anspruch einer selbstgewählten Elite auftraten. Mit Naturwanderungen, Volksliedern und Lagerfeuergeselligkeit verkörperte die Jugendbewegung eine romantische Sehnsucht nach Abenteuer. Viele Jugendliche, wie etwa Will Seelmann-Eggebert, wurden von ihr „entscheidend geprägt“.53
Die glücklichen Kindheitsjahre gingen mit der Weltwirtschaftskrise vom Oktober 1929, welche die Existenz vieler Familien bedrohte, allmählich zu Ende. Der New Yorker Börsenkrach erreichte mit einiger Verspätung auch Mitteleuropa, als kurzfristige US-Anleihen gekündigt wurden. So mancher Betrieb wurde dadurch finanziell ruiniert, wie etwa die Installationsfirma Mahlendorf und Söhne. Die Kinder bekamen die Auswirkungen zu spüren, wenn das schrumpfende Familienbudget zu Streitigkeiten zwischen den Eltern führte. Gehörte ein Vater zu den sechs Millionen Arbeitslosen, dann wurde auch das Essen knapp, denn „noch immer waren die Verhältnisse schlecht; feste Arbeit war nicht zu bekommen“. Zum Ausgleich mochte eine Mutter sich Arbeit in einem Bekleidungsgeschäft suchen oder sich außer Haus als Putzfrau oder Wäscherin verdingen. Als die gewaltigen Arbeitslosenzahlen das System der Arbeitslosenversicherung überforderten, waren erwerbslose Männer gezwungen, betteln zu gehen oder auf „Krisenfürsorge und Wohlfahrtsunterstützung“ zurückzugreifen. Die Folgen für die Arbeitslosen waren „Hunger und Kälte, wachsende Verelendung und hoffnungslose, dumpfe Verzweiflung“.54
Die „schlechte wirtschaftliche Lage und die Verzweiflung der Menschen“ radikalisierten die Politik, verstärkten feindselige Affekte und entfesselten körperliche Gewalt. Infolge der „Atmosphäre verbitterter Leidenschaft“ bemerkten manche Kinder vermehrt hitzige Diskussionen in ihren Familien zwischen Anhängern des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, des Nazi-Führers Adolf Hitler und des überzeugten Kommunisten Ernst „Teddy“ Thälmann. Andere schnappten im Radio oder auf der Straße „martialische Redefetzen“ auf, „rhythmische Sprechchöre und Gesänge, Getrappel vieler rennender Füße, allgemeines Geschrei und manchmal auch das ‚Tatüütataa‘ der Polizei“. Während der vielen „Aufmärsche und Fackelzüge“ von SA und Kommunisten wurden die Kinder „aufgefordert, bei den Nationalsozialisten ‚Heil Hitler‘ zu rufen und bei den Kommunisten ‚Heil Moskau‘“. Darüber hinaus gerieten linksgerichtete Wehrverbände wie das Reichsbanner und der Rote Frontkämpferbund mit paramilitärischen Gruppen der Rechten wie dem Stahlhelm und der SA in blutigen Saal- und Straßenschlachten aneinander. Obwohl sie kaum begriffen, worum es bei den Auseinandersetzungen ging, waren viele der Weimarer Kinder beeindruckt von den Liedern und Aktionen der nationalsozialistischen SA und SS, weil sie „die zunehmend lautesten und in ihren Gesängen und Taten wohl auch martialischsten“ waren.55
Diese Polarisierung entfachte auch eine hässliche Welle des Antisemitismus, deren Wortführer die Juden für das allgemeine Elend der Nation verantwortlich machten. Während des 19. Jahrhunderts hatten rechte Agitatoren religiöse Vorurteile in eine quasi wissenschaftliche Form des Rassismus gegossen, vor dem es kein Entkommen durch Konversion gab. Selbst in assimilierten jüdischen Haushalten wie dem der Eycks wurden Kinder gewahr, dass sie irgendwie „anders“ waren als andere, ohne recht zu wissen, wieso. Als Tom Angress in Berlin die Schule wechselte, musste er als Religionszugehörigkeit „mosaisches“ Bekenntnis eintragen, was ihn als Angehörigen einer Minderheit kenntlich machte. „Für mich war das der Beginn von vier Jahren der allmählichen Isolierung, gelegentlicher Feindseligkeiten und beinahe täglicher kleiner (und manchmal nicht so kleiner) Demütigungen.“56 Diese radikalen Rassisten suchten ein Jahrhundert jüdischer Integration in die säkulare deutsche Kultur ungeschehen zu machen.
Die chaotischen letzten Jahre der Weimarer Republik politisierten Kinder, die in den frühen 1920er-Jahren geboren worden waren, indem sie sie zwangen, ideologisch Stellung zu beziehen. Katholische und sozialdemokratische Jugendliche konnten sich an ihre früheren Überzeugungen klammern, aber Söhne und Töchter liberaler Familien wie Fritz Klein waren aufgrund des Zerfalls der bürgerlichen demokratischen Parteien plötzlich politisch heimatlos. Protestantische Nationalisten wie Gerhard Krapf konnten sich hinter der imposanten Figur von Präsident Hindenburg als Garant von Ordnung und Wohlanständigkeit sammeln. Aber wenn ein Vater ein arbeitsloser Arbeiter war wie Hans Schirmer, den „Verzweiflung und Wut“ zum kommunistischen Aktivisten gemacht hatten, verstand sein Sohn möglicherweise nicht die Gründe für solchen Radikalismus. Noch überraschter war Ruth Bulwin, denn „eines Tages … hatte mein Vater eine braune Uniform an, und es hieß, er sei jetzt Parteigenosse, worunter ich mir noch nicht viel vorstellen konnte“.57 Der Zusammenbruch der Republik verwickelte Kinder in politische Kämpfe, bevor sie so weit waren, damit zurechtzukommen.