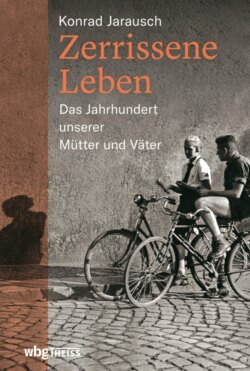Читать книгу Zerrissene Leben - Konrad Jarausch - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRIVATE FREIRÄUME
ОглавлениеTrotzdem schafften es viele Jugendliche, sich „in diesen Jahren ein Privatleben“ zu bewahren, sofern sie nicht rassische oder ideologische Opfer des NS-Regimes wurden. Unterhalb des allgegenwärtigen Nazifizierungsdrucks und des vorgeschriebenen HJ-Aktivismus „blieb alles wie gewohnt“, und man konnte „das familiäre Leben immer noch im gewohnten Rahmen weiterführen“. Die Jugendlichen frönten ihrem Freizeitvergnügen, machten ihren Schulabschluss, ergriffen einen Beruf oder erlebten die erste Liebe. Gerhard Krapf beispielsweise nahm kleinere Tätigkeiten an und sparte auf diese Weise genug Geld, um sich sein eigenes Stricker-Fahrrad zu kaufen, das ihm ermöglichte, seinen Aktionsradius zu erweitern und Stadtviertel zu erkunden, die weiter weg von zu Hause lagen. Horst Andrée „glaubte, das Jagen in Vaters Revier sei wichtiger“ als die Schule und war stolz auf seinen „ersten erlegten Bock“. Horst Grothus „paddel[te] über den ganzen langen [Baldeney-]See“ im Kajak seines Bruders und lernte den Sommer über, wie man mit einer kleinen Jolle segelte.47 Das Ausweichen in unpolitische Freizeitbeschäftigungen erleichterte es den Jugendlichen, die ideologischen Anforderungen der NS-Diktatur zu ertragen.
Auch im „Dritten Reich“ bezeichnete das religiöse Ritual der Konfirmation oder der Bar Mitzwa das Ende der Kindheit und den Beginn der Jugendzeit als neuer Lebensphase. In allen Konfessionen folgte dieser Übergangsritus einem Ablauf religiöser Unterweisungen, deren Höhepunkt die Aufnahme in die Gemeinde der Gläubigen darstellte. Ruth Bulwins Konfirmationsfoto zeigt ein hoch aufgeschossenes Mädchen „in einem von Mutter umgearbeiteten langen schwarzen Kleid mit kleiner weißer Spitzenkrause um den Hals, weißen Handschuhen und einem Maiglöckchenstrauß“. Jungen wie Gerhard Krapf trugen in der Regel „funkelnagelneue blaue Anzüge mit langer Hose und Krawatte“ und „hatten ein neues, ledergebundenes Gesangbuch dabei“. In katholischen Elternhäusern folgte die Feier einem ähnlichen Muster. Albert Gompertz erinnert sich im Zusammenhang mit seiner Bar Mizwa 1934 an einen Gottesdienst in seiner Synagoge und eine private Zusammenkunft im Familien- und Freundeskreis samt Geschenken.48 Für die meisten Heranwachsenden bedeutete diese Zeremonie auch das Ende ihrer Volksschulzeit und den Eintritt in eine Lehre.
Jene Jugendlichen, die eine weiterführende Schule besuchten, waren von ständigen Versagensängsten geplagt. Wer im dreigliedrigen deutschen Schulsystem versagte, dem war der Zugang zu beruflichen Karrieren verbaut. Für einen erfolgreichen Schüler wie Gerhard Krapf war der Fächerkanon, der ihm aufgenötigt wurde, „mit das Beste, was mir passieren konnte“, weil er eine feste Basis in den Klassikern legte und ihn über einige couragierte Lehrer mit „Anti-Nazi-Denken“ in Berührung brachte. Im Gegensatz dazu musste Gerhard Baucke, als er sich nicht genug anstrengte, auf eine Privatschule wechseln, wo er sich sehr viel besser machte. Horst Andrée fiel in allen Fächern durch, weil die Schule ihn enttäuschte und er sich langweilte: „Die Schule war mir ein Brechmittel und selbst die Jagd machte keinen rechten Spaß mehr.“ Doch als man ihn auf ein freundliches, wenngleich strenges Internat an der Ostseeküste schickte, half ihm das einmal mehr, sich zu fangen. Karl Härtel verzichtete auf den Besuch einer weiterführenden Schule und beschloss, auf der Volksschule zu bleiben, um danach eine Lehre anzutreten.49
Die Mittlere Reife am Ende der Realschule war das Bildungsziel für viele Schüler, die nicht in der Lage oder nicht entschlossen genug waren, um weiterzumachen. Im deutschen „Berechtigungswesen“ war die Real- oder Mittelschule zwischen Volksschule und Gymnasium angesiedelt, und sie ermöglichte immerhin noch den Zugang zu Angestelltenberufen. Weniger ehrgeizige oder wohlhabende Familien mit praktischen Zielen schickten ihren Nachwuchs oft auf diese Schulen, deren Absolventen lediglich das Abschlusszeugnis der neunten Klasse erhielten. Gisela Grothus erinnert sich: „Irgendetwas in der neuen Schule hatte mich gestört […]. So beschloss ich 1936, die Gertraudenschule mit der Mittleren Reife zu verlassen.“ Sie wechselte auf eine weniger anspruchsvolle Mädchenoberschule. Weil er wegen der antisemitischen Diskriminierung „keinen Sinn darin sah weiterzumachen“, beschloss auch Tom Angress, mit diesem Zwischenzeugnis von der höheren Schule abzugehen und eine praktische Ausbildung zu beginnen, um sich auf die Auswanderung vorzubereiten.50
Für begabtere und ehrgeizigere Schüler war das Ziel das begehrte Abitur. Das Zeugnis der Reife öffnete die Tür zu den akademischen Berufen und höheren Berufslaufbahnen. Mit dem preußischen Abiturreglement von 1788 erstmals in einem deutschen Staat eingeführt, erfüllte diese Abschlussprüfung die Herzen der Jugendlichen mit Angst, weil ein Scheitern stets eine reale Möglichkeit war. Robert Neumaier erinnert sich: „Meine Ablehnung habe ich später oft bereut. Mit viel Kraft und Ausdauer mußte ich nachholen, was ich in der Jugend versäumt hatte.“ Heinz Schultheis war erfolgreicher: Sein Interesse für „technische Erfindungen“, wie etwa Flugzeuge, Grammophone und Rundfunkgeräte, motivierte ihn zu studieren. Am Ende „ging alles dann ganz gut“, er bestand die Prüfung, „und wir haben das Ereignis auch sehr würdig und fröhlich gefeiert“. Er hatte Glück, denn sein „Abitur war das letzte Friedensabitur vor dem Zweiten Weltkrieg“. Spätere Kandidaten wie Fritz Klein legten ein Notabitur ab, eine erleichterte Reifeprüfung, und wurden dann sofort an die Front geschickt.51
Nach der Schulzeit standen die Jugendlichen vor der schwierigen Aufgabe, einen Beruf zu finden, der ihren Vorlieben entsprach und in dem ein Ausbildungsplatz verfügbar war. Obwohl die wirtschaftliche Lage sich besserte, war es ein harter Kampf, sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Weil seine Schwester als Sekretärin bei einem Hersteller für Vakuumpumpen arbeitete, konnte Robert Neumaier eine Lehre als Metallarbeiter anfangen. Fest entschlossen, seinen Sohn auf die Auswanderung aus Deutschland vorzubereiten, gelangte Albert Gompertz’ Vater zu der Überzeugung, „dass es das Beste wäre, mich als Lehrling in der Textilindustrie anzumelden“, und zwar in einem jüdischen Unternehmen, wo der Sohn das Geschäft von der Pike auf lernen konnte. Karl Härtel erfuhr über die Arbeit seines Vaters im örtlichen Elektrizitätswerk von einer freien Stelle, schaffte 1937 die Aufnahmeprüfung und begann eine Ausbildung in dem neuen Beruf des „Elektrowerkers“. „Es war einer der glücklichsten Augenblicke in meinem noch nicht einmal 14-jährigen Leben.“52
Weil sie eine geringere formale Ausbildung hatten, strömten junge Frauen in Angestelltenberufe in Geschäften, Kaufhäusern und Büros, wo sie mit Menschen zu tun hatten statt Handarbeit verrichten zu müssen. Anneliese Huber begann im Juni 1935 eine „kaufmännische Lehre im Büro des größten Damenmodehauses von Pforzheim“, dessen Eigentümer, ein „jüdische[r] Kaufmann“, ein „strenger aber korrekter Chef“ war. Dort lernte sie unter den wachsamen Augen ihrer Vorgesetzten Buchführung und Stenografieren. Ruth Weigelt, die im Restaurant der Familie gebraucht wurde, durfte sich lediglich Kenntnisse in Hauswirtschaft aneignen. Ruth Bulwin musste, weil sie nur die Volksschule besucht hatte, 1938 eine einjährige „Privathandelsschule“ besuchen, wo sie „neben Steno und Schreibmaschine … Deutsch, Englisch, Mathematik und Buchführung, sowie Kaufmännisches Rechnen, Wechsel- und Scheckkunde, Handelsbetriebslehre und -korrespondenz“ lernte: „Wider Erwarten machte mir auch das Lernen Spaß.“ Gisela Grothus hatte zwar die höhere Schule abgeschlossen, erinnert sich aber, „dass ich mir das Studium der Medizin nicht zutraute“. Sie begnügte sich daher mit einer Ausbildung als Medizinisch-technische Assistentin (MTA).53 Die jungen Frauen fanden Gefallen an den ersten Schritten in die Berufswelt, die ihnen zu mehr Unabhängigkeit verhalfen und einem Taschengeld, über das sie selbst verfügen konnten.
In den 1930er-Jahren eine Lehre zu beenden, war nicht leicht: Die Ausbildung dauerte drei Jahre und war durch einen Ausbildungsvertrag streng reglementiert. Viele mussten, je nachdem, wo ihre Arbeitsstelle lag, bei einer anderen Familie oder in einem Lehrlingsheim wohnen. Am Arbeitsplatz mussten sie nach Lust und Laune ihrer Vorgesetzten alle möglichen untergeordneten Tätigkeiten verrichten, im Handwerk mit den einfachsten Routinearbeiten anfangen. Robert Neumaier musste unterschiedliche Metallwerkstücke feilen, um sich mit ihren Eigenschaften vertraut zu machen, während Paul Frenzel „Rohkaffee verlesen, an der Siebmaschine stehen, mit großen Röstmaschinen Kaffee rösten und anschließend die verschiedenen Brände zu Kaffeemischungen zusammenstellen“ musste.54 Einmal die Woche mussten die Lehrlinge eine berufsbildende Schule besuchen. Die Arbeitswoche dauerte 48 Stunden, und die Löhne waren dürftig. Wenn Auszubildende nachlässig waren, den Chef beleidigten oder in Konflikt mit der NS-Politik gerieten, wurden sie fristlos entlassen.
Das formale Ende der Lehre bestand aus einer Prüfung, die den Kandidaten zum Gesellen oder Kaufmannsgehilfen beförderte. Um sich auf diese Prüfung vorzubereiten, belegten strebsame Jugendliche wie Anneliese Huber Abendkurse an Gewerbeakademien, um das praktische Wissen theoretisch anzureichern. Motivierte Lehrlinge wie Robert Neumaier konnten sogar versuchen, die Abschlussprüfung ein halbes Jahr vorzuziehen, wenn sie ausreichende Kenntnisse erworben, ihre Berufsschulausbildung beendet und die „Bescheinigung … erhalten [hatten], dass ich ein guter Nationalsozialist sei“. Besonders geschickte Lehrlinge wie Karl Härtel konnten mit der Bewältigung schwieriger Aufgaben der Metallbearbeitung oder mit Elektroarbeiten stolze Sieger des von der Deutschen Arbeitsfront (DAF) jeweils im Frühjahr durchgeführten Reichsberufswettkampfes werden. Paul Frenzel erinnert sich: „Die Jahre meiner Lehrzeit in Leipzig verliefen [im Gegensatz zur späteren Kriegszeit] insgesamt gesehen durchaus glücklich. Um Politik kümmerte ich mich so gut wie nicht.“55
Wer die Prüfung bestanden hatte, dem öffnete sich die Tür zu einer Laufbahn in einem Arbeiter- oder Angestelltenberuf. Manche Jugendliche, wie Karl Härtel, konnten im selben Unternehmen bleiben, zumindest für eine Weile. Anneliese Huber musste sich, wie viele andere, eine neue Arbeit suchen, für die sie nachweisen musste, dass sie arischer Abstammung war. Ihre Stelle bei der gesetzlichen Krankenkasse „war interessant und vielseitig“. Mit der ersten Arbeitsstelle wurde aus dem Lehrling ein „Facharbeiter“, ein regulärer Mitarbeiter. Wichtiger jedoch war die Lohnerhöhung von zehn auf fünfzig Pfennig in der Stunde. Das gestiegene Taschengeld ermöglichte vielleicht Kino- und Konzertbesuche oder Wochenendausflüge. Aber der Traum von einem unbeschwerten Leben stieß schon bald auf ein Hindernis – die von den Nationalsozialisten verlangten Pflichten, etwa den „Reichsarbeitsdienst“ für Männer und das „Landjahr“ für Frauen.56
Der Beginn der Pubertät erschwerte den Start ins Berufsleben. Viele Jugendliche gehen in dieser Lebensphase auf Distanz zu ihrer Familie und begehren gegen jegliche Autorität auf. Heinz Schultheis zufolge verlief die Errichtung der NS-Diktatur „parallel zu den Veränderungen, welche die Natur unabhängig vom politischen System den Heranwachsenden zumutet und dieser Umstand machte uns 14-, 15- und 16-Jährigen das Dasein in Elternhaus, Schule und HJ nicht unbedingt leichter“. Anneliese Huber bemerkte im „Sturm und Drang“ des Erwachsenwerdens erstmals die Ehekrise ihrer Eltern, die unerträgliche Szenen zur Folge hatte: „Es war die schlimmste Zeit meines Lebens.“ Hellmut Raschdorff provozierte während der stupiden Arbeit in einer Munitionsfabrik einen Streit mit einem Vorgesetzten. Als er gemaßregelt wurde, weil er eine außerplanmäßige Mittagspause eingelegt hatte, gab er – erbost über diese „Unverschämtheit“ – dem Chef eine patzige Antwort. Während Anneliese lediglich zu Hause ausziehen musste, wurde Hellmut gezwungen, sich „freiwillig“ zum Militär zu melden.57
Die Jugendjahre Mitte der 1930er waren auch die Zeit, als sich bei den älteren Angehörigen der Weimarer Geburtsjahrgänge ein erstes Interesse für das andere Geschlecht regte. Das war meist harmlos, so etwa wenn Frank Eyck der Schwester seines Freundes, Rosemarie Schmidt, half, im Berliner Grunewald ein Fahrrad bergauf zu schieben. (Sie sollte nach dem Krieg seine Braut werden.) Robert Neumaier war ganz aufgeregt, als ein neues Mädchen namens Johanna in seine achte Klasse kam. Sie war „groß, schlank, hatte blaue Augen, lange blonde Zöpfe – der Typ einer Germanin“. Sie war unnahbar, und „uns Buben schenkte sie keine Beachtung“. Aber sie wusste immer die Antworten, ohne streberhaft zu sein. „Ich begann für Johanna zu schwärmen. Es war das erste Mal, dass mich ein Mädchen interessierte. Sie war meine erste große Liebe und sollte es auch bleiben, aber davon ahnte ich noch nichts.“58
Ernsthaftere Liebesbeziehungen erlebten Jugendliche, die schon etwas älter und so weit waren, dass sie auf eigenen Füßen stehen konnten. Im Fall bürgerlicher Familien fand der erste Kontakt zwischen den in der Schule getrennten Geschlechtern in der Tanzstunde statt. Gisela Grothus’ Foto aus der Tanzschule (Abb. 10) zeigt Mädchen in Kleidern, manche noch mit Zöpfen, die vor einer Gruppe von Jungen in dunklen Anzügen und mit Krawatten stehen, die unsicher lächeln. Paul Frenzel forderte im Leipziger Palmengarten eine junge Frau zum Tanz auf. „Sie gefiel mir so gut, dass ich sie den ganzen Abend wieder holte.“ Um Mitternacht brachte er sie zum Zug. So „lernte [ich] an diesem (Tag) meine jetzige Frau kennen“, auch wenn es noch den Widerstand seines Vaters gegen eine Braut aus der Arbeiterschaft zu überwinden galt. Aus Ruth Weigelts Kinderfreundschaft mit Gerhard wurde im Lauf der Zeit eine ernsthaftere Bindung. Ruth Bulwin lernte ihren späteren Mann auf einem HJ-Gepäckmarsch kennen, als er ihr Foto sah und beschloss, einen Rivalen auszustechen. „Ja, so war das; Rolf war ein Draufgänger, alle aus meiner Mädelschaft schwärmten für ihn.“59
Im „Dritten Reich“ waren Jugendliche stets in Gruppen organisiert, das Ideal der Kameradschaft wurde hochgehalten. Der „Dienst in der Hitlerjugend bot kaum Gelegenheit zu Kontakten mit dem anderen Geschlecht“, erinnert sich Eva Peters. Hans Schirmer weiß noch, wie ahnungslos er im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht war: „Aber keiner hatte einen ‚Schimmer von Ahnung‘, was man zu tun, wie man sich zu verhalten hatte.“ Anneliese Huber entsinnt sich, dass ihre Mutter ihrem ersten Verehrer kurzerhand eine knallte. Als ein junger Offizier später mit einem Blumenstrauß in der Hand bat, sie besuchen zu dürfen, beschieden ihre Eltern ihm, er solle in einem Jahr wiederkommen und in der Zwischenzeit Briefe schreiben. „Leider ist er dann später in den ersten Kriegsmonaten gefallen. Ich war sehr traurig darüber, wenngleich es noch nicht ‚die große Liebe‘ war.“60 Eines der „Opfer“ des NS-Regimes war die sexuelle Intimität, da die Hektik der HJ nur wenig Gelegenheit zur Vertiefung der Kontakte zwischen den Geschlechtern bot.
10 Tanzstunde.
Die relative Normalität jugendlichen Lebens festigte das „Dritte Reich“ sogar, weil das Regime trotz seines propagandistischen Drucks eine Reihe von Reaktionen zuließ. Schilderungen echter Begeisterung für die Nationalsozialisten finden sich selten, vor allem bei den Männern. Eva Peters gibt zu, dass sie im Herbst 1936 hingerissen war von ihrer neuen BDM-Führerin, Frieda. Die Neue „war ein schönes Mädchen, 18 Jahre alt, mit leuchtenden blauen Augen“. Als sie verlangte, sich Deutschland ganz hinzugeben, „brannte das Herz der Elfjährigen. Da zog sie mit – zumindest für die nächsten fünf Jahre.“ Ebenso berichtet Ruth Bulwin, dass sie ein glückliches Mitglied des BDM war, obgleich sie dessen Politik nicht tangiert habe. Im Gegensatz dazu musste Robert Neumaier gezwungen werden, 1938 in die HJ einzutreten. „Dabei musste ich feststellen, dass mir dieses neue Leben recht gut gefiel. Geländespiele, Zeltlager, Lagerfeuer, Leichtathletik, Liedersingen, wenn auch manchmal mit schrillen Texten, das alles machte mir großen Spaß. Das Eingebundensein in eine kameradschaftliche Gruppe Gleicher unter Gleichen begeisterte mich. Endlich gehörte ich auch dazu.“61
Die große Mehrheit der unpolitischen Jugendlichen war beeindruckt von Hitlers Erfolgen und bereit mitzuziehen, solange das Regime ihnen in ihrem Privatleben nicht dazwischenfunkte. Laut Heinz Schultheis war „der entscheidende positive Aspekt, daß mit den Nazis das Elend bald ein Ende habe und Deutschland großen und guten Zeiten entgegen gehe, […] die für jeden ‚Volksgenossen‘ sichtbarste Tatsache, dass es nun tatsächlich aufwärts ging!“ In der Rückschau ist es für ihn die „Zeitepoche …, in der das NS-Regime bei dem größten Teil der deutschen Bevölkerung die weitestgehende Akzeptanz erfuhr und auch im Ausland zwar nicht geliebt, aber respektiert und als ernst zu nehmendes Faktum angesehen war“. Zur selben Zeit hatte Paul Frenzel den Eindruck, „als wäre die Mehrheit der Bevölkerung nach Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit, der Einführung einiger sozialer Maßnahmen und der Beseitigung diskriminierender Bestimmungen des Versailler Vertrages mit dem Dritten Reich ganz zufrieden“. Als das aufgrund des Versailler Vertrages unter Völkerbundsmandat stehende Saarland 1935 per Referendum an das Deutsche Reich angeschlossen wurde, wurde Ursula Mahlendorf vom nationalistischen Eifer der jubelnden Massen mitgerissen.62
Es gab aber auch eine wachsende Minderheit, die sich dem Nationalsozialismus wo möglich verweigerte. Nachdem ihre Jugendgruppe des „Vereins für das Deutschtum im Ausland“ (VDA) mit dem BDM verschmolzen worden war, schaffte es Gisela Grothus, nie ganz beizutreten, ohne mit irgendeiner Bestrafung rechnen zu müssen. Andere wie Fritz Klein hatten es zunehmend satt, mitzumarschieren oder Hitler-Triumphe zu beklatschen: „So gut man konnte, entzog man sich dem Dienst mit irgendwelchen Ausreden.“ HJ-Führer geben ihrer Enttäuschung Ausdruck über die „mehr oder weniger große Anzahl [derer], die [dem Dienst] sehr oft fernblieben“ und die sie aufspüren mussten. Jugendliche, die integre Lehrer hatten oder aus unangepassten Elternhäusern kamen, konnten „das Bild einer menschenfreundlichen, vernünftigen, friedlichen Gegenwelt“ zur NS-Diktatur entwerfen. In solchen Kreisen verstand es sich von selbst, dass man gegen das NS-Regime war.63
Unterstützung für eine kritische Haltung bot die „Bekennende Kirche“, die die Nazifizierung des Protestantismus durch die Deutschen Christen 1934 im Barmer Bekenntnis zurückwies. Als er von der Ermordung der SA-Führung beim sogenannten „Röhm-Putsch“ erfuhr, sagte Gerhard Krapfs Vater, das, „was hier geschehen ist, war Mord“, und schloss sich mit einem von ihm aufgebauten Netzwerk kritischer Pastoren der protestantischen Opposition an. Sein Sohn, der den HJ-Drill hasste, hoffte vergeblich, dass die Wehrmacht zu einer Barriere gegen die NS-Diktatur würde. Schockiert von Berichten über die Euthanasie an den Behinderten, begann Erich Helmers Vater kritische Predigten zu halten, ohne sich um die Gestapo-Überwachung in der Kirche zu scheren. Um seinen Standpunkt zu unterstreichen, benannte er sogar seine braunen Hennen nach führenden Nazis: „Adolfine, Hermine, Goebbelinchen, Baldurette, doch der Hahn war ‚Joseph‘, denn seine Stimme machte dem Propagandaminister alle Ehre.“ Als ein HJ-Führer starb, war der Sohn „nicht durch den Tod erschüttert, sondern über die Leere des nationalsozialistischen Kultes“, der die Religion imitierte. Er verließ daraufhin die Hitler-Jugend. Auch der Katholik Joachim Fest folgte vorgeblich der Maxime „Auch wenn alle mitmachen – ich nicht!“64
Nur selten verwandelte sich „unangepasstes Jugendverhalten“ in aktiven politischen Widerstand; die Gestapo unterdrückte rigoros jede Spur von Dissidententum. In Köln half Gertrud Kühlem, Tochter aus einem kommunistischen Elternhaus, eine Gruppe junger Rebellen zu sammeln, deren Erkennungszeichen eine Edelweiß-Anstecknadel war; die Alpenblume symbolisierte für sie Freiheit. Sie tarnten sich als Mitglieder der „Naturfreunde“, wanderten, zelteten und sangen, um ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren. Sie waren überzeugt, dass „etwas getan werden [musste] gegen die ungerechte Diktatur“, deshalb kritzelten sie Parolen an Hauswände und Güterwaggons: „Habt ihr denn noch immer nicht die Nase voll von der Scheiße?“ Ihre Aktionen gipfelten im Abwurf Hunderter Flugblätter von einer Leiter im Kölner Hauptbahnhof. Als die Gestapo sie schließlich ausfindig machte, wurden die Frauen brutal geschlagen, um Geständnisse aus ihnen herauszupressen, während man die Männer in Strafkompanien an der Front steckte.65
Der elementare Freiheitswunsch der Jugendlichen befeuerte auch Formen kultureller Opposition. In einigen größeren Städten propagierten junge Leute aus der Mittelschicht, die gern Jazz hörten oder zu Swing-Musik tanzten, einen Lebensstil, mit dem sie gegen die „nordische Norm“ aufbegehrten, und der sich, als er verboten wurden, gegen das „Dritte Reich“ richtete. In Berlin wagte eine Gruppe junger Juden und Kommunisten unter Führung von Herbert Baum in einem Akt des Protests gegen die antibolschewistische Propaganda des NS-Regimes im Mai 1942 einen Brandanschlag auf die wenige Tage zuvor im Berliner Lustgarten eröffnete antikommunistische Propaganda-Ausstellung „Das Sowjetparadies“. Und in München verteilte eine kleine Gruppe von Studenten um die Geschwister Sophie und Hans Scholl Flugblätter im Auditorium der Universität, auf denen der mörderische Krieg und die Verletzung der Menschenrechte angeprangert wurden, wofür die meisten von ihnen hingerichtet wurden. Obwohl in höchstem Maß bewundernswert, blieben diese außerordentlich mutigen Akte des Widerstands gegen ein blutrünstiges Regime isolierte Bemühungen und stellten keine große Gefahr für die NS-Herrschaft dar. Fanatische HJ-Mitglieder verabscheuten die Andersdenkenden „als Kriminelle, notorische Bummelanten und sittlich verkommenes Menschenpotential“.66
Ausgeschlossen aus der nationalen Gemeinschaft, sahen sich junge Juden zunehmend von öffentlichen Bereichen in abgesonderte Räume verdrängt, die sie zu einem erbärmlichen Leben verdammten. Infolge der antisemitischen Propaganda dämmerte Gerhard Krapf, „dass es ‚Juden‘ gab, im Gegensatz zu dem, was die Nazis Arier nannten“, auch wenn er den Unterschied nicht anerkennen wollte. Ebenso bemerkte Tom Angress in der Schule, „dass ich anders war als meine nichtjüdischen Mitschüler“, aber weil er in einem assimilierten Elternhaus aufgewachsen war, wusste er nicht, „welchen Unterschied das machte, weil niemand mir erklärt hatte, was es bedeutete, Jude zu sein“. Die zunehmende Diskriminierung im Alltag, die vom Verbot der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel bis zum Verbot der Haustierhaltung reichte, ließ keinen Zweifel daran, dass Juden keine Deutschen mehr sein konnten und auswandern sollten. Der 15-jährige Tom kleidete seinen Kummer über diese Ausgrenzung in poetische Worte: „Wir kennen keine Gerechtigkeit mehr, nur Unterdrückung./Unser Heimatland liebt uns nicht mehr.“67
Solange sie der Unterstützung der meisten Erwachsenen und der Begeisterung der Jugend gewiss war, konnte die NS-Diktatur es sich leisten, eine rassische und ideologische Minderheit zu verfolgen. „Die überwiegende Mehrheit der Wahlbürger in Deutschland“, erklärt Karl Härtel, „hatte nach 17-jähriger Erfahrung mit den Siegern Frankreich und England offenbar das starke Gefühl, dass sich jetzt in unserem Land eine Regierung auf den Weg begeben hat, eine schon viel zu lange erduldete Ausbeutung und Demütigung zu beenden.“ Dank der Verbesserung der Lebensbedingungen „konnten die braunen Genossen mit der uneingeschränkten Zustimmung derjenigen rechnen, welche über fast zwei Jahrzehnte hinweg die von den Alliierten präsentierten Rechnungen mit einem bis zur Armutsgrenze reduzierten Lebensstandard bezahlen mussten“. Und wenn die Zustimmung ausblieb, gab es immer noch die Gestapo. Der Sohn von Edith Schöffskis Nachbarin berichtete, „dass Vater von den Nazis beschattet wird, weil er sich nicht an politischen Diskussionen beteiligt und nicht mit ‚Heil Hitler‘ grüßt“.68 Ein solches einschüchterndes Gerücht genügte, um die meisten Skeptiker bei der Stange zu halten.