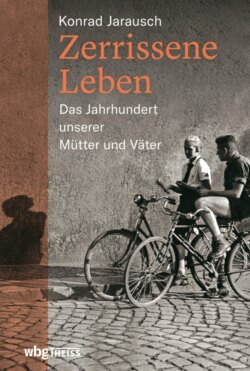Читать книгу Zerrissene Leben - Konrad Jarausch - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nationalsozialistische Jugendliche
ОглавлениеViele Nationalisten waren hocherfreut, als Reichspräsident Hindenburg am 30. Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler ernannte. Aber die Linken hatten bereits eine düstere Vorahnung, dass die Nationalsozialisten nun die Macht an sich reißen würden. Die 16-jährige Eka Assmus rief, als sie die Neuigkeit erfuhr, aufgeregt: „Onkel Hans sin Führer is nu dran!“ Als SS-Mitglied bereitete sich ihr Verwandter schon auf einen Fackelzug zur Feier des Sieges vor, während eine Nachbarsfrau sich beeilte, die Hakenkreuzfahne zu hissen. Ein anderer „alter Kämpfer“ war außer sich vor Freude: „Die Begeisterung trieb ihm Tränen in die Augen. Kam da der neue Erlöser?“ Aber in Leipzig sahen zwei junge Kommunisten „verwundert … unzählige Nazis in endlosen Kolonnen vorüberziehen“. Sie erwarteten eine Aufforderung zum gewaltsamen Widerstand, „doch niemand kommt, nichts geschieht“. Der junge Jude Frank Eyck spürte instinktiv, dass von diesem Tag an „meine Eltern mich nicht mehr beschützen konnten. Die sorgenfreie Atmosphäre der Kindheit war verschwunden. Nichts konnte [jetzt noch] für selbstverständlich genommen werden.“1
Die Nazifizierung der meisten deutschen Jugendlichen war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer wohlüberlegten Strategie der NSDAP. „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“, hatte Hitler postuliert, der großen Wert auf die jüngere Generation als Avantgarde des „Dritten Reichs“ legte, da viele Erwachsene in ihren Gewohnheiten zu festgefahren waren, um sich bedingungslos zum Nationalsozialismus zu bekennen. Die Jugendorganisation der Partei, die „Hitler-Jugend“ (HJ), war ein wichtiges Instrument, um die nächste Generation nationalsozialistischer Führer zu formen, die die konfusen ideologischen Ziele der Bewegung noch glühender verfolgen sollten. Die martialische Hymne der HJ appellierte an den jugendlichen Idealismus, indem sie suggerierte, es sei die Aufgabe der Jungen, die Einheit und Größe des Landes wiederherzustellen: „Vorwärts! Vorwärts! Schmettern die hellen Fanfaren,/Vorwärts! Vorwärts! Jugend kennt keine Gefahren./Deutschland, du wirst leuchtend stehn/Mögen wir auch untergehn.“2
Der Nationalsozialismus sprach vor allem Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsensein an. In früheren Jahrhunderten war dieser oft schwierige Übergang, der durch religiöse Riten wie etwa die Konfirmation markiert wird, vergleichsweise abrupt erfolgt: Mit dem Eintritt in die Arbeitswelt galt man als erwachsen. Doch Psychologen wie G. Stanley Hall und Dramatiker wie Frank Wedekind „entdeckten die Adoleszenz“ an der Wende zum 20. Jahrhundert als ausgedehnte Lebensphase zwischen Kindheit und Erwachsensein.3 Im Zuge dieser grundlegenden Veränderung ihrer Persönlichkeit sollten junge Leute ein eigenständiges, von ihren Eltern unabhängiges Ich entwickeln und sich auf ihresgleichen hin umorientieren. Genau da setzte die Hitler-Jugend an, indem sie den Jugendlichen eine eigene Mission gab, sie vom Elternhaus absonderte und ihnen Kameradschaft in ihrer eigenen Altersgruppe bot. Eine psychohistorische Analyse der nach dem Ersten Weltkrieg Geborenen kommt zu dem Ergebnis, dass die Weimarer Kinder ziemlich anfällig für diese Verlockung waren.4
Die von ehemaligen Mitgliedern verfasste umfangreiche Literatur über die Hitler-Jugend spiegelt eine grundlegende Ambivalenz der nationalsozialistischen Erfahrung. Einerseits räumt etwa die ehemalige BDM-Gruppenführerin Eva Peters ein: „Auch [ich] war gemeint, angesprochen, aufgerufen, [mein] Leben in den Dienst von etwas ganz Großem, Überwältigendem zu stellen, das Deutschland hieß.“ Andererseits zwangen die schrecklichen Folgen dieses fehlgeleiteten Idealismus sie später, nach einer Erklärung dafür zu suchen, „was ganz konkret bei [mir] und wohl auch vielen anderen jungen Menschen der Hitlerjugendgeneration jene ‚große Täuschung‘ bewirkt hat“, an die nationalsozialistische Botschaft zu glauben. Diese Ambivalenz lässt die Erinnerungen oft widersprüchlich und seltsam unentschieden erscheinen, wenn sie zwischen der atmosphärischen Schilderung von Spiel und Spaß in der HJ und der retrospektiven Verurteilung changieren. Solche gemischten Gefühle sind besonders ausgeprägt bei jüdischen Opfern wie Lucy Mandelstam, die schreibt: „Ich sehne mich zurück [nach einer Jugend] und empfinde zugleich Traurigkeit [wegen dieser Jugend].“5
Die Auswirkung der Nazifizierung war weder so groß, wie NS-Führer behaupteten, noch so geringfügig, wie spätere Apologeten meinten. Aufgrund des wachsenden organisatorischen Monopols der Hitler-Jugend war die Mitgliedschaft spätestens Ende der 1930er-Jahre so gut wie unumgänglich. Der Druck von Elternhaus, Schule und öffentlicher Propaganda zwang die meisten Jugendlichen zum Beitritt, es sei denn, sie waren als Linke, Juden oder andere „Außenseiter“ von vornherein ausgeschlossen. Die Gruppe der Gleichaltrigen übte über Freunde, Freizeitaktivitäten und den jugendlichen Protest gegen die Erwachsenenwelt eine so gewaltige Anziehungskraft aus, dass viele Jugendliche unbedingt dazugehören wollten. Die Vorbehalte der Eltern ignorierten sie vielfach bewusst. Die gebetsmühlenartige Wiederholung von Parolen, die paramilitärische Ausbildung und das endlose Marschieren und Exerzieren stießen aber auch auf Ablehnung; viele Jugendliche passten sich äußerlich an, ohne die ideologische Botschaft zu verinnerlichen. Wie auch immer die Reaktion ausfiel, eines war gewiss, wie Ruth Weigelt schreibt: „Die Nazis brachten alles, aber wirklich alles durcheinander.“6