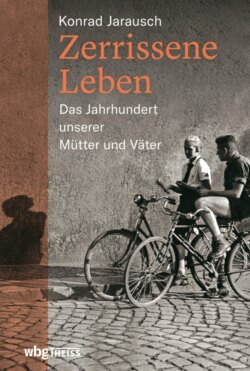Читать книгу Zerrissene Leben - Konrad Jarausch - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE SCHULISCHE HERAUSFORDERUNG
ОглавлениеDer Eintritt in die Volksschule bedeutete „eine einschneidende Zäsur“, die „einen neuen und sehr wichtigen Lebensabschnitt“ für ein Kind einleitete. Dank des Erbes der Reformation hatten die deutschen Staaten bereits im 18. Jahrhundert ein System der Volksschulerziehung mit Schulpflicht entwickelt, um die Gläubigen zu befähigen, die Bibel in der Volkssprache zu lesen.
6 Schüchterne Erstklässlerin.
Der Schulunterricht beschränkte sich auf die Vormittagsstunden. Mittags kehrten die Schüler zum Essen nach Hause zurück und hatten den Rest des Tages reichlich Zeit zum Spielen.27 Wegen der warnenden Geschichten älterer Geschwister und Freunde sahen die Jüngeren mit einer Mischung aus Ungeduld und Sorge ihrem ersten Tag in einer Institution entgegen, die sie fürs Leben zeichnen würde. Um den Übergang in die neue Lebensphase zu erleichtern, schenkten Eltern bangen Söhnen und Töchtern wie Ruth Bulwin üblicherweise eine mit Süßigkeiten und Schulutensilien gefüllte Überraschungstüte (Abb. 6). Solcherart beruhigt, stapften die Schulanfänger mit ledernen Ranzen auf ihren schmalen Rücken zu dem Furcht einflößenden Schulhaus.
Die Schüler erlebten das ganze Spektrum von Volksschullehrern, das von freundlichen und hilfsbereiten Pädagogen bis zu strengen und autoritären Zuchtmeistern reichte. Während des Kaiserreichs waren die meisten Lehrer Männer, aber in der Weimarer Republik drängten zunehmend Frauen in den Lehrerberuf, vor allem in den unteren Klassen. Die meisten Lehrer bemühten sich, Grundkenntnisse wie das Einmaleins zu vermitteln oder Namen und Daten der deutschen Geschichte, etwa die Abfolge der preußischen Könige, oder den Schülern geistige Anregungen zu geben, indem sie beispielsweise Gedichte behandelten.28 Die Unterrichtsmethoden beschränkten sich im Großen und Ganzen auf Frontalunterricht, der Schwerpunkt lag auf Auswendiglernen und Wiederholen. Doch es gab auch „junge, moderne“ Lehrer, die mit offiziell nicht vorgesehenen progressiven Erziehungsmethoden experimentierten. Wenn ein Kind Glück hatte, bekam es einen netten Lehrer, der ein Interesse daran hatte, bei seinen Schülern die „Freude am Lernen“ zu wecken. Aber es gab auch viele Klassenzimmertyrannen, die ihre Macht auskosteten. Im Gegensatz zu den Behauptungen mancher Schüler, sie hätten in der Schule gelitten, gab es allerdings viele andere, denen es „dort die ganze Zeit über ganz gut gefallen“ hat.29
Mit vierzig bis fünfzig Schülern waren die Klassen sehr groß und häufig nach Geschlechtern getrennt. So vielen umherschweifenden Geistern und unruhigen Körpern fiel es schwer, stundenlang still zu sitzen und Disziplin zu wahren. Manchen engagierten Lehrern gelang es, die Aufmerksamkeit ihrer Schüler mit neuartigen Unterrichtsmethoden zu fesseln. Aber die Mehrzahl griff bei jeder Gelegenheit zum Mittel der körperlichen Züchtigung und vertraute auf das griechische Sprichwort „Der nicht geschundene Mensch wird nicht erzogen.“ Erika Taubhorn weiß noch: „Die Jungen mussten sich bücken und bekamen zwei- bis dreimal mit dem Rietstock etwas auf den Hosenboden. Die Mädchen mussten die Arme und die Hände ausstrecken und dann schlug der Lehrer mit dem Rietstock zwei- bis dreimal auf die Hände oder Fingerspitzen.“ Trotzdem waren die meisten Lehranstalten „keine barbarischen Prügelschulen“, und die Kinder rechneten damit, für schlechtes Betragen körperlich bestraft zu werden, denn „Zucht und Ordnung wurden groß geschrieben“. Tatsächlich führten viele Schüler später „ein sehr erfolgreiches Leben als Ärzte, Juristen oder Wissenschaftler“, ohne durch ihre schulischen Erlebnisse dauerhaft traumatisiert zu sein.30
Das wichtigste Unterrichtsmedium war eine schwarze Schiefertafel mit einem hölzernen Rahmen, einem Griffel und einem Schwamm oder Lappen zum Auswischen von Fehlern. „Auf der einen Seite waren Linien zum Schreiben, die andere Seite war mit Kästchen versehen zum Rechnen“, erinnerte sich Erika Taubhorn. Die Kinder trugen ihre Tafeln vorsichtig zur Schule und wieder nach Hause, denn ließ man sie fallen, zerbrachen sie in tausend Stücke. Am Anfang des Schreibunterrichts standen bildhafte Beispiele. So symbolisierte etwa ein großes auf die Tafel gemaltes Osterei den Buchstaben „O“, den Anfangsbuchstaben des Wortes Osterei. Im Rechenunterricht mussten das kleine und das große Einmaleins auswendig gelernt werden, das dann gemeinsam vorwärts und rückwärts aufgesagt wurde.31 Der Lehrer stand stets vor der Klasse und schrieb oder malte auf der Tafel. Der Klasse den Rücken zuzuwenden, kam allerdings einer Aufforderung zu allerlei Schabernack gleich, beispielsweise mit gekauten Papierkügelchen zu schießen. Hatte er Sinn für Hu mor, konnte der Pädagoge sich revanchieren, indem er einen nassen Schwamm über dem Kopf eines unaufmerksamen Schülers ausdrückte. Auch Karten und Schaubilder kamen im Unterricht zum Einsatz, und viele Lehrer belebten ihren Unterricht mit Geschichten.
Bis in die späten 1920er-Jahre „schien die Schule noch ein politikfreier Raum zu sein“, erinnert sich Hans Queiser. „Was auch nur entfernt mit Politik zu tun hatte, blieb draußen, versteckte oder gar offene konfessionelle oder politische Tendenzen kamen im Unterricht nicht vor.“ Das einzige Bild an der Wand war das des steinalten Präsidenten Hindenburg. In Heimatkunde wurden die Geschichte und Geografie der weiteren Region behandelt. In protestantischen Gegenden waren die meisten Lehrer liberal oder demokratisch eingestellt; in katholischen Gebieten unterstützten sie in der Regel die Zentrumspartei. Aber diese apolitische Haltung „hatte eine … gewiss nicht beabsichtigte Folge: Außerhalb der Schule waren die Kinder den bald an sie herantretenden nationalistischen Einflüssen ohne jegliche Vorbereitung und ohne eigenes Urteil ausgeliefert“, da sie nie gelernt hatten, sich mit kontroversen Themen und Ansichten auseinanderzusetzen. Als während der Wirtschaftskrise die ersten politischen Parolen Eingang in das Bewusstsein der Kinder fanden, waren es „zunächst … scheinbar normale nationale Töne, die in die Welt des Zehnjährigen drangen, verbunden mit Ereignissen für die sich Jungen in diesem Alter unweigerlich zu begeistern beginnen: Höchstleistungen in Sport und Technik“.32 Ironischerweise öffnete gerade die Neutralität der Lehrer, die für die Republik einstanden, der nationalistischen Agitation Tür und Tor.
Einen Platz innerhalb der Klassengemeinschaft zu finden, war nicht immer leicht, vor allem für ein auswärtiges Kind, wenn es auf eine Schule in der Stadt gewechselt war, oder wenn es anderweitig auffiel. Ein schulisches Problem war die „soziale Scheidungslinie“ zwischen gut situierten und armen Schülern. Sie sorgte dafür, dass Schüler aus ein und derselben sozialen Schicht meist unter sich blieben und Klassenschranken nicht überschritten wurden. Ursula Mahlendorf erinnert sich, dass die Kinder wohlhabender Eltern schicke Sachen trugen, während ihre ärmeren Mitschüler häufig schmutzig und verlaust herumliefen. Vor allem Jungen konnten ziemlich grausam sein und die Schule „fast [zur] Qual“ machen, wenn sie verzogene Gören wegen ihrer feinen Ausdrucksweise und besseren Kleidung schikanierten. Erst als Paul Frenzel sich ein Herz fasste, zurückschlug und einen größeren Raufbold auf die Bretter schickte, hat „kein Junge mehr gewagt, mich zu hänseln oder gar zu schlagen“.33 Mädchen verhielten sich im Gegensatz dazu meist cliquenhafter. Umso wichtiger war es, eine Freundin zu finden, neben der man in der Schulbank sitzen konnte, damit man dazugehörte. Mitschüler animierten auch zu Streichen, etwa wenn Jungen eine Klappleiter von einem Holzstoß warfen oder Mädchen auf ihren Tornistern einen Hügel hinunterrutschten, was in beiden Fällen einen strengen Verweis nach sich zog.34
Bei gemeinsamen Interessen konnten aus Schulbekanntschaften lebenslange Freundschaften werden, die Diktatur und Krieg überstanden. Mädchen neigten dazu, einander ihre Gedanken und Gefühle anzuvertrauen. Gisela Grot hus lernte in ihrer Privatschule die Tochter einer protestantischen Familie jüdischer Herkunft kennen: „So gewann ich meine erste Schulfreundschaft mit ‚Marthchen‘ und spielte oft mit ihr.“ Die spätere Verbundenheit mit einem anderen Mädchen als „Herzensfreundin“ hielt ebenfalls ein ganzes Leben lang. Jungen waren eher auf „Kameradschaft“ aus, um zusammen etwas zu unternehmen, oder suchten Vorbilder, die sie schwärmerisch verehren konnten. Der junge Jude Werner Warmbrunn freundete sich mit einem „blonden, sportlichen … Anführer der Bande aus dem Viertel“ an und bewunderte später einen „Freigeist“, der sich als Spross einer adeligen Nazi-Familie „wenig darum scherte, was andere von ihm und seinem Treiben dachten“. Indem sie soziale Grenzen überschritten, erweiterten solche Freundschaften den Horizont und erwiesen sich als hilfreich im Prozess des Erwachsenwerdens.35
Während der Weimarer Republik wurden die meisten Jungen und Mädchen auf reine Jungen- bzw. Mädchenschulen geschickt, was die Herausbildung getrennter Geschlechterrollen in jungen Jahren verstärkte. Während diese Trennung nach Geschlechtern bei kleinen Kindern kaum einen Unterschied machte, sollte sie in der Phase der Adoleszenz die mit der erwachenden Sexualität einhergehenden Probleme aus dem Klassenzimmer verbannen. Zum einen sollten Knaben abgehärtet werden, damit aus ihnen Männer wurden, die getreu der Maxime „Ein deutscher Junge weint nicht“ schmerzhafte Schläge und blaue Flecken wegsteckten. Zum anderen hatten Mädchen einen weniger anspruchsvollen theoretischen Lehrplan und lernten stattdessen in Näh- und Kochkursen und dergleichen ihre künftige Rolle als Hausfrau. Ironischerweise brachte die Geschlechtertrennung manchmal homoerotische Freundschaften hervor, die vor allem bei solchen Jungen augenfällig waren, die sich im Sport oder in anderen Situationen körperlich zueinander hingezogen fühlten. Die Trennung führte dazu, dass eine gewisse Verständnislosigkeit zwischen beiden Geschlechtern herrschte, sobald die schulische Absonderung sie nicht länger auf Distanz halten konnte und sich erste Schwärmereien entwickelten.36
Im Alter von zehn Jahren standen die Kinder vor einer äußerst schwerwiegenden Entscheidung: Welchen Bildungsweg sollten sie nach der vierten Klasse einschlagen? Trotz einiger kleinerer Reformen mussten Eltern eine Wahl innerhalb des vom Kaiserreich überkommenen dreigliedrigen Schulsystems treffen. Damit ihr Kind Zugang zu den höheren Berufen hatte, musste es das Gymnasium besuchen, eine höhere Schule mit altsprachlicher (Latein oder Griechisch), neusprachlicher oder naturwissenschaftlicher Ausrichtung. Wollten die Eltern ihr Kind auf einen Berufsweg als kaufmännischer Angestellter vorbereiten, wählten sie gewöhnlich die weniger renommierte Realschule, eine neusprachliche weiterführende Schule. War das Ziel lediglich ein Arbeiterberuf, dann besuchten ihre Söhne und Töchter weiter die einfache, dafür aber kostenlose Volksschule. Die Entscheidung hing nicht nur von dem gefürchteten Zeugnis ab, sondern auch von den gesellschaftlichen Ambitionen und finanziellen Mitteln der Familie. Karl Härtel berichtet, „dass mir als Kind mittelloser Eltern die Möglichkeit zum Besuch eines Gymnasiums von vornherein verbaut war, weil das monatliche Schulgeld in Höhe von ca. 25 RM einfach nicht zur Verfügung stand“.37
Den wenigen Schülern, die so viel Glück hatten, auf ein Gymnasium überzuwechseln, klopfte „das zehnjährige Herzchen … schon ein bisschen stärker als sonst“ beim Gedanken an diese ehrwürdige Lehranstalt. Zuerst galt es, eine strenge Aufnahmeprüfung zu absolvieren, die aus einem Aufsatz und Rechenaufgaben bestand. Danach erwartete die Neuen ein anspruchsvoller Lehrplan, der auf Latein, Griechisch oder modernen Fremdsprachen beruhte und durch naturwissenschaftliche Fächer ergänzt wurde. Obwohl die Unterrichtsmethoden oft so antiquiert waren wie die Gebäude, orientierte sich der Stoff am neuhumanistischen Bildungsideal mit seiner starken Gewichtung der Klassiker. Das Ergebnis war eine eigentümliche Mischung aus Antikenbegeisterung und individueller Menschenbildung. Einigermaßen überfordert, brachen viele Jungen die Schule ab, weil sie diese Ansprüche nicht bewältigen konnten oder wollten. Dagegen kam Hans Tausch „mit den Anforderungen des Gymnasiums unter neuen Bedingungen in neuer Umgebung überraschend gut zurecht. Mir half dabei ein gutes Gedächtnis, ich konnte gut zuhören und dem Unterricht in nicht nachlassender Aufmerksamkeit folgen.“38 Da das Gymnasium das Tor zu einer großbürgerlichen Zukunft war, hielten die meisten Schüler durch. Mädchen wurden gewöhnlich an leichteren Oberschulen angemeldet, die sie nicht auf ein Universitätsstudium vorbereiteten.
Weniger ehrgeizige Kinder kamen in die Realschule, deren Lehrplan moderner war, die aber nichtsdestotrotz den Zugang zu mittelständischen Berufen eröffnete. Statt der neun Gymnasialjahre erforderte diese Schule nur sechs Unterrichtsjahre, auf die in der Regel irgendeine kaufmännische oder technische Lehre in einem Angestelltenberuf folgte. Weil ihr Unterricht sich an Englisch und Französisch plus Mathematik ausrichtete, hielten viele bürgerliche Eltern die Realschule für zweckmäßiger, und den Schülern war ihre berufsbezogene Relevanz unmittelbarer einsichtig. Dies führte dazu, dass sie die theoretischen Anforderungen leichter erfüllten, auch wenn die schulischen Leistungen durchaus schwanken konnten zwischen einem „blaue[n] Brief“, der vor dem drohenden Scheitern warnte, und der „angenehmen Überraschung“ in Form eines guten Zeugnisses. Als Paul Frenzel sich als der Zweitbeste in der Klasse entpuppte, schlug sein Vater sofort eine Zusatzausbildung in Hotelmanagement vor, was sein Sohn entschieden ablehnte. Das hieß letztendlich aber auch, dass der Besuch der Realschule normalerweise „unproblematisch“ war.39
Die Mehrzahl der Kinder blieb auf der Volksschule, die sich auf den Elementarunterricht konzentrierte. Im Gegensatz zu den höheren Schulen bot diese Lehranstalt nur vier zusätzliche Klassen bis zum Alter von 14 Jahren an. Im Mittelpunkt des Lehrplans standen Deutsch und Schönschreiben, Heimatkunde und Rechnen. Nach dem Abschluss fingen die meisten Kinder eine Handwerkslehre an, die einmal wöchentlich durch berufsbezogenen Unterricht in einer Berufsschule ergänzt wurde. Während der Weimarer Republik öffneten Reformen außergewöhnlichen Begabungen die Tür einen Spaltbreit für die Weiterbildung durch „Förderklassen“. Wegen der Kosten entschieden sich viele Familien, Mädchen nicht aufs Gymnasium zu schicken. Ursula Baehrenburg konnte die Tränen nicht unterdrücken, als ihr Traum vom weiteren Lernen platzte. Ein robusterer Charakter wie Karl Härtel profitierte trotzdem hinreichend von der Volksschulbildung, um eine Ingenieurausbildung zu machen, weil er praktisches Geschick in seinem Handwerk bewies.40
Die Wertvorstellungen, die diese Schulen ihren Schülern einschärften, waren im Grunde ambivalent, vermengten sie doch eine humanistische Empfindsamkeit mit einer nationalistischen Orientierung. Der Deutschunterricht konzentrierte sich häufig auf die Klassiker, Versepen wie Schillers Glocke wurden auswendig gelernt oder Dramen wie Goethes Faust besprochen, auch wenn viele Schüler deren Botschaft kaum verstanden. Der Religionsunterricht war Teil des regulären Lehrplans. Je nach Ausrichtung der Schule vermittelte er protestantische, katholische oder jüdische moralische Gebote. Zugleich öffnete der Fremdsprachenunterricht der höheren Schulen aber durchaus Fenster, und zwar nicht nur auf das klassische Altertum, sondern über die Lektüre von Shakespeare oder Molière auch auf unterschiedliche zeitgenössische Kulturen. Dennoch existierte ein starker patriotischer Grundzug, der die Überlegenheit der deutschen Kultur betonte, wenn romantische Gedichte rezitiert oder an Nationalfeiertagen patriotische Lieder wie „Die Wacht am Rhein“ gesungen wurden.41
Das giftige Vermächtnis des verlorenen Ersten Weltkriegs verwandelte solchen Stolz in einen üblen Nationalismus, der Kinder anfällig für extremistische Botschaften machte. Eva Sternheim-Peters erinnerte sich, dass die jungen Menschen selbst in ihren Elternhäusern auf die Relikte des Großen Krieges stießen: Hier erinnerten Ansichtskarten von fremden Orten, „Feldpostkarten und zusammengebündelte Briefe ‚von der Front‘“, Fotos uniformierter Familienmitglieder, Medaillen für besondere Tapferkeit und sogar Uniformstücke an einen heldenhaften Kampf. Im Erdkundeunterricht zeigten die Wandkarten nach dem „Schandfrieden von Versailles“ noch immer die „verlorenen Gebiete“ und ehemaligen Kolonien des Deutschen Reiches. Im Geschichtsunterricht behauptete die „Dolchstoßlegende“, dass das deutsche Heer nicht im Feld besiegt, sondern von den „Novemberverbrechern“ im Stich gelassen und dann einer „Kriegsschuldlüge“ aus dem Ausland zum Opfer gefallen sei. Auch wenn gemäßigte Sozialdemokraten für eine Politik der friedlichen Verständigung plädierten, entwickelten viele Kinder in ihrer patriotischen Hingabe ein „Gefühl der gekränkten Unschuld“.42
Der Beginn der Schulzeit erwies sich daher für die in der Weimarer Republik Geborenen als ein zweifelhafter Segen. Im Widerspruch zu dem literarischen Klischee vom Leiden in der Schule gab es recht viele freundliche Lehrer, die den Schulbesuch zu einer positiven Erfahrung machten, was viele Memoirenschreiber zu dem Geständnis veranlasste: „Die Schule machte mir Spaß und brachte gute Erfolge.“ Aber trotz Reformanstrengungen vonseiten progressiver Pädagogen wie Heinrich Deiters waren die Weimarer Schulen größtenteils autoritäre Institutionen, wo den Schülern Gehorsam eingetrichtert wurde, was die freie Entwicklung selbst derjenigen behinderte, die „versuchten, gute Schüler zu sein“.43 In vielen Institutionen verwandelte das Vermächtnis des verlorenen Krieges Vaterlandsliebe in einen gefährlichen Nationalismus, der jungen Menschen die Köpfe verdrehte. Weil sie allzu wenige ethische Rechtfertigungen für einen kosmopolitischen Humanismus anboten, lieferten die Schulen die meisten ihrer Schüler auf Gedeih und Verderb den nationalsozialistischen Anfechtungen aus.