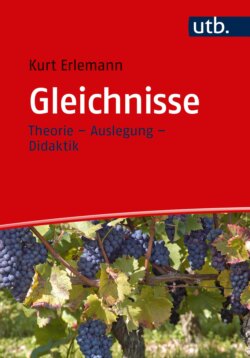Читать книгу Gleichnisse - Kurt Erlemann - Страница 90
2.4.2 Gleichnis vs. Allegorie
ОглавлениеJülichers Gleichnistheorie basiert auf der Entgegensetzung von Gleichnis/Vergleich (‚eigentlicher Rede‘) vs. Allegorie/Metapher (‚uneigentlicher Rede‘), von rhetorischem vs. po(i)etischem Zweck, von mündlicher Urform vs. verschriftlichter Gleichnisform, von einem einzigen vs. mehreren Vergleichspunkten sowie von methodischem Deutungspurismus vs. Auslegungsbedarf. Das dahinter stehende Jesusbild korrespondiert mit der Missverständnis- bzw. Verfälschungstheorie und dem Postulat eines Gleichnis-Idealtyps (→ 2.1.1f.; 2.5.5b). Die Beobachtung von Mischformen als Regelfall frühjüdischer meschalím, die ‚metaphorische Wende‘ und die Revision des Allegoriebegriffs1 erweisen den Gegensatz von Gleichnis und Allegorie als Scheinalternative (→ 2.2.1; 2.2.3; 2.2.5; 2.5.2a).
Allegorisierung wird heute weithin als historische und hermeneutische conditio sine qua non einer gelingenden Neukontextualisierung und Aktualisierung des ursprünglichen Textes verstanden.2 Die Allegorie gilt heute einerseits als Stilmittel auch im nicht-literarischen Bereich, andererseits als Gattungsbegriff, der auf Texte mit hermetischer Grundtendenz einzugrenzen ist (→ 2.2.5b; 2.5.2a).