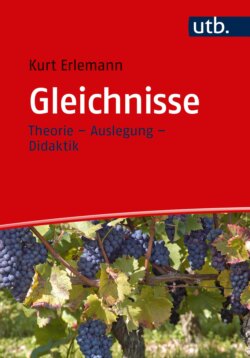Читать книгу Gleichnisse - Kurt Erlemann - Страница 93
2.4.5 Theologische Inhalte vs. ‚Sprachereignis‘
ОглавлениеIst das Gleichnis ein Sprachereignis, ist sein Inhalt ein Ereignis, das sich je und je im Hören oder Lesen des Gleichnisses einstellt – eine individuelle Begegnung mit der Gottesherrschaft und deren aktuelle Realisierung (→ 1.5.11; 2.2.3d). Der Akzent liege auf dem punktuellen Geschehen der Glaubenserfahrung bzw. Offenbarung Gottes im Gleichnis; das sei die poíesis des po(i)etisch wirkenden Textes.1 Hier einen theologischen Bezugsrahmen suchen zu wollen, wäre verfehlt. – Anders die rhetorisch-argumentative Sichtweise: Das Gleichnis transportiere als Teil eines historischen Kommunikationsgeschehens einen theologischen Inhalt (→ 2.2.6b; 2.5.6), woraus sich die Frage nach dem historischen Textsinn bzw. nach der Autorintention und den Rezeptionsbedingungen der Adressaten ergibt.
Diese Alternative spaltet nach wie vor die Gleichnisforschung in zwei Lager. Gegen die Theorie vom Sprachereignis wird kritisch eingewandt2: a) Die Realisierung der Gottesherrschaft im Vollzug des Hörens des Gleichnisses sei nicht überprüfbar; b) Nachprüfbar sei die Vermittlung komplexer religiöser Erfahrung; c) Die Rede vom Sprachereignis sei eine reine Glaubenswahrheit und apologetisch (Dokumentation der Einzigartigkeit der Predigt Jesu; → 2.4.6; 2.5.4d); d) Die Reduktion des theologischen Inhalts auf die Gottesherrschaft werde von den Gleichnissen nicht gedeckt (→ 2.5.6). – Die Alternative entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Scheinalternative: Rhetorik und Poetik gehen beim Gleichnis Hand in Hand, historisches Verstehen und affektives Angerührtsein ebenso. Die Gottesherrschaft (oder was auch immer als theologischer Bezugsrahmen des Gleichnisses anzusehen ist) gewinnt im Gleichnis Konkretion; dieser poetische Aspekt der Gleichnisse ist jedoch nicht loszulösen von dem rhetorisch-argumentativen Aspekt (→ 2.5.3b).