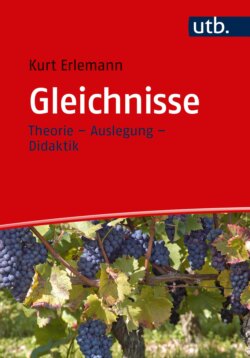Читать книгу Gleichnisse - Kurt Erlemann - Страница 99
b) Leitende Alternativen und Scheinalternativen
ОглавлениеDie Gleichnisforschung bewegt sich seit Jülicher weitgehend in einem Raster von Alternativen bzw. Scheinalternativen, die die Diskussion befördern, aber auch behindern. Diese Alternativen lauten1:
1. formkritischer Aspekt: Gleichnis [Vergleich] vs. Allegorie [Metapher] bzw. ‚eigentliche‘ vs. ‚uneigentliche‘ Rede (Frage der sprachlich-rhetorischen Grundunterscheidung).
2. formkritischer Aspekt: Mündliche vs. verschriftlichte Gleichnisse (Frage des Gleichnis-Idealtyps).
3. formkritischer Aspekt: Einzigartigkeit vs. religionsgeschichtliche Einbettung und Vergleichbarkeit (Frage des Alleinstellungsmerkmals Jesu).
4. formkritischer Aspekt: Verschiedene Gleichnistypen vs. ‚alles Parabel!‘ (Frage der Binnendifferenzierung).
1. hermeneutischer Aspekt: rhetorisch-argumentativer vs. po(i)etischer Zweck (Frage des Verhältnisses von Form und Inhalt).
2. hermeneutischer Aspekt: Verfälschungsprozess bzw. Sprachverlust vs. notwendige Aktualisierung (Frage der historischen Adaption).
3. hermeneutischer Aspekt: Vermittlung von Inhalten vs. ‚Sprachereignis‘ bzw. Offenbarungsmedium sui generis (Frage der Sprachkraft).
4. hermeneutischer Aspekt: Kontextualität vs. ästhetische Autonomie (Frage der [un-]mittelbaren Wirkung).
1. exegetischer Aspekt: Ein einziges tertium comparationis vs. mehrere Vergleichspunkte (Frage der Substituierbarkeit von Gleichnis / Metapher).
2. exegetischer Aspekt: Rekonstruktion der Urform (diachron) vs. Betrachtung der Endgestalt (synchron).
3. exegetischer Aspekt: Decodierung der Metaphorik vs. Auslegungsabstinenz (Frage der intentionalen Eindeutigkeit einer parabolḗ).
4a. exegetischer Aspekt: Frage nach Autorintention vs. Leserzentriertheit.
4b. exegetischer Aspekt: Reich Gottes vs. Vielfalt theologischer Inhalte.
Die tabellarische Übersicht zeigt die Erkenntnis leitenden Fragen und die innere Verflechtung der leitenden Alternativen der Gleichnisforschung auf:
| Aspekte, Leitfragen | formkritisch | hermeneutisch | exegetisch | |
| 1 | Zweck bildhafter Sprache; Jesus als Pädagoge, Esoteriker oder Po(i)etiker | Gleichnis/Vergleich vs. Allegorie/Metapher | rhetorisch/argumentativ vs. po(i)etisch | ein einziges tertium comparationis vs. mehrere Vergleichspunkte |
| 2 | Idealtyp; ipsissima vox Jesu als hermeneutisch letztgültig relevante Instanz | mündliche vs. schriftliche Gleichnisse | authentische, sachgemäße Aktualisierung vs. Verfälschung/Sprachverlust | Rekonstruktion der Urform vs. redaktionskritische Betrachtung |
| 3 | Verhältnis von Form und Inhalt; Sprachkraft; mehrdimensionales Alleinstellungsmerkmal Jesu | Einzigartigkeit vs. religionsgeschichtliche Einbettung und Vergleichbarkeit | Vermittlung von Inhalten vs. Sprachereignis / Offenbarungsmedium sui generis | Decodierung der Metaphorik vs. Verzicht auf Auslegung. |
| 4 | Unterschiedliches: Binnendifferenzierung // Frage nach der bedeutungsgebenden Instanz | Verschiedene Gleichnistypen vs. alles Parabel | Kontextualität der Gleichnisse vs. ästhetische Autonomie | Autorintention vs. Leserzentriertheit. – Reich Gottes vs. Vielfalt theologischer Inhalte |