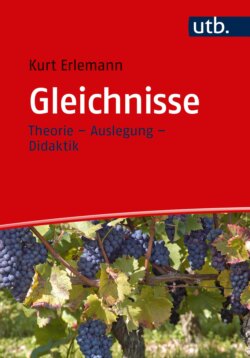Читать книгу Gleichnisse - Kurt Erlemann - Страница 91
2.4.3 Rhetorischer vs. po(i)etischer Zweck
ОглавлениеJülicher verstand Gleichnisse als rhetorische Argumentations- und Beweismittel, die durch die Rekonstruktion des tertium comparationis im Sinne einer sittlich-religiösen Satzwahrheit in nicht-vergleichende Rede zu überführen sei. Die ‚metaphorische Wende‘ führte zum Neuverständnis der Texte als poetischer, ja poietischer Gattung, deren Sinnpotenzial sich nicht in einer Satzwahrheit erschöpfe, sondern in die Neubeschreibung bzw. Neukonstituierung der Wirklichkeit münde (→ 2.2.3b; 2.5.4b). Gleichnisse gelten als erweiterte Metaphern und als hermeneutisch adäquate Form, von Gottes Wirklichkeit zu sprechen (→ 2.2.3c; 2.5.4c). Hieraus ergibt sich die Auffassung, Gleichnisse seien ein Offenbarungsmedium sui generis und die Realisierung des Reiches Gottes ein Sprachereignis (→ 2.2.3d; 2.5.4d).
Die Gleichnisform gilt in der Folge aufgrund ihrer Fiktionalität und Narrativität als unersetzbar, da nur sie einen ‚metaphorischen Prozess‘ in Gang setzen könne, der zur Entdeckung der Wirklichkeit Gottes führt. Dies gilt, so Harnisch, nur für die mündlichen Gleichnisse; die Verschriftlichung führe zu einem ‚Sprachverlust‘.1 – Die jüngste Gleichnisforschung betont das Wechselspiel zwischen rhetorisch-argumentativer und poetischer Gleichnisfunktion (→ 2.3c). Vergleichende Rede setze nicht-vergleichende Argumentation mit anderen Mitteln fort. Der Rückgriff auf vergleichende Sprache biete den Vorteil, dass das argumentative Lernziel nicht nur kognitiv, sondern auch affektiv-praktisch vermittelt wird. Gleichnisse seien Jesu Kampf um die Herzen der Menschen (vgl. → 2.2.6b).2