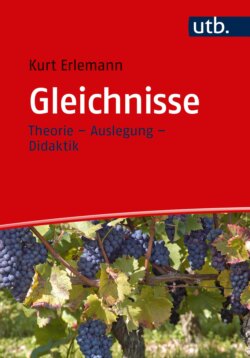Читать книгу Gleichnisse - Kurt Erlemann - Страница 92
2.4.4 Kontextualität / Autorintention vs. ästhetische Autonomie / Leserzentriertheit
ОглавлениеFür Vertreter der Kontextgebundenheit der Gleichnisse ist die Bedeutungsrichtung eines Gleichnisses durch seinen historischen bzw. literarischen Kontext und durch die Intention des Autors vorgegeben. Der Kontext gilt als die maßgebliche Instanz, die über den Textsinn entscheidet. Dem entspricht das Verständnis vom Gleichnis als einem rhetorischen Argumentationsmittel. Vertreter der po(i)etischen Sichtweise betonen hingegen die prinzipielle Deutungsoffenheit des Gleichnisses im Sinne ästhetischer Autonomie (→ 2.2.6g). Damit erscheint der Textsinn abgelöst von kontextuellen Faktoren; das Gleichnis entwickle als poetisches Kunstwerk eine Eigendynamik, was den Textsinn anbelangt. Die Sinnkonstitution ergebe sich im individuellen Rezeptionsvorgang jeweils neu und vielgestaltig.1 Diese Auffassung korreliert mit der vom Sprachereignis, das je und je in der Begegnung mit der Gleichnisbotschaft stattfinde. Die historische Analyse zur Erschließung des ursprünglichen Textsinns wird hier als inadäquat abgelehnt.2 Das, worum es im Gleichnis geht, sei überzeitlich und betreffe die Menschen aller Zeiten und Kulturen gleichermaßen. Die narrativ-poetische Gleichnisform sorge dafür, dass sich der theologische Bezugsrahmen je und je neu und unmittelbar, ohne Rekurs auf historische Gegebenheiten, ergibt (→ 2.2.3; 2.5.3a; 2.5.4d).3