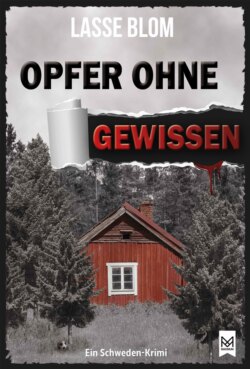Читать книгу Opfer ohne Gewissen - Lasse Blom - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеStockholm, 1973
Am Samstag kam immer Jens Sterbik zu Besuch, Vaters bester Freund. Sterbik war Sozialdemokrat, nein, sogar ein leidenschaftlicher Sozialdemokrat. Er brannte für die Partei, seit Olof Palme Parteichef und Ministerpräsident Schwedens geworden war, also seit Ende der 1960er-Jahre. Palme war ein Charismatiker, der zwar aus der Oberschicht kam, der sich aber für die Gleichstellung aller Menschen einsetzte; der einnehmend lächeln konnte; der einen großen Willen zur Macht hatte; der sich gerne mit anderen maß und oft gewann, weil er ein famoser Rhetoriker war. Palme war ein Mann, der an Modernität und Fortschritt glaubte. Und er war mutig.
Sterbik liebte es, wie Palme den Amerikanern die Stirn bot. Der schwedische Regierungschef war so etwas wie der politische Arm der Gegner des Vietnam-Kriegs, den die USA seit Mitte der 1960er-Jahre mit großer Grausamkeit führten.
Der Vater respektierte Palme, aber es entsprach nicht seiner Mentalität, etwas oder jemanden glühend zu verehren, schon gar nicht eine Ideologie oder einen Politiker. Außerdem mochte er Palmes Aggressivität nicht, seinen Spott und seine Überheblichkeit gegenüber Menschen, die ihm nicht das Wasser reichen konnten. Das hielt der Vater für ganz und gar unschwedisch. Er mochte es nicht, wenn er las, dass Palme seine Umgebung bisweilen hochnäsig behandelte, selten grüßte, oft zerstreut wirkte, leicht reizbar und dominant war und auf Kritik allergisch reagierte. Palme scherte sich offenbar nicht um Konventionen und manchmal auch nicht um Anstand.
Der Vater war ein Sozialdemokrat der alten Schule. Er hatte sich bei Palmes Vorgänger Tage Erlander besser aufgehoben gefühlt. Erlander war bedächtig, pragmatisch, vernünftig und durchschnittlich im guten wie im schlechten Sinn gewesen. Der ehemalige Regierungschef war in Stockholm in ein unscheinbares Mietshaus gezogen – er hatte gesagt, er wolle wohnen wie ein Arbeiter. Dem Vater hatte das gefallen.
An diesem Samstag redeten Sterbik und der Vater stundenlang über Politik – kein Wunder, Mitte September würden die Wahlen stattfinden. Ministerpräsident Palme musste sein Amt gegen den starken Spitzenkandidaten der Zentrumspartei verteidigen, gegen Thorbjörn Fälldin, einen Bauern aus Ångermanland in Nordschweden. Fälldin kam bei den einfachen Leuten sehr gut an. Auch der Vater, der immer die Sozialdemokraten gewählt hatte, mochte Fälldin, der auf einem kleinen Hof mit sieben Kühen und zwei Pferden aufgewachsen war. Der 1,90 Meter große Fälldin passte mit seiner bedächtigen Art und seiner Pfeife gut zur Zentrumspartei, der Partei der Bauernbewegung. Die Zentrumspartei galt auch als Vertretung der Stillen und Langsamen auf dem Land. Der Vater war still und langsam, obwohl er in der Stadt wohnte. Sterbik wusste, dass der Vater diesmal unentschlossen war, wen er wählen sollte. Deshalb warb er für Palme.
„Sieh doch, wie Palme Schweden verändert hat“, sagte Sterbik. „Wir sind heute eines der modernsten Länder der Welt – auch weil Palme es hingekriegt hat, die Frauen mit den Männern gleichzustellen. Viele Frauen können jetzt arbeiten.“
„Dafür war doch Lisbeth, Palmes Frau, verantwortlich“, sagte der Vater und machte eine abwehrende Handbewegung. Tatsächlich hatte Lisbeth Palme, eine Kinderpsychologin, ihren Mann in der Frage der Emanzipation etwas anschieben müssen.
„Ich glaube, er wollte das auch“, sagte Sterbik. „Viele seiner Mitarbeiterinnen und weiblichen Bekannten haben gesagt, dass er sie schon immer gleichberechtigt behandelt hat. Denk doch, er ist mit Schwester, Mutter und Großmutter aufgewachsen – da ist bestimmt etwas hängen geblieben.“
„Höchstens Frauenhass“, sagte der Vater und lachte.
Sterbik ließ sich nicht beirren.
„1966 waren nur 34 Prozent der Schwedinnen berufstätig, heute sind es mehr als 70 Prozent“, sagte er. „Palmes Steuerreform hat es Frauen ermöglicht, arbeiten zu gehen.“
Olof Palme hatte tatsächlich eine große Steuerreform auf den Weg gebracht. Bis 1971 waren die Einnahmen von Ehepartnern gemeinsam versteuert worden. Die Familie zahlte niedrigere Steuern, wenn die Frau nicht berufstätig war – der Mann konnte nämlich bei der Steuererklärung den Grundfreibetrag seiner Frau ausnutzen. Palme änderte das. Mann und Frau wurden seither fast völlig unabhängig voneinander versteuert. Es lohnte sich nun für Frauen, einen Job zu haben.
„Und die Elternzeit und das Elterngeld!“, rief Sterbik, der jetzt nicht mehr zu halten war und mit den Händen in der Gegend herumfuchtelte, was dem Vater missfiel. „Und die zusätzlichen Kindergartenplätze!“
Der Vater nahm seine Pfeife aus dem Mund.
„Du hast ja recht, Jens“, sagte er ruhig, „aber vom Charakter her gefällt mir Fälldin besser.“
Sterbik saß einen Moment unschlüssig da.
„Es geht um die Politik, die jemand macht“, sagte er dann.
Der Vater antwortete nicht. Er stand auf, ging zum Schnapskästchen, das an der Wohnzimmerwand hing, nahm zwei kleine Gläser und eine Flasche O. P. Anderson heraus, kehrte an den Tisch zurück und sagte: „Es geht aber auch um Gemütlichkeit.“
Sterbik lachte.
„Schenk ein!“
Nora und er hörten, wie Sterbik und der Vater fast gleichzeitig „Skål“ sagten und die kleinen Gläser klirrend gegeneinanderstießen. Sie saßen – wie immer am Samstag, wenn Onkel Sterbik kam – unter der Eckbank, auf der die beiden Erwachsenen hockten. Sie hörten den Männern zu und kicherten manchmal, wenn sie der Meinung waren, Sterbik und der Vater würden Unsinn reden. Wobei die Kinder oft schon eine falsche Betonung als Unsinn betrachteten – oder Wörter, die in ihren Ohren unsinnig klangen, wie Arbeitersozialversicherung zum Beispiel. Manchmal spielten sie unter der Eckbank auch Mühle.
Und wie jeden Samstag, so verließen sie auch diesmal nach einer Stunde ihren Platz unter der Bank und gingen in sein Zimmer. Sterbik rief ihnen immer ein „Pippi, Pippi, Katt, Katt, Katt“ hinterher, eine Art abgeänderter Sportlergruß – in diesem Fall bezogen auf das, was die beiden Kinder gleich leidenschaftlich bereden würden.
Nora war ein großer Fan von Pippi Langstrumpf.
Und er war ein großer Fan von Rune Katt.
Sie lieferten sich in seinem Zimmer einen Wettbewerb. Es ging darum, wer mehr über sein Idol wusste.
„Weißt du, dass sich mehr als 8000 Mädchen um die Rolle der Pippi beworben hatten?“, fragte sie. Eigentlich war es gar keine Frage. Es war eine Einleitung zu ihrem Monolog.
„Der Regisseur Ole Hellbom und Astrid Lindgren suchten die Pippi übers Fernsehen“, fuhr sie fort, ohne darauf zu warten, ob er antworten würde. „In der Sendung TV-Aktuellt wurde dazu aufgerufen, sich zu melden, wenn man Pippi, Tommi oder Annika spielen wollte. Die Resonanz war riesig …“
„Was ist Resonanz?“, fragte er. Er war acht Jahre alt.
Sie zog die rechte Augenbraue nach oben. Sie machte das immer, wenn sie sich überlegen fühlte. Er mochte das nicht.
„Resonanz heißt, dass sich ganz viele auf den Aufruf gemeldet haben“, sagte sie. „Und sie wurden alle eingeladen – Tausende! Und alle wollten Pippi sein – auch Maria Persson, die später die Rolle der Annika bekam, hatte sich auf Pippis Rolle beworben.“
„Keine Chance!“
„Nein“, sagte sie. „Maria hat später selbst gesagt, dass die Sache entschieden war, als Inger Nilsson vorsprach – Inger war einfach Pippi!“
Er sah sie lächelnd an. Er mochte es, wenn sie begeistert war.
„Ich glaube, dass Ingers Vater sie ermuntert hatte, sich zu bewerben“, sagte Nora. „Er hatte nämlich die Ähnlichkeit von Inger mit der gezeichneten Pippi in den Büchern gesehen: die Sommersprossen, das breite Lachen. Ole Hellbom war sofort begeistert, aber noch wussten sie nicht, ob Inger vor der Kamera funktionieren würde …“
Sie redet wie eine Erwachsene, dachte er. Dabei ist sie erst neun Jahre alt.
„… aber dann haben sie die Probeaufnahmen gemacht und Inger hat das wohl sehr gut hingekriegt. Sie mussten nur noch ihre hellen Haare rot färben.“
„Ich dachte, sie hätte eine rote Perücke getragen“, wandte er ein.
„Wer ist der Pippi-Experte – du oder ich?“, fragte sie und stieß ihn kumpelhaft in die Rippen. „Aber ich glaube, du hast sogar recht.“
Das mochte er an ihr: Sie musste nicht auf Biegen und Brechen recht haben.
„Und jetzt du“, sagte sie, „was sagst du mir heute über Rune Katt?“
Seine Augen strahlten.
„Weißt du, wie viele Länderspiele er schon gemacht hat?“, fragte er.
„Keine Ahnung.“
„500.“
„500?“
Nora interessierte sich nicht sonderlich für Fußball, aber die 500 erschienen ihr dann doch zu viel.
„Ja, hat er selbst gesagt, ich habe das im Aftonbladet gelesen“, sagte er. „Katt sagte, er hat 36 Länderspiele gespielt, war 24 Mal bei Länderspielen auf der Bank gesessen und hat 440 Länderspiele im Fernsehen gesehen.“
Sie lachte.
„Und weißt du, dass er mit Abba ein Lied aufgenommen hat?“, fragte er. „Das stand auch in der Zeitung. Abba wollte das, und Katt hat am Anfang gesagt, er kann das nicht, er ist ja total unmusikalisch.“
„Sollte er singen?“, fragte sie.
„Ja. Und als sie das Lied dann im Studio aufnehmen wollten, ging es ziemlich schief. Björn und Benny haben immer wieder verzweifelt Takt, Takt, Takt gerufen – du musst doch mal merken, wann der Takt einsetzt. Aber Katt hat zurückgerufen: Was ist ein Takt? Es entstand ein Lied, aber es war total schlecht.“
„Haben sie das Lied Waterloo genannt?“, fragte sie.