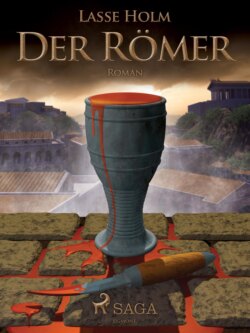Читать книгу Der Römer - Лассе Хольм - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX
ОглавлениеMeine Konsultation hielt ich in einer Ecke des Hofs ab. Inmitten der aufgehängten Wäsche, freilaufender Hühner, eines alten Kochkessels, eines Handkarrens mit gebrochener Achse und einer Menge anderen Gerümpels hatte ich eine Tischplatte zwischen zwei Pfosten befestigt. Diese primitive Konstruktion war keineswegs ungewöhnlich. Jeder Sklave oder Freigelassene, der ein wenig Griechisch sprach, konnte sich Medicus nennen.
Vorsichtig fuhr ich mit den Fingerspitzen an dem Unterarm einer jungen Frau entlang, der zart wie Daunen war. Ihr Dominus, ein älterer, korpulenter Senator, folgte mir aufmerksam mit seinem Blick, als wäre es seine kostbarste Vase, die ich anfasste.
»Wird es teuer?«, fragte er.
»Der Arm ist gebrochen. Fünf Denare.«
»Ich habe gehört, du seist billig.«
»Der Herr hat richtig gehört.«
Schultern und Rücken des Mädchens waren deutlich von Stockschlägen gezeichnet. Und ihr verängstigter Blick deutete noch auf andere Übergriffe hin als auf Prügel. Ich schiente den Arm, obwohl er nur verstaucht war.
»Die Patientin muss einen Monat lang absolute Ruhe halten. Keine körperliche Anstrengung.«
Das würde der jungen Sklavin hoffentlich eine notwendige Verschnaufpause verschaffen. Ihre dunklen, mandelförmigen Augen lächelten mir zu, als mich das ungleiche Paar verließ. Der Senator, der vor lauter Verärgerung schnaubte, war beinahe mit dem letzten Patienten des Tages zusammengestoßen, einem hageren Mann mit einem feuchten, um das Gesicht gewickelten Handtuch. Eine Frau und ein Junge führten ihn. Es waren meine Nachbarn unter mir, denen ich an dem Morgen nach dem Tod von Marcus Livius Drusus unfreiwillig zugehört hatte.
Sie war Witwe und nur ein paar Jahre älter als ich. Früher hätte sie sicherlich den meisten Männern den Kopf verdrehen können, doch ihre Schönheit war verblasst wie ein Stück Stoff, das man den Sommer über auf der Wäscheleine vergessen hatte. Wenn wir uns auf der Treppe begegneten, grüßte sie immer mit gebremstem Eifer, wie ein unfreiwilliger Einsiedler, der sich nach menschlicher Gesellschaft sehnt. Sie verströmte einen Geruch, den ich zunächst schwer identifizieren konnte, und mich überraschte es dann umso mehr, als es mir gelang: Sie roch nach Urin.
Der Junge war das genaue Gegenteil seiner Mutter. Wo sie redselig war, war er schweigsam wie eine Statue. Wo sie mit ihrer Munterkeit beinah aufdringlich war, war er scheu und zurückhaltend. Er war zwölf Jahre alt, wirkte aber jünger.
Der Patient hieß Sarpedon, erklärte die Mutter, während ich ihn untersuchte. Er war Lehrer und hielt seinen Unterricht in einem Straßenladen direkt um die Ecke ab, dessen Besitzer seit Langem wünschte, ihn an jemand anderen vermieten zu können.
»Ich wollte den Raum nicht aufgeben.« Die nasale Stimme des Lehrers erinnerte an das Blöken eines Lamms. »Weshalb hätte ich das tun sollen? Er liegt an einer Kreuzung, und meine Schüler hatten sich an den Ort gewöhnt. Wäre ich umgezogen, wäre die Hälfte der Schüler nicht mehr gekommen. Also blieb ich. Und schau her, was der Schurke mit mir gemacht hat.«
»Der Vermieter schüttete einen Topf kochendes Wasser über ihn«, erläuterte die Frau. »Die anderen Kinder hauten ab. Keiner versuchte, zu helfen. Ist das nicht unglaublich?«
Ich fragte, wer denn ein feuchtes Handtuch auf die Verbrennung gelegt hatte.
»Tiro hat es in bester Absicht getan.« Die Frau schlang schützend die Arme um ihren Sohn. Sie waren so kräftig, als würde sie mehrmals am Tag ihr eigenes Gewicht stemmen.
»Das hast du gut gemacht, Tiro.«
Ich wollte dem Jungen über die Haare streichen, doch er wich meiner Hand aus.
»Auf der linken Wange wird eine ständige Hautverfärbung zurückbleiben«, sagte ich zu dem Lehrer. »Aber Tiro hat dich vor dem Schlimmsten bewahrt. Ich selbst hätte es nicht besser machen können.«
Ich versuchte, Tiro aufmunternd anzulächeln, doch er betrachtete geschäftig seine Füße.
Alles, was sich der Junge wünscht, ist, dachte ich, in Ruhe gelassen zu werden.
Sarpedon fuhr damit fort, sich zu beklagen. Sein Unglück sei, so ließ er uns wissen, dass er zwar kein Sklave sei, doch kein Patrizier wolle einen Freigelassenen bei sich aufnehmen. Daher müsse er sich, der aus einer der vornehmsten Familien Lykiens stamme, mit dem wenigen Geld begnügen, das ihm die Leute geben könnten, und obendrein sei er nun sein Leben lang verunstaltet.
»Ich glaubte, mein Glück in Rom finden zu können«, schluchzte er. »Stattdessen gehe ich in seinem Elendsviertel zugrunde.«
Die Witwe hatte ihre eigenen Absichten.
»Wir haben uns noch nicht ordentlich vorgestellt. Das ist doch eine Schande, wo wir doch so nah beieinander wohnen. Mein Name ist Aelia. Vielleicht möchtest du eines Abends mal zum Essen kommen?« Sie entdeckte den Widerwillen in meinem Gesicht und fügte hinzu: »Das ist das Mindeste, was ich für einen Kameraden meines Mannes tun kann. Du bist doch auch einer von General Marius’ Helden aus der Schlacht in der Po-Ebene.«
Wo sie diese Information aufgeschnappt hatte, konnte ich nur erraten, hatte ich doch jahrelang gewohnheitsmäßig jede andere Vertrautheit als eine streng berufliche vermieden. Ich war sehr geübt darin, Einladungen wie die von Aelia auszuschlagen.
»Ich bin nicht so heldenhaft wie dein Mann gewesen«, sagte ich. »Ich habe nichts zu dem Sieg von General Marius beigetragen.«
Als hätte er auf dieses Stichwort gewartet, betrat der Sieger der Schlacht in der Po-Ebene den Hof. Marius’ breiter Körper zeichnete sich einen Augenblick lang in dem hellen, viereckigen Hofeingang ab. Als er sich sicher war, dass ich sein grobes Narbengesicht wiedererkannt hatte, verschwand er hinter der aufgehängten Wäsche.
»Uns wäre besser mit einem Ernährer als einem Helden gedient gewesen«, fuhr Aelia fort. »Tiros Vater hinterließ uns noch nicht einmal seine Ausrüstung.«
Ich sah ein, dass ich meine neuen Bekannten nur loswerden konnte, wenn ich Aelia gab, was sie sich wünschte.
»Wenn du Sarpedon in deiner Wohnung pflegst, werde ich dort nach ihm schauen.«
»Das werde ich machen. Wie viel schulde ich dir?«
»Nichts. Tiro hat ja die meiste Arbeit getan. Pace.«
Ich winkte und lächelte gezwungen, während sie den Hof verließen. Unterhalb eines Saums von einem der aufgehängten Laken marschierten ein paar Soldatenstiefel ungeduldig auf und ab. Nun konnte ich nicht mehr länger dem Gespräch ausweichen, vor dem ich mich zwölf Jahre lang gefürchtet hatte.
Man kann nicht ewig fliehen.