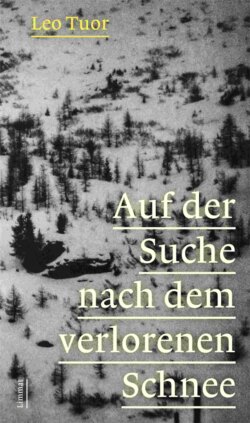Читать книгу Auf der Suche nach dem verlorenen Schnee - Leo Tuor - Страница 20
Die Wäscherin und die Mulde
ОглавлениеDem Hüter der Worte, Alexi Decurtins
Kürzlich habe ich ein Buch aus einer Mulde genommen, jemand hatte geräumt. Auf dem inneren Buchdeckel stand mit Schreibfeder geschrieben: «Dieses Buch gehört mir, Martin Schvarz von Madernal 1843.» Oh, du armes Buch, habe ich gesagt, dein Besitzer ist schon lange tot, komm mit mir, die Mulde ist nichts für dich.
Die Titelei fehlte – zu meinem Glück und dem Unglück dessen, der das Buch weggeworfen hatte. Ab Seite neunzehn folgen Kolonnen und Kolonnen Wörter, jeweils vier Reihen nebeneinander: Deutsch, Italienisch, Sursilvan, Puter, manchmal auch Vallader. Exakt einhundert Seiten. Die Listen richten sich nicht an eine Leserschaft eines bestimmten Idioms, sondern an alle Bündner. Gott behüte, rasch habe ich, Büchernarr der ich bin, gesehen, dass es sich um den «Otto Carisch» von 1836 handelt, eine unserer ersten Wörtersammlungen, eine Art Wörterbuch. In diesem sind die Wörter nicht, wie wir es uns gewohnt sind, alphabetisch geordnet, sondern nach der Bibel. Es beginnt mit Gott – Dio – Deus – Dieu, dann folgt all das, was Gott erschaffen hat: die Welt – il mondo – il mund – il muond // der Himmel – il cielo – il tschiel – il cel, darauf folgt die Sonne, dann Stern, Luft und Wind. Als zweites Thema kommt, wie könnte es besser zu uns passen, all das, was mit verwandtschaft zu tun hat: der Vater – il padre –
il bab, Grossvater, Urgrossvater, Mutter usw. Als drittes folgt das, was mit schule zu tun hat, als viertes die körperteile, dann die kleidung und so weiter. Dieses kleine Büchlein ist mein Lieblingsbuch. Es steht etwas verloren neben dem «Dictionar da Tasca» von Conradi, der Humboldt gewidmet ist, steht etwas beschädigt neben meinen anderen Wörterbüchern, ein Vagant neben dem Giganten drg, unserem Grimm, dankbar, dass ich es vor dem Ende bewahrt habe. Habent sua fata libelli. Ach, könnten sie nur ausführlich erzählen, wer sie besessen hat, in welchen Händen sie gewesen sind, wie sie behandelt wurden, aus welchen Regalen sie hinuntergeschaut haben, auf wen und in welchen Stuben. Dem Bergler, der zwischen Steinen und Felsen lebt, kommt manchmal der Gedanke: wenn nur die Steine erzählen könnten. Wohl weil sie so steinalt sind und viel gesehen haben und viel zu sagen hätten, aber die Steine stehen da und schweigen. Versteinerte Archive. Unterhalb des Péz Miezdi ob der Terrihütte liegt meine liebste Geröllhalde. Ein Geologe, der mit seinem Hammer umherging und die Felsen abklopfte, hat mir einmal gesagt, dass die Steine dieser roten Geröllhalde eine Milliarde Jahre alt seien. Das sind mehr Jahre, als es Steine in der Halde gibt.
Die Steine der Wörterbücher sind die Wörter. Der Maurer gibt sich mit Steinen ab, das Kind mit Legos, der Dichter mit Wörtern. Wörter sind das Material, das er zum Bauen braucht, Bausteine. Die Kunst des Dichters ist die, sie richtig abzulegen. Auch die Kunst des Wörterbuchs ist das richtige Ablegen. «Richtig» bedeutet hier, dass man die Wörter findet. Dies ist der Zweck eines Wörterbuchs. Die weltlichen Wörterbücher sind nicht mehr so geordnet, wie Gott Himmel und Erde und all das, was damit verbunden ist, erschaffen hat, sondern danach, wie das Kleinkind beginnt, die Buchstaben zu gebrauchen. Zuerst kann es das A sagen, dann kommt bald Ba und so weiter und so fort bis zu den komplizierten X, Y und Z, die das Kind vielleicht erst mit zehn Jahren oder mehr richtig aussprechen kann. Das Kind, das antiabecedarian (Joyce) per se, als Erfinder des Alphabets, das uns aus dem Chaos führt! Wer von Natur aus chaotisch ist, erfindet ein geniales System um aufzuräumen. Schrecklich die Vorstellung, meine einfallsreichen Kinder nähmen das Alphabet aus meinen Wörterbüchern und stellten sie auf den Kopf und schüttelten sie, dass die fett gedruckten Wörter und die normalen und die kursiven und die Striche, Tilden, eckige und runde Klammern und Pfeile an die Wand geworfen würden wie die Legos in einer Schachtel.
Ich traue dem Alphabet einigermassen, aber wenn es sich eines Tages aus den Wörterbüchern davonmachen würde? – Dann hätte ich als Trost das nach der Schöpfung geordnete Wörterbuch!
Meine alten Bücher habe ich auf dem Büchergestell nach ihren Biografien geordnet. Nicht umsonst stehen mein Carisch und mein Conradi nebeneinander. Dass beides Wörterbücher sind und die Namen ihrer Autoren beide mit «C» beginnen, ist purer Zufall.
Mein Conradi stammt aus der Bibliothek von Guglielm Gadola, im Volk bekannt als Autor von «Paul Luziet», dem rätischen Eulenspiegel, auch bekannt als Redaktor des Volkskalenders «Il Glogn» («Der Glenner»), erschienen von 1927 bis 1953. In diesem Kalender hat Gadola unsere Kultur, Literatur und Geschichte archiviert. Die Reihe der Kalender «Il Glogn» ist wie eine Kristallkluft, und wenn man sie öffnet, ist Guglielm Gadola allgegenwärtig. Er steht von den Toten auf, wenn man seine Kalender öffnet und mit ihnen öffnet sich eine Welt.
Einmal habe ich in der Zeitung darüber geschrieben, wie ich den Carisch in einem Container gefunden hatte und wem er gehörte. Es ist dann einige Zeit vergangen und eines Tages hat sich eine 85-jährige Frau gemeldet. Sie begann von Martin Schwarz aus Madernal zu erzählen, der ihr Vorfahre gewesen sei. Ich dachte mir, dass sie das Buch zurückhaben wolle, aber sie redete nur vom Martin, der ein richtiges Original gewesen sei und irgendwo in einem «Glogn» sei über den Martin Schwarz geschrieben worden, aber einiges sei erfunden. Und so, nachdem ich die Verzeichnisse der «Glogns» durchforstet hatte, ist der Martin von den Toten auferstanden.3 Ich weiss jetzt, dass er schwarze Haare und blaue Augen hatte, weiss, dass er an Werktagen einen Kittel aus Drillich und sonntags einen Tschopen aus Samt anhatte. Er hatte zwei Kühe und stellte Schlitten her. Ich weiss, dass er am Sonntag seinen reservierten Platz neben dem Weihwasserbecken in der Pfarrkirche Sogn Gions hatte, und weiss, wie er sich einmal krankärgerte, sodass er gelb wurde und starb. Diese kurze Biografie von Martin Schwarz ist mit einer Hexengeschichte verbunden, sodass es keine Hexerei ist zu erkennen, was davon erfunden ist. Jedes Mal wenn ich das zerfledderte Wörterbuch öffne, steht der Martin vor mir, lebendig und putzmunter. Wegen der Verbindung zu Gadola sind also diese beiden Wörterbücher bei mir nebeneinander aufgereiht. Dies ist mein privates Archivierungssystem. Ein Archiv hat für mich mit Reihen zu tun. Etwas nach einem bestimmten System in Reih und Glied stellen, mit dem Ziel, dass man es so leicht wie möglich wiederfindet. Reihen bedeuten Ordnung, Struktur, Kontrolle, Magie.
Die ersten Reihen draussen im Leben, in die wir selbst magisch hineingezwängt wurden wie Bücher, waren die Bänke in der Kirche. Die erste Klasse sass in der ersten Bank, die zweite in der zweiten Bank, die dritte in der dritten Bank und so weiter bis zu den Grossen. Dann kamen die Burschen, dann etwas ungeordnet die Erwachsenen, dann unter der Empore die Alten und zuhinterst bei den Säulen und auf der Treppe die Ungläubigen. Der Gang in der Mitte trennte die beiden Geschlechter: Männer und Frauen, die sich wiederum aufteilten von vorne nach hinten in kleine und grosse Mädchen, verheiratete Frauen und alte Jungfern, Grossmütter und Greisinnen. Ab der Mitte nach hinten war die Ordnung nicht mehr so klar. Aber je weiter nach vorne man schaute, je unschuldiger erschien es und je strukturierter war es. Die absolute Ordnung auf und vor dem Altar. Dort war alles klar.
Auch die Ohren machten Bekanntschaft mit magischen Reihen: Einmal im Jahr erklang von der Kanzel das Totenregister, Ketten von Namen, die sich in Verwandtschaften verzweigten. Häufiger wurden die ewigen Heiligenlitaneien rezitiert, jeder Heilige mit angehängtem «ora pro nobis», immer in der gleichen Melodie gesungen. Während der Rosenkränze und neuntägigen Andachten erklangen aus den Reihen der Bänke Reihen von Seufzern, Vaterunser und Avemaria nach den Geheimnissen des Rosenkranzes geordnet. Es sind dies Reihen von Tönen, wellenförmige Monotonie.
Auf dem Deckengewölbe über den Köpfen der Gläubigen und Halbgläubigen glänzte die Pracht der Engel, diesem Gemurmel gegenüber eher gleichgültig, von denen ich später in den Archiven der Heiligen Katholischen Kirche die ungeheuren Kataloge gesehen habe, wie sie in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden und nicht aus dem Staunen gekommen bin, welche Unmengen von Engeln es gibt, mit welch langen Namenreihen, die man sich nicht merken kann. Abdizuel, Abriel, Adan, Adnachiel, Adonael, Adriel, Ahayah … dies ist erst ein Hundertstel der Namen auf A. Wer wäre imstande, diese schrecklichen Namensstränge der Engel bis zu den letzten Zetachiel, Ziquiel, Zoeniel, Zuriel, Zutiel, Zymeloz auswendig zu lernen? Da möchte ich schon eher die Liste der 126 Teufel empfehlen, die einen um einiges kürzeren Schwanz hat.
Aber die verrückteste Liste, die versteckteste, närrischste und am unmöglichsten zu archivieren, findet sich im berühmten Kapitel i.8 des «Finnegans Wake» mit dem Titel Anna Livia Plurabelle. Um einen Eindruck des gurgelnden Flusses Liffey zu vermitteln, hat James Joyce den Text mit 126 Flussnamen aus allen Ecken der Welt überflutet. Derjenige, der sich abmüht, all diese Flüsse zu identifizieren und ins Rheine zu bringen, versinkt im Sumpf, der Text beginnt zu bocken, die Wörter spielen, spielen Verstecken, werden flüssig, fliessen durch die Finger, kopulieren und nach einer Weile sind mehr Namen da, als der Autor einschliesslich des Gefolges an Literaturwissenschaftlern sich in ihre Schädel gestopft haben, und wenn die Übersetzer noch zu planschen anfangen mit der Anna Livia Plurabelle, beginnen die Wörter zu brodeln, die babylonische Verwirrung wird göttlich und die Archivare können einpacken. Was? – Ihr kennt Anna Livia, die Wäscherin nicht? O tell me all about Anna Livia! I want to hear all about Anna Livia. «Na, ihr kennt Anna Livia? Aber ja, wir alle kennen Anna Livia. Sag mir alles. Sag es mir gleich. Du kugelst dich, wenn du’s hörst. Na, du weisst, als der alte Kjärl fehltrat und tat, was du weisst. Ja, weiter, das weiss ich. Etsch los und spree mich nicht an. Krempel hoch, lass die Redseele locker. Und steiss mich nicht – halt! – wenn du riffelst. Oder was das wohl war, was die Drei sich erdachten, was den Zweien er tat, da im Viechspark. Durchtriebener Schurke! Guck mal das Hemd auf ihm! Guck mal den Dreck an dem! Al main Wasser verpasst er mir schwarz. Und geweicht und gewindelt seit heut vor ner Wanne. Weiss nicht, wie oft er’s getrübt hat, seit letzter Wash. Ausfindig wüsst ich die Orbe, wo er sich sulmt, der ddreckige Deibel.»4
Kürzlich habe ich eine Mulde aus einem Buch genommen. Niemand mache hier Ordnung. Auf dem Buchdeckel stand geschrieben: alp. Artis Litterarumque Patrona.
Oh du Buch, dein Besitzer ist schon lange tot, wohin?
An den Inn.
Aus dem Rätoromanischen von Elisabeth Peyer und Renzo Caduff