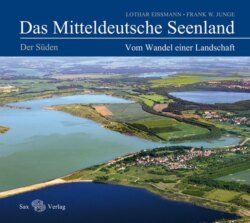Читать книгу Das Mitteldeutsche Seenland. Vom Wandel einer Landschaft - Lothar Eißmann - Страница 9
Werden und Vergehen in Jahrmillionen
ОглавлениеVerstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man es vorwärts.
Sören Kierkegaard
In Bezug auf die ältere Erdgeschichte könnte man die Region südlich der Großstadt Leipzig und damit das Seengebiet als »Raum der verlorengegangenen Zeiten« apostrophieren. Zwar ist die Zeit ewig, ohne Anfang und Ende, wohl aber können die Zeugen einer bestimmten Zeitspanne zumindest regional vollständig ausgelöscht sein. Und das ist hier über Hunderte von Millionen Jahren der Fall.
Das geologische Fundament der Region aus Gesteinen der Erdfrühzeit und aus dem Erdaltertum, das schon mit 100 m tiefen Bohrungen zu erreichen ist und in den Jahrzehnten der geöffneten Erde am Grunde der Tagebaue in Gestalt von Kaolinbergen ans Licht trat, besteht aus einer 1000 bis 2000 m mächtigen Schichtenfolge aus Grauwacken, sandsteinartigen Gesteinen, und stark verfestigten Ton- und Schluffsteinen. Erstere bilden bis über 1 m mächtige feste Bänke, jene zentimeter- bis dezimeterstarken Platten. Sie sind intensiv gefaltet und stehen oft schräg bis senkrecht. Es sind sogenannte Flyschsedimente, d. h. während gebirgsbildender Bewegungen aus Trübeströmen im Gefolge meist großer subaquatischer Rutschungen auf dem Meeresboden abgesetzte feinkörnige Schichten aus oft eckigen Bestandteilen. Ihr Alter ist riphäisch bzw. wendisch; sie gehören also zum Proterozoikum oder Algenzeitalter. Damit sind sie älter als 570 Mio. Jahre und können auf rund 600 Mio. Jahre geschätzt werden. Bis auf winzige Flitterchen aus Graphit, Hinterlassenschaften von Algen, sind sie fossilfrei. Erstmals gefaltet wurden diese Schichten wahrscheinlich in der Cadomischen Gebirgsbildungszeit am Ende des Proterozoikums. Vor rund 550 Mio. Jahren, im tieferen Zeitalter des Kambriums, drangen im nordwestlichen Sachsen saure Magmen in das Grauwackengebirge ein und erstarrten zu mächtigen Granodioritkörpern, granitartigen Gesteinen. Sie wurden unter Markkleeberg-West bis Leipzig-Lößnig und weiter nach Nordosten bis Leipzig-Stötteritz erbohrt und sind Teil des granitischen Fundamentes, das den tieferen Untergrund Nordwestsachsens über große Flächen aufbaut.
Und nun die »ältere verlorengegangene Zeit«. Es besteht guter Grund zu der Annahme, dass das gefaltete und durch Granite versteifte Grauwackengebirge im Kambrium wieder zu sinken begann und die Senke in einem Zeitraum von rund 300 Mio. Jahren mit weit über 1000 m mächtigen marinen Schichten des Kambriums, Ordoviziums, Silurs, Devons und Unterkarbons gefüllt wurde. In der im Grenzzeitraum Unterkarbon/Oberkarbon liegenden sudetischen Phase der mitteleuropäischen varistischen Gebirgsbildung (Steinkohlengebirge) erfolgte eine intensive Faltung dieser Schichten, danach ihre Zerblockung und Heraushebung und schließlich Abtragung bis in das Fundament aus Grauwacke und Granit. In der Umrandung des aufgestiegenen Blocks blieben gleichalte Schichten flächenhaft oder punktförmig erhalten. Nächstjüngere Hinterlassenschaften der Erdgeschichte der Region existieren erst wieder aus der Oberkarbonzeit, dem Westfal und Stefan, d. h. aus einer Zeit von vor rund 290 bis 310 Mio. Jahren. Es sind rot und braun gefärbte verfestigte Kiese, Sand-, Ton- und Schluffsteine, die eine steinkohlenzeitliche Flora führen. Sie kommen erst westlich der Weißen Elster vor, wo sie mehrfach erbohrt wurden und im Westen der Stadt Leipzig, z. B. am Lindenauer Hafen, auch zutage treten.
Im jüngsten Abschnitt des Erdaltertums, dem oberen Perm oder Zechstein, wurde im Zusammenhang mit einer großen Meeresüberflutung Nordwest- und Mitteleuropas der gesamte Leipziger Raum bis in die Gegend von Zwickau und Gera vom Meer bedeckt. Die südlich der Linie Kitzen – Rötha – Lausick hinterlassene Schichtenfolge mit mächtigen Karbonaten, vor allem Dolomit, und Sulfatgesteinen (Anhydrit und Gips) erlangte später für die Braunkohlenbildung Bedeutung. Sie kennzeichnet insbesondere den Untergrund der braunkohlenführenden Formation des südlichen Leipziger Seenlandes mit ihren schon abgebauten bzw. gegenwärtig regional noch in Abbau stehenden Kohlefeldern (Tagebaue Schleenhain, Profen-Schwerzau) zwischen Groitzsch, Borna, Altenburg, Meuselwitz und Profen.
Auch Schichten des folgenden Erdmittelalters, insbesondere der Trias mit Buntsandstein und Muschelkalk, kamen auf der Nordwestsächsischen Hochscholle um Leipzig zum Absatz. Nachdem dieses Tafelgebirge in der höheren Kreidezeit weitspannig gefaltet und an Störungen in Schollen zerlegt worden war, erfolgte wie 200 Mio. Jahre vorher in der Steinkohlenzeit eine erneute Heraushebung des Gebietes und eine damit verbundene Abtragung der über 500 m mächtigen Deckgebirgsschichten. Ein zweites Mal wurde das Grundgebirge freigelegt. Es ist die zweite, jüngere Periode der »verlorengegangenen Zeit«. In dem durch tropisch-humide Klimabedingungen gekennzeichneten und tektonisch beruhigten Abschnitt der höchsten Kreidezeit und des älteren Tertiärs unterlag das alte Gebirge einer intensiven chemischen Verwitterung. Durch Wegführung von etwas Kieselsäure und aller Alkalien bildete sich Kaolin oder Porzellanerde. Besonders betroffen wurden die granitischen Gesteine und die Grauwacke. Aber auch die vulkanischen Gesteine des Unterrotliegenden, die unmittelbar östlich von Leipzig, bei Taucha, bis an die Oberfläche reichen und im Nordwestsächsischen Vulkanitbecken zwischen Rochlitz und Lucka im Süden und Eilenburg – Grimma – Wurzen – Oschatz eine flächenhafte Verbreitung erlangen, sind von einer Kaolindecke überzogen. Die Porzellanerdeschicht zwischen Leipzig und dem Auftauchen der Felsen bei Hainichen und Otterwisch besitzt eine Mächtigkeit von durchschnittlich 15 bis 35 m, maximal von 85 m, wie durch zahlreiche Bohrungen nachgewiesen ist. Wo das zersetzte alte Gebirge höher aufragt, wurde es in Form sogenannter Ton- oder Kaolinrücken in den Braunkohletagebauen von den Baggern angeschnitten und im Bereich der Förderbrücke bis zum Übergang in festes Gestein sogar durchschnitten. Es handelt sich bei den Hügeln um Reste von Inselbergen, die wie in Ost- und Südafrika unter subtropischen Bedingungen entstanden sind und die Landschaft schwarmweise wenige Dekameter, vereinzelt 50 m bis über 100 m überragten.
Kollektion von Gesteinen des geologischen Fundaments Nordwestsachsens: Granit von Leipzig-Lößnig (Bildmitte), Pyroxensyenit von Reudnitz bei Dahlen (unten) und dichte und geschichtete Grauwacke von Leipzig-Plagwitz.
Kohlemoore und Urnordsee in der Leipziger Bucht
Braunkohlenzeit (Tertiär)
Vor rund 50 Mio. Jahren, im frühen bis mittleren Eozän, war das Land vor allem durch weiträumige endogene Bewegungen so tief abgesenkt, dass die Inselberglandschaft in Fluss- und Seesedimenten zu ertrinken begann. Die südlichen Gebirge existierten noch nicht, das Einzugsgebiet der Flüsse reichte bis in das Gebiet des heutigen Böhmen. Auch Flüsse aus Thüringen und Nordostbayern nahmen ihren Weg durch die Leipziger Bucht. Die östlichen Fließgewässer (»Zwickauer Fluss«) wandten sich zwischen Leipzig und Groitzsch nach Nordwesten bis Westen, vereinigten sich mit den von Südwesten kommenden Flüssen, um über das Gebiet zwischen Lützen und Mücheln in das Norddeutsche Senkungsgebiet abzufließen. Die Zeit der zunächst örtlichen, dann flächenhaften Vermoorung mit der Bildung von Torf, aus dem sich durch Inkohlungsprozesse die Braunkohle entwickelte, begann noch im Mitteleozän vor rund 50 Mio. Jahren. Die bis 100 m mächtigen Flöze des Geiseltals westlich von Merseburg sind die ältesten abbauwürdigen der Region. Das Sächsisch-Thüringische Unterflöz ist der älteste flächenhaft verbreitete Kohlekörper der Leipziger Bucht und eine der Hauptadern der Kohlegewinnung in ihrem südlichen Teil zwischen Neukieritzsch, Lucka und Profen (Tagebaue Schleenhain, Groitzscher Dreieck, Profen) und den südlichsten ehemaligen Kohlegewinnungsstätten bis Teuchern, Zeitz, Meuselwitz und Altenburg. Doch erreicht diese Flözfolge längst nicht die Ausdehnung des obereozänen Bornaer-Thüringer Hauptflözes (II/III) und unteroligozänen Böhlener Oberflözes, die in den Tagebauen Zwenkau, Cospuden und Espenhain und in jenen um Borna (Tagebaue Witznitz, Bockwitz) gewonnen wurden und die bis in das nördliche Stadtgebiet von Leipzig weiterziehen, wobei die Mächtigkeit des Bornaer Hauptflözes stark ab-, die des Böhlener Oberflözes bis in den Süden Leipzigs zunimmt. Unter dem Augustusplatz besitzt das Bornaer Flöz nur noch eine Stärke von rund 1 m, das Böhlener Flöz hingegen 12 m, bei einem trennenden Ton von rund 1 m Mächtigkeit.
Aufrechtstehender Baumstubben im gebänderten Bornaer Hauptflöz (Flöz II) des Tagebaues Schleenhain. 2001.
Noch vor der Moorbildung des Böhlener Oberflözes drang die tertiäre Nordsee zum ersten Male in einer flachen, durch schmale Landzungen gegliederten Bucht mit Lagunen hinter den Stränden in die mittlere Leipziger Bucht bis in die Gegend südlich von Markkleeberg und südlich von Pegau vor. Während des Meeresrückzuges setzte die Moorbildung des Böhlener Oberflözes ein, die bis zum Zeitpunkt einer erneuten Meeresüberflutung fast ohne Unterbrechung weiterging. In zwei Überflutungsphasen schob sich das mindestens 50 m tiefe Meer bis Zeitz, vielleicht bis Gera nach Süden vor. Es kamen die überwiegend aus Feinsanden, im mittleren Teil aus Schluff und Ton bestehenden unteroligozänen Böhlener Schichten zum Absatz. Sie bilden in der Leipziger Bucht die Hauptfundschicht von Moostierchen, Armfüßern, Muscheln, Schnecken, Krebstieren, Stachelhäutern, Fischen (Knorpel- und Knochenfischen), Reptilien (Krokodile, Schildkröten), Vögeln und Säugetieren, darunter Resten von eingeschwemmten Landsäugern wie Nashorn, Tapir und Schreckschwein, sowie Grab- und Wühlgefügen von Würmern, Mollusken, Seeigeln und Krabben. Das Landschaftsbild dieser Zeit war geprägt von breiten, weichen Sandstränden, die von Dünen überragt wurden. Lagunen oder kleine Haffseen im Hinterland, Schilfgürtel und Mangrovenwälder in Buchten vervollkommneten das Bild der anmutig-stillen Küstenszenerie an den südlichsten Gestaden der oligozänen Urnordsee in Mitteleuropa, in der Bucht von Leipzig.
Die sicher braunkohlenzeitliche Folge in der weiteren Umgebung von Leipzig schließt ab mit Sanden, Kiesen und Tonen der oberoligozänen Thierbacher Schichten und hellen Tonen, glimmerreichen Sanden mit Relikten eines unreinen Braunkohlenflözes des unteren Miozäns (Bitterfelder Schichten).
Die ältesten Meeressedimente der tertiären Urnordsee in der südlichen Leipziger Bucht. Die bis mehr als 30 m mächtige, weiß-gelb, gelbbraun bis schwarz gefärbte, durch Grabgänge (Bioturbation), durch Anreicherung von Schwermineralen und Verkieselungen (Tertiärquarzite) charakterisierte Schluff-Sand-Abfolge der Domsener Schichten im Liegenden des Böhlener Oberflözes zählt zu den geologisch interessantesten und rätselhaftesten Sedimenten des Tagebaues Profen. 1993.
Flussschotter und Gletscherablagerungen
Eiszeit und Nacheiszeit (Quartär)
Nach der Braunkohlenzeit schnitten sich die Flüsse mit Unterbrechungen durch Schotterüberfrachtung während der Kaltzeiten bis 40 m in die braunkohlenzeitlichen Schichten ein. Während dieser Halte wurden in bis 15 km breiten Tälern 6 bis 12 m mächtige Flussschotter abgesetzt. Ein bemerkenswertes Tal aus dieser Zeit zieht in 25 bis 35 m Tiefe südöstlich von Leipzig, von Grimma bzw. Borna kommend, über Wachau nach Leipzig-Connewitz. Es wurde von der Wyhra, einem Arm der Zwickauer Mulde und dem heute nicht mehr existierenden Großpösnaer Fluss, angelegt. Diese Gewässer vereinigten sich in der inneren Südstadt Leipzigs mit der aus dem Weißenfels – Lützener Gebiet zuströmenden Saale und der ihr tributären Weißen Elster, die ihren Weg über das Gebiet der Tagebaue Profen, Zwenkau, Cospuden und Espenhain genommen hatte. Das elstereiszeitliche Inlandeis stieß, einen großen Stausee vor sich her schiebend, zweimal über den Leipziger Raum bis in die Gegend von Zwickau bzw. Altenburg vor. Die zurückgelassenen Sedimente sind in Form von Grundmoränen (Geschiebemergeln), Schmelzwassersanden und Seeablagerungen (Bändertone), darunter die des großen Wachauer Sees, vor allem in dem vom Tagebau Espenhain (Restloch Störmthal) erschlossenen fossilen Tal südöstlich von Leipzig und im frühelstereiszeitlichen Saale-Weißelster-Tal um Knautnaundorf erhalten. Bemerkenswert ist der Befund, dass während des Zerfalls des elstereiszeitlichen Inlandeises die Zwickauer Mulde mit der Zschopau und wohl Armen der Freiberger Mulde aus der Gegend von Grimma kommend in Richtung des Göseltales, über Gaschwitz und Leipzig-Windorf und -Plagwitz das unmittelbar südlich an Leipzig angrenzende Gebiet in nordwestlicher Richtung querte. Aus der Holsteinwarmzeit sind im Umfeld der Großstadt Leipzig einige Sedimentvorkommen bekannt, nämlich die von Gaschwitz, Seehausen und Jesewitz bei Taucha. Die große Abkühlung der Saaleeiszeit führte zur Aufschüttung eines mächtigen Schotterkörpers der Gösel, Pleiße und westlich der Weißelsteraue der Weißen Elster. Es entstand die durch ihre reichen alt- und mittelpaläolithischen Artefaktfunde um Markkleeberg und Eythra – Knautnaundorf berühmt gewordene Hauptterrasse. Das Inlandeis der Saaleeiszeit staute wiederum einen bedeutenden Glazialsee in den Tälern auf, in dem sich der Böhlener Bänderton absetzte. Es überfuhr diese Region zweimal. In der ersten Vereisungsphase drang es bis in die Gegend von Altenburg und Zeitz, in der zweiten mindestens bis in das Göselgebiet bei Magdeborn vor. Zwischen den Vorstößen kam hier ein durchschnittlich 2 m, maximal 4 bis 5 m mächtiges Seesediment, der Bruckdorf-Böhlener Bänderton, zum Absatz.
Aus der folgenden Warmzeit, dem Eeminterglazial, sind nur außerhalb der beschriebenen Region Sedimente bekannt; genannt seien die von Grabschütz und Rabutz nördlich von Schkeuditz. In der Weichseleiszeit entstanden in der Weißelster- und Pleiße-Gösel-Aue bis 8 m mächtige Flussschotter. Auf den Hochflächen und Talhängen wurden ein 0,5 bis maximal 1,5 m mächtiger Sandlöß und sandiger Löß, südlich Weißenfels – Pegau – Borna bis über 5 m Löß, von Winden aufgeweht, die vom weichseleiszeitlichen Inlandeis in Brandenburg und Mecklenburg als Fallwinde nach Süden strömten. In der erdgeschichtlichen Gegenwart, dem Holozän, setzten die Flüsse in den heutigen Tälern geringmächtige Schotter und seit der beginnenden Jungsteinzeit vor ca. 7000 Jahren (Bandkeramik) zunächst geringmächtige, seit dem Hochmittelalter um 1200 n. Chr. die ganze Breite der Auen überziehende 2 bis 4 m starke Auelehme ab. In den Flussablagerungen dieser Zeit fanden sich mehrere tausend Stämme, Stubben und Äste der Eiche, die um 8500 v. Chr. hier wieder Fuß fasste. Zahlreiche archäologische Befunde in den holozänen Auensedimenten zeigen, dass der Mensch in den Talauen der Leipziger Bucht mindestens seit der Jungsteinzeit (ca. 5500 bis 2000 v. Chr.) mit ihren in den Keramiken erkennbaren verschiedenen Kulturstufen durchgängig sesshaft ist.
Die Sedimentabfolge der Elstereiszeit im Zentralteil der Leipziger Bucht. Über schräg geschichteten Flusssanden liegt das älteste westund mitteleuropäische Gletscherseesediment des quartären Eiszeitalters, der Dehlitz-Leipziger Bänderton mit seiner typischen Wechsellagerung aus dunklen im Eiszeitwinter und hellen im Eiszeitsommer abgesetzten Schichten. Darüber lagert das vom Inlandeis hinterlassene Gletschersediment, der Geschiebemergel der Elstereiszeit. Tagebau Schleenhain. 1993.
Freigelegtes Grab aus der Jungsteinzeit bis Frühbronzezeit (ca. 2600 bis 2200 v. Chr.). Archäologische Grabung »Pätschenberg« im Aufschlussfeld des Tagebaues ProfenSchwerzau. 2009.
Die vier Seengenerationen der letzten 500000 Jahre im östlichen Norddeutschen Tiefland in generalisierter Schnitt- und Kartendarstellung.
1 Elstereiszeitliche Seenformation (Rinnen)
2 Saaleeiszeitliche Seenformation, z. B. Lausitzer Urstromtal (Ältere Folge), Heidesande
3 Weichseleiszeitliche Seenformation (15000–12000 v. Chr.) verdeckt: z. B. Baruther Urstromtal, offen: z. B. Mecklenburger Seenplatte, Eberswalder Urstromtal
4 von Menschenhand geschaffene Bergbauseen, Teichlandschaften, Steinbrüche (seit rund 500 Jahren).