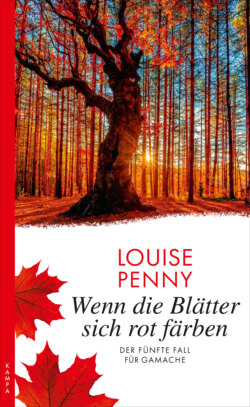Читать книгу Wenn die Blätter sich rot färben - Louise Penny - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеNachdem die drei Sûreté-Beamten sich verabschiedet hatten, gingen sie über den Dorfanger. Es war elf Uhr und stockfinster. Lacoste und Gamache blieben stehen, um den Nachthimmel zu betrachten. Beauvoir, der wie immer ein paar Schritte vorausging, merkte schließlich, dass ihm niemand mehr folgte, und blieb ebenfalls stehen. Widerwillig blickte er nach oben und war überrascht von den vielen Sternen. Er musste wieder an Ruth’ Abschiedsworte denken.
»›Jean-Guy‹ und ›Idiotie‹ reimt sich, oder?«
Ihm schwante Böses.
In diesem Moment ging im Loft über Myrnas Buchladen das Licht an. Sie konnten sehen, wie sie herumging, sich Tee einschenkte, Kekse auf einen Teller legte. Dann ging das Licht wieder aus. »Wir haben sie Tee eingießen und Kekse auf einen Teller legen sehen«, sagte Beauvoir.
Die beiden anderen fragten sich, warum er ihnen erklärte, was sie gerade selbst gesehen hatten.
»Es ist dunkel. Um im Haus irgendwas zu machen, braucht man Licht«, sagte Beauvoir.
Gamache dachte noch darüber nach, was er ihnen mit dieser weltbewegenden Neuigkeit sagen wollte, als bei Lacoste der Groschen fiel.
»Gestern Nacht im Bistro. Hätte der Mörder nicht das Licht einschalten müssen? Und wenn es so war, hätte es dann nicht jemand gesehen?«
Gamache lächelte. Sie hatten recht. Wenn im Bistro Licht gebrannt hätte, wäre das bestimmt bemerkt worden.
Er sah sich um, um festzustellen, von welchen Fenstern aus man am ehesten etwas gesehen hätte. Die Häuser bildeten jedoch eine Art Halbkreis mit dem Bistro. Freie Sicht darauf hatte man nur von gegenüber. Er drehte sich um. Dort auf dem Dorfanger standen die drei majestätischen Kiefern. Sie hatten mit angesehen, wie ein Mensch einem anderen das Leben nahm. Aber es gab noch etwas anderes, das gegenüber dem Bistro lag. Gegenüber und oberhalb.
Das alte Hadley-Haus. Es stand zwar ein Stück entfernt, aber wenn in dieser Nacht im Bistro Licht gebrannt hatte, könnten die neuen Besitzer Zeugen eines Mordes geworden sein.
»Es gibt noch eine andere Möglichkeit«, sagte Lacoste. »Nämlich, dass der Mörder kein Licht angemacht hat. Weil er wusste, dass man ihn sehen könnte.«
»Sie meinen, er hat eine Taschenlampe benutzt?«, fragte Beauvoir und stellte sich vor, wie der Mörder in der vergangenen Nacht da drin auf sein Opfer gewartet und sich mit einer Taschenlampe orientiert hatte.
Lacoste schüttelte den Kopf. »Nein, auch das hätte man von außen gesehen. Ich denke, dass er nicht mal dieses Risiko eingegangen wäre.«
»Also hat er überhaupt kein Licht gemacht«, sagte Gamache, dem klar war, worauf sie hinauswollte. »Weil er keins gebraucht hat. Weil er sich im Dunkeln zurechtfand.«
Der nächste Morgen dämmerte klar und frisch herauf. In der Sonne war es warm, und als Gamache vor dem Frühstück um den Dorfanger lief, zog er schon bald seinen Pullover aus. Einige Kinder, die vor ihren Eltern und Großeltern aufgestanden waren, jagten im Teich noch nach ein paar Fröschen. Sie schenkten ihm keine Beachtung, und eine Weile sah er ihnen aus einiger Entfernung lächelnd zu, bevor er seinen einsamen, friedlichen Spaziergang fortsetzte. Er winkte Myrna zu, die auf ihrem einsamen Spaziergang den Hügel erklomm.
Es war der letzte Tag der Sommerferien, und auch wenn seine Schulzeit Jahrzehnte zurücklag, spürte er immer noch dieses Ziehen. Die Mischung aus Traurigkeit über das Ende des Sommers und Vorfreude auf das Wiedersehen mit seinen Freunden. Die neuen Hosen und Pullover, weil er im Sommer gewachsen war. Die neuen Stifte, perfekt gespitzt, und der Geruch der Spitzerspäne. Und die neuen Hefte. Jedes Mal wieder seltsam aufregend. Makellos. Noch ohne Fehler. Sie enthielten nichts außer Versprechen und Möglichkeiten.
Eine neue Mordermittlung fühlte sich ganz ähnlich an. Hatten sie ihr Heft bereits vollgekleckst? Fehler gemacht?
Während er langsam den Dorfanger umrundete, die Hände hinter dem Rücken verschränkt und den Blick in die Ferne gerichtet, dachte er darüber nach. Nach mehreren gemächlichen Runden kehrte er zum Frühstück in die Pension zurück.
Beauvoir und Lacoste waren bereits unten und hatten jeder einen Café au Lait vor sich stehen. Als er den Raum betrat, erhoben sie sich, und er forderte sie mit einer Geste auf, sich wieder zu setzen. Aus der Küche kam der Geruch von Speck und Eiern und Kaffee. Er saß noch nicht richtig, als Gabri mit Eiern Benedict, Obst und Muffins durch die Schwingtür trat.
»Olivier ist gerade rüber ins Bistro. Er weiß noch nicht, ob er heute aufmacht«, sagte der große Mann, der an diesem Morgen große Ähnlichkeit mit Julia Child hatte. »Mal sehen. Ich habe ihm jedenfalls zugeredet. Sonst verliert er Geld, habe ich ihm erklärt. Normalerweise wirkt das. Muffin?«
»S’il vous plaît«, sagte Lacoste und nahm sich einen. Sie sahen wie kleine Atompilze aus. Isabelle Lacoste vermisste ihre Kinder und ihren Mann. Aber zu ihrem Erstaunen konnte dieses kleine Dorf offenbar sogar eine solche Lücke füllen. Wobei sich natürlich jedes Loch schließen ließ, wenn man genug Muffins hineinstopfte, zumindest für eine Weile. Sie war gewillt, es zu versuchen.
Gabri brachte Gamache seinen Café au Lait, und als er wieder weg war, beugte Beauvoir sich vor.
»Wie sieht der Plan für heute aus, Chief?«
»Wir brauchen Hintergrundinformationen. Ich will alles über Olivier wissen, und ich will auch wissen, wer etwas gegen ihn haben könnte.«
»D’accord«, sagte Lacoste.
»Und die Parras. Ziehen Sie Erkundigungen ein, hier und in der Tschechischen Republik.«
»Wird erledigt«, sagte Beauvoir. »Und Sie?«
»Ich habe eine Verabredung mit einem alten Freund.«
Armand Gamache erklomm den Hügel hinter Three Pines. Er hatte sein Tweedjackett über den Arm gelegt und stieß mit dem Fuß eine Kastanie vor sich her. Die Luft war erfüllt vom Duft der Äpfel, die süß und prall an den Bäumen hingen. Die Gärten standen in voller Pracht, aber schon in wenigen Wochen würde ein mörderischer Frost einsetzen. Und alles wäre tot.
Das alte Hadley-Haus wurde immer größer, je näher er ihm kam. Innerlich wappnete er sich. Bereitete sich auf das Leid vor, das es ausstrahlte, jeden erfasste, in jeden eindrang, der dumm genug war, sich ihm zu nähern.
Aber entweder funktionierten seine Abwehrmechanismen besser, als er erwartet hatte, oder es hatte sich etwas verändert.
An einem sonnenbeschienenen Fleck blieb Gamache stehen und musterte das Haus. Ein riesiger viktorianischer Kasten mit Türmchen, schuppenartigen Schindeln, ausladenden Balkonen und schmiedeeisernen schwarzen Geländern. Der frische Anstrich glänzte in der Sonne, und die Eingangstür leuchtete in einem fröhlichen Rot. Nicht blutrot, sondern weihnachtlich rot. Wie Kirschen. Und knackige Herbstäpfel. Der Weg war vom Brombeergestrüpp befreit und neu gepflastert worden. Gamache sah, dass jemand die Hecken und Bäume beschnitten und alles Abgestorbene entfernt hatte. Roar Parras Werk.
Plötzlich merkte er zu seiner eigenen Überraschung, dass er mit einem Lächeln vor dem alten Hadley-Haus stand. Und sich tatsächlich darauf freute hineinzugehen.
Die Tür wurde von einer Frau Mitte siebzig geöffnet.
»Ja?«
Ihre stahlgrauen Haare waren zu einer schicken Frisur geschnitten. Sie trug kaum Make-up, hatte nur leicht ihre Augen betont, die ihn jetzt neugierig ansahen, dann erkannte sie ihn. Mit einem Lächeln machte sie die Tür ganz auf.
Gamache zeigte ihr seinen Ausweis. »Entschuldigen Sie die Störung, Madame, mein Name ist Armand Gamache. Ich bin von der Sûreté du Québec.«
»Ich weiß, wer Sie sind, Monsieur. Bitte, treten Sie ein. Ich bin Carole Gilbert.«
Sie führte ihn in die Diele. Ihr Verhalten war freundlich und liebenswürdig. Gamache war nicht zum ersten Mal in diesem Haus. Er war sogar schon oft hier gewesen. Aber es war fast nicht wiederzuerkennen. Es war, als hätte man ein Skelett mit neuen Muskeln, Sehnen und Haut versehen. Das Gerüst war noch da, aber alles andere hatte sich verändert.
»Sie kennen das Haus?«, fragte sie.
»Ich kannte es«, sagte er und sah ihr in die Augen. Ruhig und gelassen erwiderte sie seinen Blick. Wie eine Schlossherrin, selbstbewusst und ohne das Bedürfnis, die eigene Stellung zu beweisen. Sie war sympathisch und herzlich und, wie Gamache vermutete, ausgesprochen aufmerksam. Was hatte Peter gesagt? Sie war früher Krankenschwester gewesen? Bestimmt eine sehr gute. Die besten zeichneten sich durch Aufmerksamkeit aus. Ihnen entging nichts.
»Hier hat sich sehr viel verändert«, sagte er, und sie nickte und ging weiter. Er trat sich die Füße an dem kleinen Läufer ab, der den schimmernden Holzfußboden schützen sollte, und folgte ihr. Die Diele öffnete sich zu einem großen Vestibül mit einem funkelnagelneuen schwarz-weißen Fliesenboden. Vor sich sah er die geschwungene Treppe, und auf den Seiten gingen Flure ab, die zu den Zimmern führten. Bei seinem letzten Besuch hier war das Haus halb verfallen gewesen, eine Ruine. Es schien sich angewidert gegen sich selbst gewandt zu haben. Abgebröckelter Putz, lose Tapeten, aufgeworfene Dielenbretter, durchhängende Decken. Doch jetzt stand ein riesiger bunter Blumenstrauß auf dem polierten Tisch mitten im Vestibül und verströmte seinen Duft. Die Wände waren in einem eleganten Beigegrau gestrichen. Alles strahlte einladend und elegant. Wie die Frau vor ihm.
»Noch sind wir mit den Arbeiten nicht ganz fertig«, sagte sie und ging ihm voran durch den Flur zu ihrer Rechten und einige Stufen hinunter in das große Wohnzimmer. »Ich sage zwar ›wir‹, aber eigentlich meine ich meinen Sohn und meine Schwiegertochter. Und natürlich die Handwerker.«
Ihre Worte wurden von einem kleinen selbstironischen Lachen begleitet. »Neulich war ich dumm genug zu fragen, ob ich irgendwie helfen kann, und sie haben mir einen Hammer in die Hand gedrückt und gesagt, ich soll den Gipskarton befestigen. Ich habe mit dem Nagel ein Wasserrohr erwischt und eine Stromleitung.«
Ihr ungekünsteltes Lachen war so ansteckend, dass Gamache unwillkürlich mit einstimmte.
»Jetzt bin ich für den Tee zuständig. Man nennt mich die Teelady. Möchten Sie Tee?«
»Merci, Madame, das wäre sehr nett.«
»Ich sage Marc und Dominique Bescheid, dass Sie da sind. Es geht um diesen armen Mann im Bistro, nehme ich an?«
»Ja.«
Sie wirkte mitfühlend, aber nicht beunruhigt. Als hätte die Angelegenheit nichts mit ihr zu tun. Und Gamache hoffte, dass es so war.
Während er wartete, sah er sich um und trat vor die bodentiefen Fenster, durch die die Sonne hereinströmte. Das Zimmer war gemütlich eingerichtet. Die Polster der bequem wirkenden Sofas und Sessel waren mit edlen modernen Stoffen bezogen, was einen reizvollen Kontrast erzeugte. Links und rechts des Kamins standen Eames-Stühle. Eine gelungene Kombination aus Gegenwart und Vergangenheit. Wer immer dieses Zimmer eingerichtet hatte, hatte ein gutes Auge.
Die Fenster wurden von bodenlangen Seidenvorhängen eingerahmt. Gamache vermutete, dass sie so gut wie nie zugezogen wurden. Warum sollte man sich dieser Aussicht berauben?
Denn sie war spektakulär. Das Haus überblickte das gesamte Tal. Gamache sah den Bella Bella, der sich durch das Dorf schlängelte und hinter dem nächsten Hügel verschwand, um weiter in das angrenzende Tal zu fließen. Das Laub der Bäume auf der Hügelkuppe hatte sich zu verfärben begonnen. Hier oben war es bereits Herbst. Schon bald würden sich die Rot- und Braun- und Orangetöne über die Hänge ausbreiten, bis der gesamte Wald in Flammen stand. Was für ein wunderbarer Aussichtspunkt, von dem aus man all das beobachten konnte. Und noch mehr.
Von da, wo er stand, konnte er Ruth und Rosa um den Dorfanger gehen sehen, die alte Dichterin warf mit hart gewordenen Brötchen oder vielleicht auch mit Steinen nach den anderen Vögeln. Er sah Myrna in Claras Gemüsegarten werkeln und Agent Lacoste über die Steinbrücke in Richtung ihrer behelfsmäßigen Einsatzzentrale im alten Bahnhof gehen. Dann blieb sie auf der Brücke stehen und blickte auf das gemächlich dahinfließende Wasser. Er fragte sich, was sie wohl dachte. Schließlich setzte sie ihren Weg fort. Andere Dorfbewohner erledigten ihre vormittäglichen Besorgungen, arbeiteten in ihren Gärten oder saßen auf ihren Veranden, tranken Kaffee und lasen Zeitung.
Das alles konnte er von hier aus sehen. Einschließlich des Bistros.
Agent Paul Morin war vor Lacoste eingetroffen, und jetzt stand er vor dem Bahnhof und machte sich Notizen.
»Ich habe gestern Abend über den Fall nachgedacht«, sagte er, während sie die Tür aufsperrte, und folgte ihr in den kalten, dunklen Raum. Sie schaltete das Licht ein und ging zu ihrem Schreibtisch. »Der Mörder muss im Bistro das Licht eingeschaltet haben, meinen Sie nicht? Ich bin heute Nacht um zwei testweise in meiner Wohnung rumgelaufen, und ich habe überhaupt nichts gesehen. Es war stockfinster. In der Stadt fällt vielleicht noch Licht von der Straßenbeleuchtung durchs Fenster, aber hier draußen gibt’s keine. Woher wusste er, wen er umbringt?«
»Wenn er das Opfer dorthin gelockt hat, war es doch ziemlich eindeutig. Er hat die einzige andere Person im Bistro umgebracht.«
»Das ist schon klar«, sagte Morin und zog sich einen Stuhl zu ihrem Schreibtisch. »Aber ein Mord ist eine ernste Angelegenheit. Da will man keinen Fehler begehen. Es war ein heftiger Schlag auf den Kopf, richtig?«
Lacoste gab ihr Passwort in ihren Computer ein. Den Namen ihres Mannes. Morin war so sehr mit seinen Notizen und mit Reden beschäftigt, dass er bestimmt nichts davon mitbekommen hatte.
»Ich glaube, es ist nicht so einfach, wie es aussieht«, fuhr er eifrig fort. »Das habe ich gestern Nacht auch ausprobiert. Ich habe versucht, im Dunkeln mit einem Hammer eine Cantaloupe-Melone zu treffen.«
Jetzt hatte er ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Nicht nur weil sie wissen wollte, was dabei herausgekommen war, sondern weil jeder, der um zwei Uhr morgens aufstand, um im Dunkeln eine Melone zu erschlagen, Aufmerksamkeit verdiente. Vielleicht sogar ärztliche Betreuung.
»Und?«
»Beim ersten Mal habe ich sie nur gestreift. Ich musste ein paarmal zuschlagen, bevor ich sie richtig erwischt habe. Eine ziemliche Sauerei.«
Morin ging kurz die Frage durch den Kopf, was seine Freundin denken würde, wenn sie aufstand und die zermatschte Melone vorfand. Er hatte ihr eine Nachricht hinterlassen, aber er war sich nicht sicher, ob das reichte.
Das war ich, hatte er geschrieben. Ein Experiment.
Vielleicht hätte er etwas genauer sein sollen.
Die Bedeutung seiner Worte war Agent Lacoste nicht entgangen. Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und dachte nach. Morin war so schlau, den Mund zu halten.
»Also, was denken Sie?«, fragte sie schließlich.
»Ich denke, dass er eigentlich das Licht hätte einschalten müssen. Aber das wäre riskant gewesen.« Morin wirkte unzufrieden. »Ich versteh das nicht. Warum hat er den Mann im Bistro umgebracht, wenn nur ein paar Meter weiter dichter Wald anfängt? Da könnte man Hunderte von Leuten umbringen, ohne dass es jemand bemerkt. Warum also an einer Stelle, wo die Leiche gefunden wird und er gesehen werden kann?«
»Sie haben recht«, sagte Lacoste. »Es ergibt keinen Sinn. Der Chef denkt, dass es etwas mit Olivier zu tun haben könnte. Vielleicht hat der Mörder das Bistro bewusst ausgesucht.«
»Um es ihm anzuhängen?«
»Oder um sein Geschäft zu ruinieren.«
»Vielleicht war es Olivier selbst«, sagte Morin. »Warum nicht? Er dürfte so ziemlich der Einzige sein, der sich ohne Licht im Bistro zurechtfindet. Er hatte einen Schlüssel …«
»Jeder hatte einen Schlüssel. Wie es aussieht, waren überall in der Gegend Schlüssel in Umlauf, und außerdem hatte Olivier einen unter den Blumentopf bei der Eingangstür gelegt«, erwiderte Lacoste.
Morin nickte, das schien ihn nicht zu überraschen. Auf dem Land war das eben so, zumindest in den kleinen Dörfern.
»Er ist zweifellos einer der Hauptverdächtigen«, fuhr Lacoste fort. »Aber warum sollte er in seinem eigenen Bistro einen Mord begehen?«
»Vielleicht hat er den Mann überrascht. Vielleicht ist der Landstreicher eingebrochen, und Olivier hat ihn entdeckt, und es kam zu einem Kampf«, sagte Morin.
Lacoste schwieg, wartete ab, ob er die Überlegung zu Ende führen würde. Morin verschränkte die Hände, stützte das Kinn darauf und blickte in die Ferne. »Aber es war mitten in der Nacht. Wenn er einen Einbrecher im Bistro bemerkt hätte, hätte er dann nicht die Polizei gerufen oder wenigstens seinen Freund aufgeweckt? Olivier Brulé kommt mir nicht vor wie jemand, der sich einen Baseballschläger schnappt und allein losstürmt.«
Lacoste atmete tief aus und sah Agent Morin an. Wenn das Licht im entsprechenden Winkel auf das Gesicht des schmächtigen jungen Mannes fiel, konnte man ihn für einen Einfaltspinsel halten. Aber das war er eindeutig nicht.
»Ich kenne Olivier«, sagte Lacoste, »und ich könnte schwören, dass ihn der Fund der Leiche zutiefst verstört hat. Er stand unter Schock. So was lässt sich schlecht vortäuschen, und ich bin ziemlich sicher, dass er es auch nicht getan hat. Nein. Als Olivier Brulé gestern früh aufwachte, hat er nicht damit gerechnet, eine Leiche in seinem Bistro zu finden. Was nicht heißt, dass er nicht irgendwie in die Sache verwickelt ist. Vielleicht unwissentlich. Der Chef will, dass wir mehr über Olivier in Erfahrung bringen. Wo er geboren wurde, seine Familie, auf welchen Schulen er war, was er gemacht hat, bevor er hierherkam. Wer etwas gegen ihn haben könnte. Wer auf ihn sauer ist.«
»Das ist mehr als sauer sein.«
»Woher wissen Sie das?«, fragte Lacoste.
»Na ja, ich bin auch manchmal sauer, aber ich bringe niemanden um.«
»Nein, das tun Sie nicht. Aber ich schätze, dass Sie ein eher ausgeglichener Mensch sind, von dem Zwischenfall mit der Melone mal abgesehen.« Sie lächelte, und er wurde rot. »Es ist ein großer Fehler, andere nach sich selbst zu beurteilen. Eines der ersten Dinge, die sie bei Chief Inspector Gamache lernen, ist, dass andere Leute nicht so reagieren wie man selbst. Und die Reaktionen eines Mörders sind uns noch fremder. Dieser Fall hat nicht mit dem Schlag auf den Kopf begonnen. Er begann vor vielen Jahren mit einem ganz anderen Schlag. Unserem Mörder ist etwas widerfahren, das wir vielleicht als nicht sehr wichtig betrachten würden, sogar banal, aber für ihn war es vernichtend. Irgendein Vorfall, eine Zurechtweisung, ein Streit, den die meisten Leute mit einem Schulterzucken abtun würden. Ein Mörder nicht. Er grübelt darüber nach, ist verletzt und verbittert. Und die Verbitterung, der Groll wird immer größer. Bei einem Mord geht es um Gefühle. Gefühle, die umgekippt und außer Kontrolle geraten sind. Das müssen Sie immer im Kopf behalten. Und bilden Sie sich nie ein, Sie wüssten, was jemand anderes denkt, ganz zu schweigen davon, was er fühlt.«
Das war die erste Lektion, die sie von Chief Inspector Gamache gelernt hatte, und die erste, die sie jetzt an ihren Schützling weitergab. Um einen Mörder zu finden, folgte man Spuren, ja, das schon. Aber man folgte auch Gefühlen. Denen, die stanken, verdorben und verfault waren. Man folgte der Spur der Verwesung. Bis man endlich fand, was man suchte.
Es gab noch viele andere Lektionen. Und auch die würde sie ihm beibringen.
Das war es, worüber sie auf der Brücke nachgedacht hatte. Sie hatte darüber nachgedacht und sich Sorgen gemacht. Sie hoffte, dass sie in der Lage sein würde, diesem jungen Mann genug Wissen mitzugeben, genug von den Werkzeugen, die notwendig waren, um einen Mörder dingfest zu machen.
»Nathaniel«, sagte Morin, stand auf und ging zu seinem Computer. »Ist das der Name Ihres Mannes oder Ihres Sohnes?«
»Mann«, sagte Lacoste, etwas perplex. Er hatte es also doch mitbekommen.
Das Telefon klingelte. Es war die Rechtsmedizinerin. Sie musste dringend mit Chief Inspector Gamache sprechen.