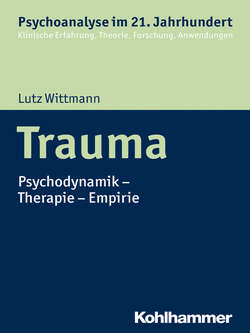Читать книгу Trauma - Lutz Wittmann - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lernziele
Оглавление• Übersicht über die Phasen der Entwicklung der modernen Psychotraumatologie und des sich hierin abbildenden Wechsels von Anerkennung und Leugnung der Bedeutung traumatischer Erfahrungen seitens der scientific community.
• Kennenlernen zentraler psychotraumatologischer Konstrukte, deren psychodynamische Ursprünge einer weitgehenden Amnesie verfallen sind.
• Würdigung und Relativierung des psychoanalytischen Beitrags im Kanon der Psychotraumatologie.
Der Basler Psychoanalytiker Christian Kläui unterteilt die Entwicklung der Psychoanalyse in drei Phasen (Kläui, 2010). Im Zentrum der ersten Phase stehen das Symptom und seine Beseitigung. In der Behandlung der traumatischen Hysterie (Freud & Breuer, 1895/1987) strebt Freud die Auflösung des Symptoms per Wiederherstellung der Erinnerung an. Bald jedoch werden die Grenzen eines rein symptomfokussierten Ansatzes sichtbar. In der Behandlung von Dora erkennt Freud (1905) schließlich, dass sich die Symptome seiner PatientInnen nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungserfahrungen begründen, sondern dass sich die so geprägten Muster auch in der therapeutischen Beziehung aktualisieren. Nichtberücksichtigung dieses Übertragungsgeschehens, so erkennt Freud, gefährdet den Erfolg einer rein symptomzentrierten Behandlung. Diese zweite Phase steht also im Zeichen der Analyse der Übertragung, der Auflösung des malignen Einflusses unserer inneren, auf frühe Interaktionserfahrungen zurückgehenden Beziehungsmodelle. Die dritte Phase beginnt gemäß Kläui mit den späten Schriften Freuds (Freud, 1920, 1937) und wird vom Autor anhand von Referenzen zur Psychoanalyse Lacans präzisiert. Freud erkennt, »dass die Übertragung, indem sie die Liebeskonstellationen der Kindheit wieder aufleben lässt, auch die traumatischen Momente des Scheiterns in unseren Begegnungen mit den geliebten Anderen zur Wiederkehr bringt« (Kläui, 2010, S. 384). Seine Theoriebildung greift dies mit Konzepten wie Wiederholungszwang und negativer therapeutischer Reaktion auf. Kläui postuliert so eine Mangelanthropologie:
»Denn die Norm, die mit einer so verstandenen Psychoanalyse ins Spiel kommt, heisst eigentlich: normal ist die Kluft in uns selbst, die sich nie schliessen lässt, sondern nur in der unendlichen Reihe der Verschiebungen, die unser Begehren kennzeichnet, umkreisen lässt« (ebd., S. 387).
Damit stellt sich dem Menschen eine Aufgabe, die sicherlich nicht zeitgemäß ist:
»Ans Ende kommt die Analyse erst, wenn wir quer durch all unser Verlangen nach Anerkennung und Liebe anerkennen können, dass wir hier auf etwas ausgerichtet bleiben, das wir nie restlos beantworten können und das unser unbewusstes Wünschen immer wieder antreibt, so dass es in keinem noch so gut zufrieden gestellten Anspruch aufgehen und Erfüllung finden kann« (ebd., S. 386).
So kann die Akzeptanz der nicht abschließend auflösbaren Fragen, die sich dem Einzelnen vor dem Hintergrund seiner Entwicklungsgeschichte stellen, eine Kreativität bei der Suche nach neuen, ihm besser entsprechenden Antworten öffnen.
Wie die Entwicklungsgeschichte der Psychoanalyse, so ist auch diejenige der Psychotraumatologie oft beschrieben worden (Bohleber, 2000; Lehmacher, 2013; Van der Kolk, 2007; Venzlaff, Dulz & Sachsse, 2009). An dieser Stelle soll deshalb nur flüchtig an einige Phasen erinnert werden, in welchen die wesentlichen Wachstumsschübe dieser Disziplin erfolgten. Gemeinsam ist all diesen Phasen, dass große zeitgeschichtliche Ereignisse eine breite fachliche wie allgemeingesellschaftliche Aufmerksamkeit sicherstellten. Im Zusammenhang mit den sensationellen Eisenbahnunfällen des 19. Jahrhunderts entwickelte sich so erstmals ein wissenschaftlicher Disput um die Bedeutung organischer und psychischer Korrelate traumatischer Unfallfolgen. Der Begriff railway spine stand dabei exemplarisch für die Annahme, dass Erschütterungen des Rückenmarks für die beobachteten dissoziativen oder somatoformen Symptome nach Unfällen verantwortlich sein sollten. In ihrer sorgfältigen Übersicht arbeitet Lehmacher (2013) die Ironie heraus, dass der englische Chirurg John Eric Erichsen, welcher bis heute mit dem Syndrom des railway spine in Verbindung gebracht wird, sich gerade dagegen wehrte, durch Verwendung eines solchen Begriffs unsinnigerweise die Annahme einer »neue[n], spezifische[n] Krankheit« (Lehmacher, 2013, S. 35) zu etablieren. Im Begriff der traumatischen Neurose (Oppenheim, 1889) interagierten dann bereits angenommene organische Verletzungen mit einem Schreckaffekt, wie er noch bis 2012 in der vierten Version des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV; APA, 2001) anzutreffen war:
»Für die Entstehung der Krankheit ist das physische Trauma nur z. T. verantwortlich zu machen. Die Hauptrolle spielt das psychische: der Schreck, die Gemüthserschütterung. Die Verletzung schafft allerdings directe Folgezustände, die aber in der Regel keine wesentliche Bedeutung gewinnen würden, wenn nicht die krankhaft alterierte Psyche in ihrer abnormen Reaction auf diese körperlichen Beschwerden die dauernde Krankheit schüfe« (Oppenheim, 1889, S. 123–124).
Eine erste Blütezeit eines psychischen Traumabegriffs lässt sich in den Arbeiten zur traumatischen Hysterie von Charcot und seinen Schülern erkennen. Hierbei sind insbesondere die Beiträge Pierre Janets als Vorläufer der heutigen Dissoziationstheorie (vgl. van der Hart & Horst, 1989) sowie diejenigen von Freud (z. B. Freud & Breuer, 1895/1987) zu nennen. Freuds unheilvolles Schwanken zwischen Anerkennung der äußeren traumatisierenden Realität und ihrer ebenso schädlichen wie unnötigen Infragestellung wird detailliert von Venzlaff et al. (2009) nachgezeichnet. Die beiden Weltkriege und der Bedarf an Soldaten, deren Funktionsfähigkeit nicht vom Horror der Schlachtfelder beeinträchtigt sein sollte, boten traurige Gelegenheit zur Präzisierung phänomenologischer Beobachtungen und zur Entwicklung der unterschiedlichsten Interventionsstrategien. Die in unverantwortlicher Weise verzögerte Anerkennung der psychischen Folgen der Extremereignisse (Bettelheim, 1943) im Zuge des deutschen Genozids an der jüdischen und vielen anderen Bevölkerungsgruppen zeitigt schließlich ebenso erschütternde wie tiefgreifende Erkenntnisse über die Wirkungsweise eines realisierten psychotischen Kosmos’ (Grubrich-Simitis, 1979). Schließlich sind es der Vietnamkrieg und die amerikanische Frauenrechtsbewegung, welche das Bewusstsein für die Folgen traumatischer Ereignisse in solcher Weise schärfen, dass diese 1980 erstmals in Form der Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) ins DSM-III (APA, 1980) aufgenommen wird.