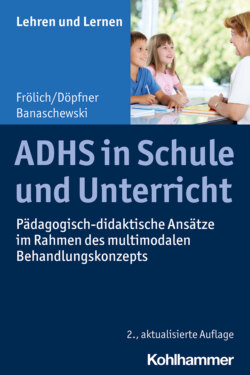Читать книгу ADHS in Schule und Unterricht - Manfred Döpfner - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Kernsymptome des Störungsbildes Unaufmerksamkeit
ОглавлениеDie Unaufmerksamkeit stellt das Symptom dar, das, gemessen an den anderen Kernsymptomen, am häufigsten auftritt und auch im Entwicklungsverlauf bis in das Erwachsenenalter hinein ( Kap. 1.5, Verlauf während der Schulzeit) überdauert (Wilens, Biederman & Spencer, 2002; Steinhausen & Sobanski 2010).
In vielen Fällen, v. a. beim vorwiegend unaufmerksamen, sogenannten »Träumertyp«, besteht insgesamt eine psychomotorische Unteraktivierung (sog. Hypoaraousal) oder eine Unterfunktion der Vigilanz (Orinstein & Stevens, 2014; Hvolby, 2015; James, Cheung, Rijsdijk, Asherson & Kuntsi, 2016). Die Kinder fallen im Alltag durch ihre Langsamkeit auf, vor allen Dingen bei der Bearbeitung von schulischen Aufgabenstellungen (Kibby, Vadnais & Jagger-Rickels, 2019) und sind häufig zusätzlich introvertiert oder sogar ängstlich. Seit längerem wird aufgrund einer zunehmend besseren Befundlage immer wieder diskutiert, ob dieser Subtyp der ADHS von den anderen Subtypen zu unterscheidende Verursachungsmechanismen besitzt mit anderen Begleitstörungen und einem anderen Verlauf und möglicherweise sogar ein eigenständiges Störungsbild darstellt (Barkley, 2014).
• Der Arbeits- und Lernstil ist von wenig Sorgfalt geprägt und wichtige Details einer Aufgabe werden übersehen.
• Die Aufmerksamkeit kann nicht über längere Zeit aufrechterhalten werden, was sich z. B. darin zeigt, dass zu Beginn einer Klassenarbeit wenige Fehler begangen werden, diese aber drastisch zu deren Ende hin zunehmen. Typischerweise resultiert hieraus eine Verlangsamung des Arbeitstempos, d. h., dass Aufträge nicht zeitgerecht zu Ende gebracht werden können. Auch bei Spiel- oder Sportaktivitäten – allerdings in diesem Kontext viel stärker abhängig von der Motivation und vom individuellen Können – wird oft ein geringeres Durchhaltevermögen beobachtet. Die Kinder verlieren schneller die Lust, an Gruppenaktivitäten teilzunehmen. Dies hat zum Beispiel zur Folge, dass Vereinstätigkeiten deutlich schneller abgebrochen werden und, je jünger die Kinder sind, die Gefahr, hierdurch in eine soziale Außenseiterposition zu geraten, deutlich erhöht ist.
• Viele Anweisungen müssen häufiger gegeben werden, weil das Kind diese nicht zu hören scheint oder auch faktisch nicht mitbekommen hat. Entsprechend kann diesen nicht korrekt oder gar nicht Folge geleistet werden, wobei hier immer auch zu differenzieren ist, inwieweit oppositionelles Verhalten oder eine fachliche Überforderung mit eine Rolle spielen.
• Es besteht eine erhöhte Ablenkbarkeit von externen Stimuli, sei es auditiver Natur, indem die betroffenen Kinder darüber klagen, dass sie den Geräuschpegel der Klasse als zu störend empfinden, um konzentriert bei einer Sache zu bleiben, sei es durch beliebige visuelle Stimuli, wie der veränderten Frisur der Mitschülerin oder dem vorbeifliegenden Flugzeug am Horizont. Gut verständlich ist, dass hierdurch jeweils Unterbrechungen des Arbeitsflusses zustande kommen mit der Folge, diesen nicht (korrekt) fortzusetzen, zumindest aber langsamer zu arbeiten als die Klassenkameraden.
• Typisch ist des Weiteren die hohe Vergesslichkeit der betroffenen Kinder für Materialien oder vergebene Aufträge, wobei bislang nicht vollständig geklärt ist, ob diese Auffälligkeit Folge der Aufmerksamkeitsdefizienz ist, also ein Auftrag gar nicht wahrgenommen wurde, oder dass dieser nicht im Kurzzeitgedächtnis gespeichert wurde.
Ganz verschiedene Aufmerksamkeitsfunktionen können betroffen sein, welche dann im Prozess der Diagnostik abgeklärt werden müssen, durchaus aber auch im Alltagsbereich beobachtbar sind.
Tabelle 1.2 gibt einen Überblick über die betroffenen Aufmerksamkeitsfunktionen ( Tab. 1.2, adaptiert nach Sohlberg & Mateer, 1989).
Tab. 1.2: Pädagogisch relevante Beispiele von Aufmerksamkeitsfunktionen (adaptiert nach Sohlberg & Mateer, 1989)
AufmerksamkeitstypFunktionen