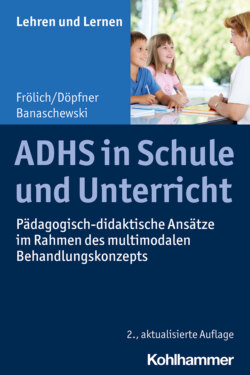Читать книгу ADHS in Schule und Unterricht - Manfred Döpfner - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Auftretenshäufigkeit
ОглавлениеDie ADHS gehört insgesamt mit einer weltweiten epidemiologischen Prävalenz von 5,3 % [5,01–5,56] gemäß der DSM-5-Kriterien zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter (Wittchen et al., 2011). Die strengeren ICD-10-Forschungskriterien führen allerdings zu deutlich niedrigeren Schätzungen von etwa 1–2 % (NICE, 2018; Döpfner et al., 2008; Polanczyk & Rohde, 2007). Eine bundesweite Auswertung von Krankenkassendaten zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ergab zwischen 2009 und 2014 einen Anstieg der Häufigkeit von ADHS-Diagnosen bei 0- bis 17-Jährigen von 5,0 % auf 6,1 % (mit einem Maximum von 13,9 % bei 9-jährigen Jungen) und bei 18- bis 69-Jährigen von 0,2 % auf 0,4 % (Bachmann, Philipsen & Hoffmann, 2017). In einer anderen Studie betrug die Diagnosehäufigkeit 2016 bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland auf der Grundlage der Auswertung der bundesweiten, vertragsärztlichen Abrechnungsdaten 4,3 %. Zwischen 2009 und 2016 war demnach aber kein Anstieg der ADHS-Häufigkeit zu verzeichnen, wohl aber gab es ausgeprägte regionale Unterschiede. Diese lagen im Kreisvergleich zwischen 1,6 % und 9,7 % (Akmatov, Hering, Steffen, Holstiege & Bätzing, 2019).
In einer finnischen Registerstudie wurde eine Kohorte von ADHS-Kindern, die zwischen 1991 und 2004 geboren wurden, mit Kindern der Jahrgänge 2004 bis 2011 verglichen. In den Geburtsjahrgängen 1991 bis 2004 erhielten die jüngsten männlichen Kinder bis zu 26 % häufiger eine ADHS-Diagnose, bei den Mädchen waren es sogar 31 % mehr im Vergleich zu den etwas älteren Kindern. Die Autoren schlussfolgerten, dass Lehrer und Eltern Symptome einer ADHS fälschlicherweise mit Unreife verwechseln könnten (Sayal, Chudal, Hinkka-Yli-Salomäki, Joelsson & Sourander, 2017).
Die Verhältnisse in den USA zeigen einen anderen Trend: In einem nationalen Survey wurde ermittelt, dass die Prävalenz einer ADHS-Diagnose zwischen 1997 und 1998 sowie zwischen 2015 und 2016 von 6,1 % auf 10 % signifikant zunahm, und zwar über alle Subgruppen hinweg (Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, soziodemographischer Status sowie geographische Region) (Xu, Strathearn, Liu, Yang & Bao, 2018).
Unterschiedliche Prävalenzen der ADHS können durch folgende Faktoren verursacht sein:
Die öffentliche Wahrnehmung des Störungsbildes ist in den letzten Jahren stärker in den Vordergrund getreten, so dass Kinder auch schneller einer fachkompetenten Diagnostik zugeführt werden. Zugleich haben die Kenntnis bei Eltern und Lehrpersonen und die Ausbildung von Kinderärzten im Hinblick auf die kompetente Abklärung und Behandlung des Störungsbilds deutlich zugenommen (Lougy, DeRuvo & Rosenthal, 2009). Anzumerken ist, dass je nachdem, welches psychiatrische Klassifikationssystem zugrunde gelegt wird, unterschiedliche Prävalenzraten zum Vorschein kommen. In einer bundesweiten deutschen Studie konnte bei 7- bis 17-Jährigen auf der Basis von Elternurteilen eine Häufigkeit von 5 % nach DSM-5-Kriterien ermittelt werden, aber von nur 1 % nach den strengeren ICD-10-Kriterien. Hinzuzufügen ist des Weiteren, dass die Prävalenzraten immer dann sinken, wenn nicht nur die Symptomatik, sondern auch vor allem die Funktionseinschränkung bzw. auch der Symptombeginn zugrunde gelegt werden (Döpfner et al., 2008).
Inwieweit als Katalysatoren für die Ausprägung des Störungsbildes Faktoren wie erhöhte schulische Anforderungsbedingungen, eine Zunahme des Medienkonsums oder Schlafmangel bei dieser Entwicklung mit eine Rolle spielen, muss noch offen bleiben.
Eine erste Langzeitstudie über zwei Jahre hinweg wies allerdings nach, dass vor allen Dingen eine überdurchschnittlich starke Nutzung digitaler Medien zu einer Zunahme von ADHS-Symptomen bei Jugendlichen führen kann (Ra et al., 2018). Dass eine exzessive Mediennutzung ADHS-Symptome zumindest verstärkt, kann indes als mittlerweile gut belegt erachtet werden (Weiss, Baer, Allan, Saran & Schibuk, 2011). Da eine exzessive Mediennutzung oft zugleich mit nichtphysiologischen Schlafgewohnheiten einhergeht, bestehen auch hierdurch Risiken für die Entwicklung von ADHS-Symptomen (Cassoff, Wiebe & Gruber, 2012).
Andere Autoren betonen, dass die Leistungserwartungen von Eltern gegenüber ihren Kindern die Diagnosehäufigkeit beeinflussen könnte einschließlich eines erleichterten Zugangs zu einer medikamentösen Behandlung zur Leistungssteigerung (Davidovitch, Koren, Fund, Shrem & Porath, 2017).
Es ist wichtig anzumerken, dass diese Faktoren Einfluss auf die Häufigkeit und Ausprägung von ADHS-Symptomen haben können, eine hinreichende Erklärung für die Entwicklung des Störungsbildes bieten sie indessen nicht (Weiss et al., 2011).
Es bestehen beträchtliche Geschlechtsunterschiede für das Störungsbild: Das Verhältnis Jungen zu Mädchen variiert zwischen 4:1 und 9:1. Hinzu kommt, dass Jungen häufiger impulsive und aggressive Verhaltensweisen zeigen, während Mädchen häufiger Symptome des unaufmerksamen Subtypus aufweisen (Biederman, Faraone, Monuteaux, Buber & Cadogen, 2004). Die Jungendominanz ist zudem stärker ausgeprägt beim hyperaktiven im Vergleich zum unaufmerksamen Subtypus (Sadiq, 2007).
Die Wendigkeit hin zum männlichen Geschlecht ist in klinischen Stichproben (3–4:1) allerdings stärker ausgeprägt als in epidemiologischen Studien (2:1). ADHS ist zudem mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status assoziiert (Larsson, Sariaslan, Långström, D'Onofrio & Lichtenstein, 2014; Döpfner et al., 2008).