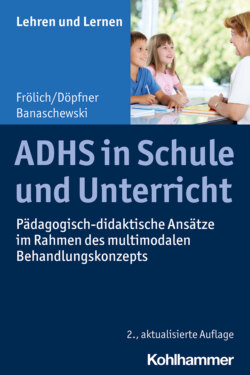Читать книгу ADHS in Schule und Unterricht - Manfred Döpfner - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis
ОглавлениеBarkley (2006) stellt resümierend folgende Problembereiche zum Verlauf des Störungsbildes heraus: Im Verlauf der Kindheit und der Adoleszenz steht zunächst die Beeinträchtigung der Schullaufbahn mit niedrigen Leistungen, Klassenwiederholungen und Schulverweisen im Fokus. Das zweitgrößte Risiko besteht in der Entwicklung komorbider Störungen des Sozialverhaltens, welche im Verlauf in eine antisoziale Persönlichkeitsstörung einmünden können bei gleichzeitiger Zunahme eines Substanzmissbrauchs. Entsprechend steigt die Gefahr von Regel- und Gesetzesübertretungen im Jugendlichenalter deutlich an. An dritter Stelle sind zahlreiche Beziehungsstörungen zu nennen mit ausgeprägter sozialer Zurückweisung und Außenseiterposition in der Gleichaltrigengruppe. Diese interaktionellen Schwierigkeiten setzen sich auch in das Erwachsenenalter fort.
Inwieweit verschiedene Therapien, insbesondere die Stimulanzientherapie, den Langzeitverlauf günstig beeinflussen können, ist derzeit nicht abschließend zu beantworten. In der bislang umfangreichsten Langzeitstudie (MTA Cooperative Group, 1999a, b) zur Evaluierung von Therapieeffekten konnte die anfangs beobachtete Überlegenheit der medikamentösen Therapie gegenüber verhaltenstherapeutischen Interventionen nicht mehr beobachtet werden. Unabhängig von der Therapieform zeigte die Gruppe der Jugendlichen mit einer ADHS immer noch erhebliche psychosoziale Auffälligkeiten gegenüber unauffälligen gleichaltrigen Jugendlichen. Zugleich wurde deutlich, dass diejenigen Kinder, welche ein geringeres Ausmaß an zusätzlichen Verhaltensproblemen aufwiesen, bereits zu Beginn auf jedwede Therapieform positiv ansprachen. Außerdem wiesen die Kinder, deren Herkunftsfamilien weniger mit soziodemografischen Problemen belastet waren, eine bessere Langzeitprognose auf (Molina et al. 2009).
Hinshaw und Arnold (2015) kommen in der Nachbetrachtung dieser wichtigen Studie zu folgenden differenzierenden Ergebnissen:
a) Eine kombinierte Behandlungsform mit medikamentösen und verhaltenstherapeutischen Maßnahmen erwies sich als überlegen im Hinblick auf wichtige funktionale Beeinträchtigungen (schulischen Erfolg, soziale Fertigkeiten sowie erzieherische Kompetenzen der Eltern).
b) Sie betonen die Wichtigkeit der Unterscheidung spezifischer Begleitbedingungen im Hinblick auf den Therapieerfolg (Komorbiditäten, verbesserte Erziehungskompetenzen der Eltern während der Intervention).
c) Sie weisen auf das mögliche Auftreten von Nebenwirkungen unter einer Langzeitmedikation (zum Beispiel Wachstumsverminderung) hin sowie auf die Verminderung der Überlegenheit der Medikation nach dem Wechsel der Patienten von der kontrollierten Studienphase in das naturalistische Follow-up.
Arnold und Mitarbeiter (Arnold, Hodgkins, Caci, Kahle & Young, 2015) untersuchten die Beziehung verschiedener Behandlungsmodalitäten mit der Langzeitprognose des Störungsbildes. Auf der Basis von 403 untersuchten Studien kamen sie zu dem Ergebnis, dass sich die Langzeitprognose bei Betroffenen von einer ADHS unabhängig von der Behandlungsmodalität verbessert, die größten Effektstärken indes bei einer Kombination von medikamentösen mit nicht medikamentösen Interventionen beobachtet werden konnten, unabhängig von der Behandlungsdauer und vom Beginn der Behandlung.
Insgesamt betrachtet erwiesen sich die folgenden Faktoren als Prädikatoren für eine Chronifizierung des Verlaufs der ADHS sowie das Zustandekommen von komorbiden psychischen Störungen:
• pränatale Komplikationen,
• ein niedriger Sozialstatus der Herkunftsfamilie,
• eine geringe Intelligenz,
• früh auftretende schwerwiegende Eltern-Kind-Interaktionsstörungen sowie frühe Beziehungsprobleme mit Gleichaltrigen bis hin zur sozialen Desintegration,
• eine früh im Entwicklungsverlauf zum Vorschein kommende Störung des Sozialverhaltens sowie anderer Komorbiditäten,
• die Belastung der Eltern bzw. der Familie mit einer ADHS, antisozialen Störungen, Substanzmissbrauch und anderen psychischen Erkrankungen
• (Barkley, 2006; Cherksasova, Sulla, Dalena, Pondé & Hechtman, 2013).