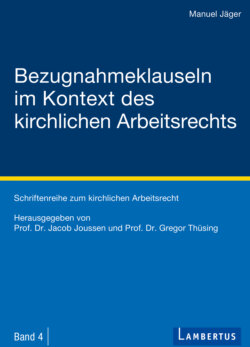Читать книгу Bezugnahmeklauseln im Kontext des kirchlichen Arbeitsrechts - Manuel Jäger - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.Das Selbstbestimmungsrecht als tragende Säule privatrechtlich begründeter Arbeitsverhältnisse im kirchlichen Arbeitsrecht
ОглавлениеAusgangspunkt des kirchlichen Arbeitsrechts ist neben der Religionsfreiheit nach Art. 4 GG insbesondere das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und Religionsgemeinschaften. Hergeleitet wird das Selbstbestimmungsrecht aus dem über Art. 140 GG inkorporierten Verfassungsrecht der Weimarer Reichsverfassung.29 Nach Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 S. 1 WRV kann jede Religionsgesellschaft ihre eigenen Angelegenheiten selbstständig und innerhalb der Schranken des für alle geltenden Rechts ordnen und verwalten. Mit der Gewährleistung einer selbstständigen Ordnung ihrer Angelegenheiten ist die interne kirchliche Rechtssetzung von einer staatlichen Einflussnahme befreit.30
Religionsgesellschaften i. S. d. Art. 137 Abs. 3 S. 1 WRV sind organisatorisch strukturierte Vereinigungen, welche die umfassende Bezeugung des Glaubens und die allseitige Erfüllung der durch das gemeinsame Glaubensbekenntnis gestellten Aufgaben bezwecken.31 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden davon zunächst die verfasste katholische und evangelische Kirche, die nach Art. 137 Abs. 5 WRV Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, erfasst. Keine Religionsgesellschaften sind dagegen die im karitativen Bereich der katholischen und evangelischen Kirche existierenden Einrichtungen, da diese – unabhängig von ihrer karitativen Zwecksetzung – nur partiell der Entfaltung eines Bekenntnisses dienen.32 Diesen Einrichtungen kommt allerdings die Möglichkeit zuteil, am Selbstbestimmungsrecht der Kirchen zu partizipieren. Eine solche Teilhabe erfordert jedoch die Zuordnung zur evangelischen oder katholischen Kirche. Dies setzt voraus, dass die Einrichtungen nach dem Selbstverständnis der Kirchen berufen sind, ein Stück des Auftrags der Kirche wahrzunehmen, was ein Mindestmaß kirchlicher Einflussmöglichkeit erfordert.33
Zu dem Begriff der „eigenen Angelegenheiten“ i.S.v. Art 137 Abs. 3 WRV zählen alle Umstände, die das Wirken der Religionsgemeinschaften betreffen und damit zu ihrem Sendeauftrag zählen.34 Somit gilt das Selbstbestimmungsrecht auch für die Ausgestaltung des kirchlichen Dienst- und Arbeitsrechts.35 Die arbeitsrechtliche Regelungsautonomie der Kirchen beschränkt sich dabei gerade nicht nur auf die interne Ämterorganisation, sondern erstreckt sich auch auf die allgemeine Ordnung des kirchlichen Dienstes.
Bezieht sich die Selbstbestimmungsgarantie aber auf die Begründung von Arbeitsverhältnissen, muss differenziert werden zwischen der Festlegung der eigenen Glaubens- und Sittenlehre einerseits und dem Abschluss privatrechtlicher Arbeitsverträge andererseits.36 Die Glaubens- und Sittenlehre, die auf dem kirchlichen Selbstverständnis basiert, erlaubt den Kirchen selbst zu entscheiden, welche Art des Dienstes es im kirchlichen Bereich geben soll.37 Der katholischen und evangelischen Kirche wird folglich das Schaffen und Aufrechterhalten einer internen Organisationsstruktur garantiert. Sie bestimmen eigenständig darüber, wer welche Aufgabe ausübt, in welcher Rechtsform sie auszuüben ist und welche Anforderungen die Beschäftigten zur Ausübung der konkreten Tätigkeit erfüllen müssen.38 Nach Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 S. 2 WRV verleihen die Kirchen ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates. Es sind allein die Kirchen, die darüber entscheiden, wie ein solches Amt übertragen wird, etwa durch Weihe oder Ordination.39 Dabei handelt es sich um einen innerkirchlichen Akt, der ausschließlich auf Kirchenrecht basiert und sich danach richtet. Die aus dem Selbstbestimmungsrecht hergeleitete arbeitsrechtliche Regelungsautonomie gilt in diesen Fällen unbegrenzt.40 Die „Sicherstellung der religiösen Dimension des Wirkens im Sinne des kirchlichen Selbstverständnisses“ steht dabei im Vordergrund.41
Die Kirchen können aber auch Nichtamtsträger beschäftigen. Für die Ausgestaltung dieser Beschäftigungsverhältnisse stehen den Kirchen zwei unterschiedliche Wege zur Verfügung. Einerseits ermöglicht Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 5 WRV den Kirchen – sofern sie den Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts innehaben –, ihre Anstellungsverhältnisse auch öffentlich-rechtlich auszugestalten, sog. kirchliches Amtsrecht.42 Die Arbeitsverhältnisse der Kirchenbeamten werden nicht durch einen privatrechtlichen Vertrag, sondern durch einen Hoheitsakt begründet. Das kirchliche Amtsrecht unterliegt nicht den Normen des allgemeinen Arbeitsrechts.43 In diesem Bereich kann die Kirche ihre eigenen Angelegenheiten daher mittels des Selbstbestimmungsrechts eigenständig und autonom regeln.
Andererseits sichert das Selbstbestimmungsrecht nach Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV den Kirchen das Recht zu, ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis zu begründen. Schließt ein kirchlicher Anstellungsträger einen privatrechtlichen Arbeitsvertrag ab, bedient er sich dabei nicht der Glaubensund Sittenlehre oder dem Kirchenbeamtentum, sondern der jedermann eingeräumten Privatautonomie des säkularen Rechts.44 Die Handhabung dieser Arbeitsverhältnisse richtet sich dann sowohl nach dem staatlichen, als auch nach dem kirchlichen Arbeitsrecht, sodass ein komplexes Geflecht zwischen den unterschiedlichen Rechtsquellen entsteht. Grundlegende Besonderheit des kirchlichen Arbeitsrechts ist in diesem Zusammenhang, dass es sich einerseits aus dem staatlichen und daher für alle geltenden Arbeitsrecht und andererseits aus dem nur im kirchlichen Sektor Anwendung findenden kirchlichen Arbeitsrecht zusammensetzt. Die zwei Rechtsgebiete überlagern sich wechselseitig.45 Dadurch entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen Staat und Kirche, aber auch zwischen Gesellschaft und Kirche, was nicht zuletzt dazu führt, dass das kirchliche Arbeitsrecht zunehmend unter Druck gerät.46
Gegenstand dieser Arbeit sind ausschließlich die zuletzt dargestellten privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse, die ein kirchlicher Anstellungsträger mit seinen Arbeitnehmern abschließt.