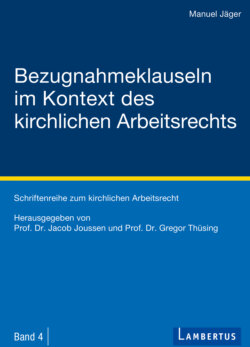Читать книгу Bezugnahmeklauseln im Kontext des kirchlichen Arbeitsrechts - Manuel Jäger - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.Leitgedanke der Dienstgemeinschaft auch bei privatrechtlich begründeten Arbeitsverhältnissen
ОглавлениеDie christlichen Kirchen stellen als Basis und Begründung für die Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts auf den Leitgedanken und das Ideal der Dienstgemeinschaft ab.55 Mit dem Begriff Dienstgemeinschaft soll das Leitprinzip des kirchlichen Dienstes benannt werden, damit dieser nach innen und außen glaubwürdig als Teilhabe am Heilswerk Jesu Christi verkörpert wird.56 Die auf säkularer Grundlage geschlossenen kirchlichen Arbeitsverhältnisse müssen sich in ein marktwirtschaftlich organisiertes Arbeitsleben einordnen, ohne dabei den Hintergrund des kirchlichen Agierens auf dem Arbeitsmarkt aus dem Auge zu verlieren. Um die Kirchlichkeit in privatrechtlichen Anstellungsverhältnissen zu gewährleisten, stellen die katholische und evangelische Kirche den Dienst in ihren Einrichtungen deshalb auf das Fundament der Dienstgemeinschaft. Grundlage der Dienstgemeinschaft ist eine Rückbesinnung auf das Handeln Christi, der sich zum Diener aller gemacht hat. Hinter dem Begriff Dienstgemeinschaft steckt nämlich der Gedanke, dass sich die kirchlichen Mitarbeiter nicht auf die dienende Nachfolge des Einzelnen beschränken, sondern Jesus Christus im Dienste der Versöhnung folgen, was ein Zusammenstehen vieler in einer „Gemeinschaft des Dienstes“57 erfordert. Dadurch entsteht zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten eine Parität und Partnerschaft, die sich über niemanden erheben will und auf dem „Vorbild“ der urchristlichen Gemeindebildung gründet.58 Die Dienstgemeinschaft fußt auf dem Grundideal der Liebe des auferstandenen Christi zu seiner Gemeinde und der erwiderten Liebe der Gemeinde zu ihm.59 Die christlichen Kirchen leiten daraus ab, dass die Dienstgemeinschaft aus drei Grunddiensten besteht. Dazu zählen die Verkündigung des Evangeliums, der Gottesdienst und der aus dem Glauben erwachsende Dienst am Mitmenschen.60 Um diese Grunddienste zu verwirklichen, existieren kirchliche Einrichtungen. Die Mitarbeiter, die in ihnen tätig sind, tragen dazu bei, dass der Sendungsauftrag der Kirchen erfüllt werden kann.61 Da die Dienstgemeinschaft die Bejahung und Anerkennung des Sendungsauftrags der Kirche voraussetzt, geht es im kirchlichen Dienst nicht nur um einen sachgerechten Einsatz von Personal, sondern auch um die aus der Überzeugung und Kraft des Glaubens erwachsende Arbeit in der Erfüllung des Auftrags Christi.62
Die Dienstgemeinschaft ist somit sinnbildlich für die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung im kirchlichen Dienst zu verstehen, die sich sowohl auf eine interne als auch auf eine externe Komponente erstreckt.63 Intern verbindet sie alle in einer kirchlichen Einrichtung Tätigen zu einer Gemeinschaft. Deshalb steht nicht die im weltlichen Arbeitsrecht vorherrschende „Bipolarität“ zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Fokus des kirchlichen Arbeitsrechts, sondern eine „Multipolarität“, d. h. eine Tätigkeit in der Gemeinschaft sowie eine Tätigkeit als Gemeinschaft.64
Dagegen verdeutlicht die externe Komponente der Dienstgemeinschaft, dass bei Wahrnehmung einer kirchlichen Tätigkeit die Erfüllung des Sendeauftrags der Kirchen eine gleichwertige Rolle spielt.65 Nach christlichem Selbstverständnis wird schließlich durch jede Tätigkeit der Mitarbeiter ein Stück des kirchlichen Auftrags in der Welt verwirklicht.66 Basierend auf dem Gedanken der Dienstgemeinschaft wird im kirchlichen Arbeitsrecht von „Dienstverhältnis“, „Dienstgeber“ und „Dienstnehmer“ gesprochen.
Die Dienstgemeinschaft prägt zwar das Dienstverhältnis, ist aber nicht als eigenständige Rechtsquelle dessen zu verstehen. Dennoch kann die Kirche den Gedanken der Dienstgemeinschaft ihren privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen zugrunde legen und dadurch das kirchliche Selbstverständnis vertragsrechtlich absichern.67 Diese Befugnis geht aber nicht so weit, als dass die Kirchen weltliches Arbeits- und Zivilrecht überwinden können. Die Besonderheit besteht vielmehr darin, dass sie ihre Dienstverhältnisse im Rahmen des für alle geltenden Rechts frei gestalten können. Nur deshalb und innerhalb dieser Grenzen kann ein kirchlicher Arbeitgeber von seinen Dienstnehmern Voraussetzungen für die Beschäftigung verlangen, Anforderungen an die Ausführung der kirchlichen Tätigkeit stellen und etwa eigene kollektivrechtliche Wege gehen, die ein säkularer Arbeitgeber nicht verlangen oder wählen darf.68 Der Kirche wird dadurch garantiert, dass die religiöse Dimension der Dienstgemeinschaft innerhalb der weltlichen Rechtsordnung und in einem marktwirtschaftlich organisierten Arbeitsleben anerkannt wird.69 Andersherum endet die staatliche Regelungskompetenz kirchlicher Arbeitsverhältnisse dort, wo eine Entscheidung über Wesen und Auftrag der Kirche getroffen wird.70
Grundlage des Verhältnisses von Dienstnehmer und Dienstgeber im kirchlichen Dienst ist somit der weltliche Dienstvertrag nach § 611 Abs. 1 BGB mit all seinen weltlichen Möglichkeiten und Grenzen. Das so geschlossene Arbeitsverhältnis wird jedoch maßgeblich durch die „Gemeinschaft des Dienstes“ beeinflusst. Folglich grenzt das Zusammenspiel von Gemeinschaftsvorstellung und Tätigkeit im Sinne Jesu Christi den kirchlichen Dienst vom säkularen Arbeitsverhältnis ab und begründet nicht nur im Individualarbeitsrecht, sondern auch im kollektiven Arbeitsrecht eine Sonderstellung der Kirchen.71 Um den Stellenwert der Dienstgemeinschaft zu verdeutlichen, haben beide christlichen Kirchen den Leitgedanken fest in ihren Grundordnungen verankert. Die evangelische Kirche hat in § 2 des „Kirchengesetz[es] über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie“ (Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz – ARGG) die Dienstgemeinschaft als „Partnerschaftliche Festlegung der Arbeitsbedingungen“ normiert. In der katholischen Kirche ordnet § 1 der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse (GrOkathK) an, dass der Gedanke der Dienstgemeinschaft als Grundprinzip der arbeitsrechtlichen Beziehungen dient. Zudem enthalten die Dienstverträge regelmäßig in der Präambel oder im ersten Abschnitt einen Verweis auf die Dienstgemeinschaft. So heißt es etwa in § 1 des Musterregelarbeitsvertrages der (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster (westfälischer Teil) und Paderborn:
„Der Dienst in der katholischen Kirche erfordert von der/dem Dienstgeber/in und der/dem Mitarbeiter/in die Bereitschaft zu gemeinsam getragener Verantwortung und vertrauensvoller Zusammenarbeit unter Beachtung der Eigenart, die sich aus dem Auftrag der Kirche und ihrer besonderen Verfasstheit ergibt.“72
Dadurch stellen die Kirchen auch nach außen sichtbar ihre Arbeitsverhältnisse auf das Fundament der Dienstgemeinschaft und begründen so die Besonderheit des kirchlichen gegenüber dem weltlichen Arbeitsrecht.73