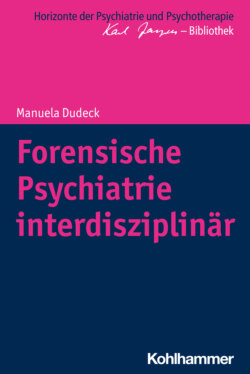Читать книгу Forensische Psychiatrie interdisziplinär - Manuela Dudeck - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.2 Religion und Religiosität
ОглавлениеObwohl eine der provokantesten Prognosen der Moderne besagt, dass Religion als das in der Menschheitsgeschichte erste »primitive« Stadium bald verschwinden werde, zeigt sich, dass Religion nach wie vor einen Mechanismus darstellt, einen prosozialen Verhaltenskodex zu definieren (Montada 2002, Sosis 2004). Religiosität beschreibt das subjektive Erleben des Einzelnen in Bezug auf eine Religion. Forschungsergebnisse konnten zeigen, dass ein höherer Grad an Religiosität mit einer stärker ausgeprägten Selbstkontrolle zusammenhängen kann (Laird 2011, Reisig 2012, Rounding 2012). Es besteht weitestgehend Einigkeit darüber, dass ein höheres Maß an Religiosität (ob nun durch verhaltensbasierte Messinstrumente oder durch Selbstberichte erfasst) in einem negativen Zusammenhang mit Delinquenz und strafrechtlich relevantem Verhalten wie Drogenkonsum steht, obwohl fast ausschließlich Heranwachsende untersucht wurden (Chitwood et al. 2008, Johnson & Jang 2011, Kelly et al. 2015). Franke und Kollegen konnten anhand einer Stichprobe männlicher, suchtkranker Maßregelpatienten zeigen, dass das Ausmaß an Religiösität auch hier negativ mit der Einstellung gegenüber appetitiver Aggression korreliert, leider aber nicht mit dem tatsächlichen Verhalten. In der Stichprobe weiblicher, suchtkranker Maßregelpatientenwurden keinerlei signifikante Zusammenhänge gefunden (Franke et al. 2019).
Evolutionär betrachtet, stellt sich im Hinblick auf Religion zunächst die Frage, warum diese überhaupt existiert und sich über alle Zeiten hinweg als kulturelle Variable identifizieren lässt (Boyer & Bergstrom 2008). Offensichtlich stellt diese einen Nutzen für die Angepasstheit von Menschen in einer sozialen Gruppe dar (McCullough & Carter 2013). Religion stärkt die soziale Kohäsion, indem eine emotionale, kognitive und kulturelle Synchronisation erfolgt. Nebenher wird die soziale Kooperation gefördert und die Konkurrenzfähigkeit nach außen gefestigt. Religiöse Glaubenssysteme, Institutionen und Rituale ko-evolvierten mit der Entstehung von Gesellschaften, die größer waren als die in der Periode der Jäger und Sammler üblichen blutsverwandten Stämme, welche selten eine Zahl von 150 Mitgliedern überschritten (Dunbar 2003, Norenzayan & Shariff 2008, Henrich et al. 2010). McCullough und Carter (2013, 2014) argumentierten, dass der Übergang vom nomadischen Jäger- und Sammler-Lebenswandel in kleinen Gruppen zum sesshaften Siedler- und Ackerbauer-Lebenswandel in großen, dauerhaften Siedlungen einen evolutionären Druck erzeugte, das eigene Verhalten stärker zu kontrollieren. Nur durch die Entwicklung von Fähigkeiten wie Kooperieren, Tolerieren und Warten konnte eine gewisse Ordnung hergestellt und aufrechterhalten werden. Eine Kooperation in großen Gruppen, die nicht ausschließlich aus Blutsverwandten zusammengesetzt ist, erfordert zwingend die Lösung für das sogenannte Trittbrettfahrerproblem (Gintis et al. 2003, McNamara 2006). Trittbrettfahrer bzw. Nutznießer sind Mitglieder der jeweiligen Gesellschaft, welche die durch die Kooperation erzeugten Vorteile zwar nutzen, aber selbst nichts zur Kooperation beitragen (McNamara 2006). Trittbrettfahren ist überall dort von Bedeutung, wo es öffentliche Güter gibt. Beispiele für öffentliche Güter waren früher Deiche, etwaige Befestigungsanlagen einer Siedlung oder der Zugang zum Wildbestand in einem bestimmten Gebiet (vorausgesetzt, die Jagd war jedem gestattet). Die Bereitstellung öffentlicher Güter kann als grundlegendste Aufgabe einer Gesellschaft angesehen werden (Olson 1968), sie stellt einen wesentlichen Faktor dar, der, evolutionär gesehen, die Entwicklung vom Nomaden zum Siedler ermöglicht hat. Öffentliche Güter zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass von ihrer Nutzung kein Mitglied der Gesellschaft ausgeschlossen werden kann (Samuelson 1954). Hieraus ergibt sich, dass dem Käufer dieses Gutes kein Eigentumsrecht daran zugewiesen wird; jedes andere Mitglied der betreffenden Gesellschaft kann das Gut ebenfalls nutzen, weil es Teil der Gesellschaft ist (Olson 1968). Diese Eigenschaft ermöglicht erst das Trittbrettfahren und ist im eigentlichen Sinne antisozial. Je größer eine Gruppe ist, desto weniger wird das Trittbrettfahren kontrollierbar und desto häufiger wird es beobachtet (Ledyard 1995).
In kleinen Gruppen, in denen ausschließlich Blutsverwandte zusammenleben, stellt sich das Trittbrettfahrerproblem dank der durch die kleine Gruppengröße geringen Überwachungskosten und des genetisch bedingten Altruismus’ unter Verwandten kaum (McCullough & Carter 2013, Lieberman et al. 2007). In großen Gruppen wird jedoch ein starker Kontrollmechanismus zum Schutz dringend benötigt. Religion und Religiosität oder präziser formuliert, die kostenintensiven religiösen Verhaltensweisen stellen einen solchen Mechanismus dar (Sosis 2004, McNamara 2006). Individuen, die Mitglieder der Gruppe werden und von der Kooperation profitieren wollen, müssen sich dieser Auffassung zufolge zu derjenigen Religion bekennen, die als Verhaltenskodex dient und u. a. kooperatives Verhalten vorschreibt. Dieses Bekenntnis müssen alle immer wieder durch die Ausführung der ebenfalls vorgeschriebenen kostenintensiven Verhaltensweisenglaubhaft beweisen. Das funktioniert aber nur in dem Ausmaß, in dem die geforderten Verhaltensweisen signifikante Kosten beinhalten. Denn nur teure Verhaltensweisen können Signale des Bekenntnisses zum Verhaltenskodex sein und sind nur schwer vorzutäuschen und daher als glaubwürdig einzustufen (Zahavi & Zahavi 1998). Ein Individuum zeigt so durch wiederholtes Ausführen dieser kostspieligen Verhaltensweisen an, dass es gewillt ist, nicht-kooperatives also antisoziales Betragen zu vermeiden.
So erfüllen Verhaltensweisen wie lange vorgeschriebene Fastenperioden, schmerzhafte Rituale oder andere asketische Praktiken, die aus evolutionärer Sicht zunächst nachteilig erscheinen, eine sehr wichtige soziale Kontrollfunktion gerade wegen ihrer Kostspieligkeit. Sie stellen den Preis dar, der für die Kooperation und die damit einhergehenden Vorteile zu zahlen ist. Gruppen, die sich einem religiösen Verhaltenskodexunterwerfen und so eine erfolgreiche Kooperation ermöglichen, verschaffen sich damit gegenüber anderen Gruppen einen deutlichen evolutionären Vorteil (McCullough & Carter 2013).
Die Vorstellung einer Gottheit als moralische Instanz, die über das Verhalten eines jeden Einzelnen wacht, ist hierbei besonders effektiv, um Kooperation sicherzustellen. Eine solche Gottheit, die das Benehmen des Individuums auch dann beobachtet und bewertet, wenn es keine (menschlichen) Zeugen gibt, verringert den notwendigen sozialen Überwachungsaufwand um ein Vielfaches (McCullough & Carter 2013). Dieser Zusammenhang wird u. a. dadurch belegt, dass Vorstellungen von derartigen moralisierenden Gottheiten mit verschiedenen Kennzahlen gesellschaftlicher Komplexität wie z. B. Gruppengröße oder Verwendung von Zahlungsmitteln positiv korrelieren (Johnson 2005). Außerdem fällt die Wandlung der Gottesvorstellung in eine moralische Instanz mit der Entstehung großer menschlicher Gesellschaften zusammen (Henrich et al. 2010). In diesem Zusammenhang werden die zehn Gebote, auch Dekalog genannt, die eine Reihe von Geboten und Verboten Gottes darstellen, die Kirchen- und Kulturgeschichte nicht nur in Europa entscheidend mitgeprägt haben. Sie stellen aus heutiger Sicht eine Art Verfassungsentwurf für das Zusammenleben in einer Zivilgesellschaft dar.
Der Wille, bestimmte eigennützige, egozentrische und antisoziale Verhaltensweisen zu vermeiden, ist für die erfolgreiche Kooperation zugegebenermaßen nicht hinreichend. Vielmehr erfordert eine erfolgreiche Kooperation die Hemmung nicht-kooperativen, impulsiven, aggressiven oder antisozialen Verhaltens – eine Funktion, die als Selbstkontrolle bezeichnet wird (Baumeister et al. 2007, McCullough & Willoughby 2009). Neuropsychologisch betrachtet, nimmt für diese Funktion der präfrontale Kortex (PFC) im menschlichen Gehirn eine zentrale Stellung ein (McNamara 2006). Selbstkontrolle bezeichnet die Fähigkeit, die eigenen Antworten zu ändern, insbesondere um sie mit Normen wie Idealen, Werten, Moral und sozialen Erwartungen in Einklang zu bringen und die Verfolgung langfristiger Ziele zu unterstützen (Baumeister et al. 2007). Die Selbstkontrolle ist allerdings von der Selbstregulation, unter der nach McCullough & Willoughby (2009) der Prozess verstanden wird, bei welchem ein System aufgrund der Information über den gegenwärtigen Zustand seine Funktion selbst anpasst, zu unterscheiden. Selbstkontrolle wird üblicherweise als spezifische Form der Selbstregulation aufgefasst, die dadurch gekennzeichnet ist, dass diese in erster Linie die bewusste und zielgerichtete Hemmung von präpotenten Verhaltensweisen (Verhaltenstendenzen, Emotionen, Motivationen) im aktuellen Moment betrifft (Baumeister et al. 2007, McCullough & Willoughby 2009). Solche präpotenten Verhaltensweisen treten bei Kooperationsproblemen regelmäßig auf, etwa wenn es um die Verlockung geht, von einem öffentlichen Gut einen größeren Anteil zu entnehmen als den, der dem Individuum zusteht (Döringer 2016). Um hierfür eine Lösung zu finden, benötigt der Mensch die neuropsychologischen Funktionen des präfrontalen Kortex, woraus sich aus philosophischer Sicht die Frage ergibt, wo genau morphologisch wie funktionell das Konstrukt der Moral im Gehirn zu verorten ist (Declerck et al. 2013). Das wirft wiederum die Frage auf, ob und inwieweit Moral naturalisiert werden kann. DeQuervain und Kollegen fanden 2004 in einem Vertrauensspiel heraus, dass z. B. der Akt der Bestrafung mit einer erhöhten Aktivität im dorsalen Striatum einhergeht und dass diese umso höher ist, wenn man viel dafür investiert. King-Casas et al. (2005) suchten in ihrer Studie nach neuronalen Korrelaten von Vertrauen und konnten diese ebenfalls im dorsalem Striatum verorten. Aber wie können wir nun Moral definieren, die sich offenbar an verschiedenen Orten im menschlichen Gehirn abbilden lässt?