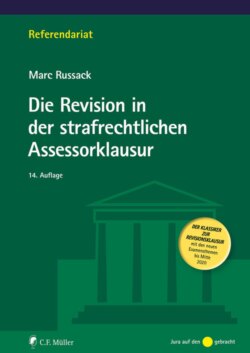Читать книгу Die Revision in der strafrechtlichen Assessorklausur - Marc Russack - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V. Ordnungsgemäße Revisionseinlegung
Оглавление27
Die Revision muss nach § 341 Abs. 1 StPO innerhalb einer grundsätzlich mit Urteilsverkündung beginnenden Frist von einer Woche bei dem Gericht, dessen Urteil angefochten wird, zu Protokoll der Geschäftsstelle oder schriftlich eingelegt werden.
28
1. Revisionseinlegung ist jede Erklärung, die den Anfechtungswillen des Beschwerdeführers erkennen lässt (M-G/S § 341 Rn. 1). Dieser kann daher fristgemäß zunächst lediglich „Rechtsmittel“ einlegen. Eine solche – in Klausuren regelmäßig abgefragte – unbestimmte Anfechtung des Urteils, bei der der Rechtsmittelführer die Wahl zwischen Berufung und Revision zunächst offenlässt, ist zulässig, weil er die Entscheidung über das geeignete Rechtsmittel in der Regel erst nach Kenntnis des schriftlichen Urteils sinnvoll treffen kann. Die endgültige Wahl kann dann bis zum Ablauf der Revisionsbegründungsfrist getroffen werden. Geschieht dies allerdings nicht fristgerecht, so wird das Rechtsmittel als Berufung durchgeführt (vgl. M-G/S § 335 Rn. 2-4).
29
In Revisionsklausuren ist daher deutlich zu machen, dass die Bestimmung des Rechtsmittels als Revision – falls noch nicht geschehen – bis zum Ablauf der Revisionsbegründungsfrist vorgenommen werden muss. Bis zu diesem Zeitpunkt wäre aus dem genannten Grund im Übrigen auch der Übergang von der zunächst eingelegten Berufung zur Revision möglich (vgl. M-G/S § 335 Rn. 10). Aufbautechnisch bietet es sich an, die vorgenannte Thematik komplett schon i.R. des § 341 StPO abzuhandeln.
30
2. Da Adressat der Revisionseinlegung ausschließlich das Gericht ist, dessen Urteil angefochten wird („iudex a quo“), ist der Zeitpunkt des Eingangs der bei anderen Gerichten oder der Staatsanwaltschaft eingehenden Rechtsmittelerklärungen von vornherein unbeachtlich. In diesen Fällen kommt es für die Fristwahrung darauf an, ob das Schriftstück an den „iudex a quo“ weitergeleitet wird und diesem noch innerhalb der Einlegungsfrist zugeht (vgl. M-G/S vor § 42 Rn. 16).
31
In einer zum Thema gestellten Klausur hatte der Verteidiger in seinem am letzten Tag der Wochenfrist bei der landgerichtlichen Posteingangsstelle eingegangenen Revisionseinlegungsschriftsatz zwar das angefochtene Urteil mit Datum und Strafkammer eindeutig bezeichnet, versehentlich aber das Aktenzeichen eines landgerichtlichen Zivilverfahrens angegeben. Das Schreiben gelangte deshalb erst mit einigen Tagen Verzögerung zum betreffenden Schwurgericht. Da § 341 Abs. 1 StPO aber nur auf den Eingang bei dem „Gericht“ abstellt, ist für die Rechtzeitigkeit der Revisionseinlegung allein entscheidend, wann der Schriftsatz zur gerichtlichen Posteingangsstelle gelangt. Die Angabe des unrichtigen Aktenzeichens schadete also nicht (vgl. M-G/S § 341 Rn. 12).
32
3. a) Die Form der Revisionseinlegung kann zunächst durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des zuständigen Gerichts gewahrt werden. Dies hat eigentlich in der Weise zu geschehen, dass der Rechtsmittelführer den hierfür eigens zuständigen Rechtspfleger (§ 24 Abs. 1 Nr. 1b RPflG) persönlich aufsucht und erst dort die dann in bestimmter Form (vgl. M-G/S Einl. Rn. 135) zu protokollierende Rechtsmittelerklärung abgibt.
33
In Klausurfällen wird der beschriebene Ablauf allerdings meist in der Form variiert, dass der Angeklagte die Revisionseinlegung noch in der Hauptverhandlung selbst erklärt und diese in der Sitzungsniederschrift – und damit gerade nicht durch den Rechtspfleger – protokolliert wird. Dieses Vorgehen kann die Protokollierung durch die Geschäftsstelle jedoch deshalb wirksam ersetzen, weil die Wahrnehmung eines dem Rechtspfleger übertragenen Geschäftes durch den Richter – hier in Form des richterlichen Protokolls (§ 271 StPO) – dessen Wirksamkeit nach § 8 Abs. 1 RPflG nicht berührt (vgl. M-G/S Einl. Rn. 137).
34
In einem anderen Klausurfall war das Problem in umgekehrter Weise variiert: Das Protokoll der Geschäftsstelle war anstelle des zuständigen Rechtspflegers nicht vom Richter, sondern von einer Justizangestellten gefertigt worden. Da § 8 Abs. 1 RPflG hier natürlich nicht weiterhalf, fand sich im Protokoll unter dem von der Justizangestellten verfassten Text die Unterschrift des Angeklagten („selbst gelesen und genehmigt“), so dass die Rechtsmitteleinlegung als eigene schriftliche Erklärung gewertet werden konnte (vgl. M-G/S § 341 Rn. 7).
35
b) Fast ausschließlich erfolgen Revisionseinlegungen in Klausuren allerdings schriftlich durch den Verteidiger oder aber den Angeklagten selbst, der diese Prozesserklärung auch vollkommen selbständig vornehmen kann. Unregelmäßigkeiten ereignen sich in diesem Zusammenhang selten. Zur Schriftform gehört, dass aus dem Schriftstück der Inhalt der Erklärung, die abgegeben werden soll, und die Person, von der sie ausgeht, schon im Zeitpunkt des Eingangs der Erklärung bei Gericht hinreichend zuverlässig entnommen werden können. Im Gegensatz zu § 345 Abs. 2 StPO ist hier also eine handschriftliche Unterzeichnung nicht erforderlich, solange feststeht, dass das Schriftstück dem Gericht mit Wissen und Willen des Berechtigten zugeleitet worden ist (vgl. M-G/S Einl. Rn. 128).[1] Die Schriftform kann im Übrigen auch durch Übermittlung der Revisionseinlegungsschrift durch Telefax eingehalten werden. Das Original muss dann aber handschriftlich unterschrieben sein und das Telefaxschreiben diese Unterschrift enthalten (vgl. M-G/S Einl. Rn. 139a).
36
Einschlägige Klausurfälle sind mitunter so gestaltet, dass der Revisionseinlegungsschriftsatz dem Gericht vom Verteidiger kurz vor Ablauf der maßgeblichen Frist „vorab per Telefax“ übermittelt wird. So ergab sich aus dem Bearbeitungsvermerk einer Klausuraufgabe beispielsweise, dass die Revisionseinlegungsschrift „per unterschriebenem Telefax am 14. Mai und mit gesondertem Schriftsatz am 16. Mai“ beim zuständigen Gericht eingegangen war. Da die Einlegungsfrist hier genau am 15. Mai abgelaufen war, kam es i.R. des § 341 StPO maßgeblich auf das Telefaxschreiben an. Unter ausdrücklichem Rückgriff auf den vorbezeichneten Bearbeitungsvermerk konnte hier davon ausgegangen werden, dass der Rechtsanwalt das Original des Einlegungsschreibens unterschrieben hatte – die Voraussetzungen für einen formgerechten Eingang des Telefaxschreibens innerhalb der Revisionseinlegungsfrist also vorlagen.
37
Letztlich nur durch den Übermittlungsweg unterschied sich die Situation in dem Klausurfall, in dem der Verteidiger seine (unterschriebene) Revisionseinlegungsschrift eingescannt und die Bilddatei als Anhang einer E-Mail an das Gericht gesendet hatte, wo sie ausgedruckt und fristgerecht zu den Akten genommen worden war. Der Ausdruck – nicht die Bilddatei – stellte das schriftliche Dokument dar, das nur elektronisch übermittelt worden war und die vorgenannten Voraussetzungen der Schriftform ohne weiteres erfüllte.
38
In einem anderen Klausurfall war die Revisionseinlegungsschrift per Computerfax übermittelt worden – der Schriftsatz war also am Computer erstellt, mit einer eingescannten Unterschrift der Verteidigerin versehen und sodann ohne vorherigen Ausdruck unmittelbar vom Rechner auf ein Faxgerät des betreffenden Gerichts übermittelt worden. Auch diese Übertragungsform genügt dem Schriftformerfordernis (vgl. M-G/S Einl. Rn. 128, 139a). Insoweit kommt es nämlich nicht darauf an, ob am Sendeort eine physisch greifbare Kopiervorlage oder nur eine im Computer befindliche Datei existiert, maßgeblich ist allein die am Empfangsort erstellte körperliche Urkunde. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere die Person des Erklärenden in der Regel dadurch eindeutig bestimmt, dass ihre Unterschrift eingescannt oder der Hinweis angebracht ist, dass der benannte Urheber wegen der gewählten Übertragungsform nicht unterzeichnen kann[2] – der Inhalt der Erklärung bleibt von der gewählten Übertragungsform ohnehin unberührt. Auch der Wille der Verteidigerin, dem Gericht das betreffende Schreiben zuzuleiten, konnte im Klausurfall schon deshalb nicht in Zweifel gezogen werden, da der Schriftsatz dort einen Tag nach Fristablauf im Original einging.
39
4. a) Die einwöchige Revisionseinlegungsfrist beginnt in den meisten Klausurfällen nach der gesetzlichen Grundregel des § 341 Abs. 1 StPO mit der Verkündung des Urteils. Nur wenn diese nicht in Anwesenheit des Angeklagten stattgefunden hat, beginnt die Frist nach § 341 Abs. 2 StPO ausnahmsweise erst mit der Zustellung des Urteils. Diese Voraussetzung ist auch gegeben, wenn der Angeklagte sich vor dem Ende der mündlichen Urteilsbegründung (vgl. § 268 Abs. 2 S. 1 StPO) eigenmächtig entfernt oder – etwa i.R. des § 231b StPO – entfernt wird (vgl. M-G/S § 341 Rn. 9). In diesem Rahmen können dann die unten[3] im Zusammenhang mit § 345 Abs. 1 S. 2 StPO erörterten Gründe für die Unwirksamkeit der Urteilszustellung Bedeutung auch schon für die Rechtzeitigkeit der Revisionseinlegung gewinnen.
40
In einem zu § 341 Abs. 2 StPO gebildeten Klausurfall war die Hauptverhandlung nach § 231 Abs. 2 StPO ohne den Angeklagten zu Ende geführt worden, weil dieser sich vor der Urteilsverkündung entfernt hatte. Ob dieses Vorgehen rechtlicher Überprüfung standhielt – der Angeklagte insoweit insbesondere eigenmächtig gehandelt hatte –, war für die Anwendung des § 341 Abs. 2 StPO ohne Bedeutung, da es i.R. dessen Hs. 1 nur auf die rein faktische Abwesenheit des Angeklagten während der Urteilsverkündung ankommt. Dass der Verteidiger des Angeklagten bis zum Ende der Hauptverhandlung anwesend war, stand der Anwendung des § 341 Abs. 2 StPO daher ebenso wenig entgegen (vgl. M-G/S § 341 Rn. 9). Erschwert wurde diese Klausuraufgabe zusätzlich noch dadurch, dass die anschließende Urteilszustellung sowohl an den Angeklagten als auch an den Verteidiger erfolgt war und die Einlegungsfrist überhaupt nur noch bei Zugrundelegung des Datums der letztgenannten Zustellung eingehalten werden konnte. Hier kam es auf § 37 Abs. 2 StPO an, nach dem sich die Berechnung einer Frist im Fall der – an sich nicht zugelassenen (vgl. § 145a Abs. 3 StPO) – Doppelzustellung nach der zuletzt bewirkten Zustellung richtet. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift waren erfüllt, da beide Zustellungen wirksam waren – hinsichtlich der Zustellung an den Wahlverteidiger musste hier auf § 145a Abs. 1 StPO und die sich laut Bearbeitungsvermerk bei den Akten befindliche Vollmacht abgestellt werden – und die durch die erste Zustellung an den Angeklagten eröffnete Einlegungsfrist zum Zeitpunkt der zweiten Zustellung an den Verteidiger noch nicht abgelaufen war (vgl. M-G/S § 37 Rn. 29). Die Vorschrift des § 37 Abs. 2 StPO kann im Einzelfall natürlich – darauf sei schon in diesem Zusammenhang hingewiesen – ebenso gut auch der „Rettung“ der Revisionsbegründungsfrist des § 345 Abs. 1 S. 2 StPO dienen.
41
Zu beachten ist aber, dass die Revisionseinlegungsfrist nach § 341 Abs. 2 StPO auch bei Urteilsverkündung in Abwesenheit des Angeklagten ausnahmsweise wieder mit der Verkündung des Urteils beginnt, wenn diese in den dafür gesetzlich vorgesehenen Fällen in Anwesenheit des Verteidigers mit nachgewiesener Vertretungsvollmacht stattgefunden hat. Von den in der Vorschrift genannten Vertretungskonstellationen dürfte in Klausuren ausschließlich diejenige des § 234 StPO Bedeutung haben – und zwar i.V. mit den prüfungsrelevanten §§ 231 Abs. 2, 231b Abs. 1 StPO. War der Angeklagte also unter den Voraussetzungen dieser Vorschriften eigenmächtig bzw. wegen ordnungswidrigen Benehmens abwesend, so endet die Einlegungsfrist schon eine Woche nach Urteilsverkündung, wenn dem Gericht schon bei Beginn der Hauptverhandlung eine den anwesenden Verteidiger betreffende Vertretungsvollmacht nachgewiesen war (vgl. M-G/S § 234 Rn. 5).
42
Dies gilt aber nur für den Fall, dass das Gericht befugt in Abwesenheit des Angeklagten verhandelt hatte, da die Hauptverhandlung – wie in § 234 StPO vorausgesetzt – nur dann „ohne Anwesenheit des Angeklagten stattfinden kann“ (vgl. M-G/S § 234 Rn. 1). Hätte das Gericht den Angeklagten im Klausurfall also nach Beschlussfassung gemäß § 231 Abs. 2 StPO in Anwesenheit lediglich des vertretungsbevollmächtigten Verteidigers durch dem Angeklagten am 1. Juli 2020 zugestellte Entscheidung vom 1. Juni 2020 verurteilt, so wäre eine erst am 6. Juli 2020 eingelegte Revision entgegen erstem Anschein nicht verfristet, wenn sich bei der verfahrensrechtlichen Überprüfung ergäbe, dass der Angeklagte sich nicht – wie i.R. des § 231 Abs. 2 StPO vorausgesetzt – eigenmächtig entfernt hatte. Mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 341 Abs. 2 Hs. 2 StPO hätte die Einlegungsfrist in diesem Fall nach § 341 Abs. 2 Hs. 1 StPO erst mit Ablauf des 8. Juli 2020 geendet.
43
b) Das Ende der Revisionseinlegungsfrist berechnet sich nach § 43 StPO. Die Grundregel des § 43 Abs. 1 StPO bedeutet für die Wochenfrist des § 341 Abs. 1 StPO, dass gegen ein beispielsweise an einem Montag verkündetes Urteil bis zum Ablauf des folgenden Montags Revision eingelegt werden kann. Nur wenn das Ende der Wochenfrist auf einen Samstag, Sonntag oder allgemeinen Feiertag fällt, endet die Einlegungsfrist nach § 43 Abs. 2 StPO erst mit Ablauf des nächsten Werktags. An diese recht häufig abgefragte Vorschrift sollte in Fällen einer Überschreitung des sich aus § 43 Abs. 1 StPO ergebenden Fristendes immer zuerst gedacht werden, wobei auf den den Klausuraufgaben üblicherweise beigefügten Jahreskalender zurückgegriffen werden kann. Für die Rechtzeitigkeit der Revisionseinlegung kommt es im Übrigen – was die Prüflinge häufig verkennen – auf den Eingang beim zuständigen Gericht und nicht auf das Datum der Rechtsmittelerklärung selbst an. Im Klausurtext ist das maßgebliche Datum regelmäßig entweder dem Bearbeitungsvermerk oder dem auf dem Einlegungsschriftsatz angebrachten Eingangsstempel zu entnehmen.
44
c) Ist die Revisionseinlegungsfrist im Klausurfall tatsächlich einmal versäumt, so wird regelmäßig eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu prüfen sein.
45
aa) Auch bei der Prüfung einer Wiedereinsetzung sollte aufbautechnisch sauber zwischen deren Zulässigkeit und Begründetheit unterschieden werden.
46
(1) Zur Zulässigkeit eines Wiedereinsetzungsantrags gehört die Antragstellung innerhalb einer Woche nach Wegfall des Hindernisses – in der Regel der Unkenntnis, auf der die Fristversäumung beruht – (§ 45 Abs. 1 StPO), die Revisionseinlegung innerhalb derselben Frist (§ 45 Abs. 2 S. 2 StPO) sowie die Glaubhaftmachung der Tatsachen zur Begründung des Antrags (§ 45 Abs. 2 S. 1 StPO) – letztere kann notfalls auch noch nach Ablauf der Antragsfrist nachgeholt werden. Diese in der Regel unproblematischen Voraussetzungen sollten in jedem Fall kurz dargestellt werden.
47
(2) Begründet ist der Wiedereinsetzungsantrag bei unverschuldeter Fristversäumung des Angeklagten (§ 44 S. 1 StPO). Zielt die Klausuraufgabe auf die Gewährung einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, muss also das Verschulden eines Dritten festzustellen sein (vgl. hierzu im Einzelnen M-G/S § 44 Rn. 15 ff.). So darf die Post für den Transport eines normalen Briefs in Anlehnung an § 270 S. 2 ZPO im Ortsverkehr nicht länger als einen Werktag und im Übrigen – auch bei größerer innerdeutscher Entfernung – nicht länger als zwei Werktage benötigen. Ein Verschulden der Justiz kann etwa bei Unterbleiben der nach § 35a S. 1 StPO erforderlichen Rechtsmittelbelehrung (vgl. § 44 S. 2 StPO), dem Unterlassen der Mitteilung an den Verteidiger nach § 145a Abs. 3 S. 2 StPO oder in bestimmten Fällen der Unwirksamkeit eines Rechtsmittelverzichts[4] vorliegen. Fehler des Verteidigers oder dessen Angestellter, die dem Angeklagten anders als gemäß § 85 Abs. 2 ZPO im Zivilprozess nicht zugerechnet werden, können etwa darin liegen, dass Rechtsmittelschriften irrtümlich nicht abgesendet oder erst gar nicht gefertigt werden. Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass ein die Wiedereinsetzung ausschließendes Mitverschulden darin liegen kann, dass dem Angeklagten auf Grund besonderer Umstände eine mögliche Fristversäumnis auf Seiten des Verteidigers erkennbar war.
48
So hatte der Angeklagte den Rechtsmittelauftrag in einem Klausurfall innerhalb der Revisionseinlegungsfrist durch einen Telefonanruf erteilt, der während einer Betriebsfeier von einer „angeheiterten“ Bürokraft des Verteidigers entgegengenommen wurde, die den Anruf vergaß und den Anwalt nicht informierte: Zwar hätten die Umstände des Telefongespräches dem Angeklagten hier möglicherweise Anlass geben können, sich am nächsten Werktag bei seinem Verteidiger über die Einlegung des Rechtsmittels zu vergewissern. Da die Rechtsprechung § 44 StPO im Interesse materieller Gerechtigkeit aber großzügig anwendet (vgl. M-G/S § 44 Rn. 11), ließ sich ein Mitverschulden des Angeklagten – das im Übrigen auch wegen des ansonsten erforderlichen Hilfsgutachtens klausurtaktisch wenig wünschenswert gewesen wäre – im Hinblick auf die Versicherung der Bürokraft, den Anwalt schnellstmöglich zu unterrichten, mit guten Gründen verneinen.
49
bb) Zu beachten ist im Übrigen, dass das Revisionsgericht (§ 46 Abs. 1 StPO) die Wiedereinsetzung bei Vorliegen aller anderen Voraussetzungen des § 45 StPO – also insbesondere bei frist- und formgerechter Nachholung der versäumten Prozesshandlung – nach § 45 Abs. 2 S. 3 StPO auch ohne ausdrücklichen Antrag von Amts wegen gewähren kann. Eine derartige Konstellation ist aus Sicht der Prüfungsämter – da dann kein besonderes prozessuales Geschehen auf die Problematik des § 44 StPO hinweist – besonders interessant. Ein insoweit einschlägiger Klausurfall betraf allerdings die nachfolgend erörterte Revisionsbegründungsfrist:
50
Eine Revisionsbegründungsschrift, mit der die allgemeine Sachrüge erhoben worden war,[5] war bei Gericht zwar fristgerecht, aber ohne die hier nach § 345 Abs. 2 StPO zwingend erforderliche Unterschrift des Verteidigers eingegangen, wovon dieser ausweislich eines auf dem Schriftsatz angebrachten Vermerks der Geschäftsstellenbeamtin nach Ablauf der Revisionsbegründungsfrist telefonisch benachrichtigt worden war. Der Verteidiger holte die Unterschrift daraufhin noch am selben Tag nach – auch das ergab sich aus einem Vermerk – und versicherte gleichzeitig in einer ebenfalls auf der Begründungsschrift angebrachten schriftlichen Erklärung, dass seine Kanzleikräfte das Schreiben irrtümlich ununterschrieben zur Gerichtspost gelegt hätten. Da die versäumte Revisionsbegründung durch die Nachholung der Unterschrift hier sogar noch vor Beginn der – nur durch die Kenntnis des Angeklagten selbst in Gang zu setzenden (vgl. M-G/S § 45 Rn. 3) – Wochenfrist des § 45 Abs. 1 S. 1 StPO nachgeholt und das fehlende Verschulden des Angeklagten zugleich glaubhaft gemacht wurde, war die Wiedereinsetzung gemäß § 45 Abs. 2 S. 3 StPO auch ohne – den in der Klausuraufgabe nicht enthaltenen – Antrag zu gewähren.
51
d) Eine in der Klausuraufgabe einfach zu konstruierende Komplikation kann schließlich auch darin liegen, dass der Eingang des Revisionseinlegungsschreibens bei Gericht zeitlich nicht mehr nachvollzogen werden kann – etwa weil die Anbringung eines Eingangsstempels auf dem Schriftstück in der Wachtmeisterei versäumt wurde. Jedenfalls eine zu Gunsten des Angeklagten eingelegte Revision gilt in dieser Situation als rechtzeitig, da eine Verwerfung des Rechtsmittels die positive Überzeugung des Revisionsgerichts von dessen Unzulässigkeit voraussetzt. Ist demgegenüber bereits zweifelhaft, ob das Rechtsmitteleinlegungsschreiben überhaupt bei Gericht eingegangen ist, so muss das Rechtsmittel als unzulässig behandelt werden (vgl. M-G/S § 261 Rn. 35).
B. Zulässigkeit der Revision › VI. Mögliche Einhaltung der Revisionsbegründungsfrist