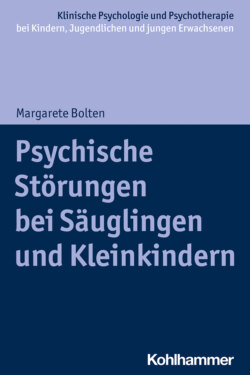Читать книгу Psychische Störungen bei Säuglingen und Kleinkindern - Margarete Bolten - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 Epidemiologie des exzessiven Schreiens
ОглавлениеVermehrtes Schreien des Säuglings ist einer der häufigsten Vorstellungsgründe in Kinderarztpraxen. Gemäß Papousek (2004) ist etwa in Deutschland jeder 4. bis 5. in den ersten drei Lebensmonaten ein exzessiv schreiender Säugling. Die Prävalenzzahlen schwanken dabei je nach Studie erheblich. Diese Differenzen lassen sich primär auf abweichende Definitionen, die verwendeten Diagnoseinstrumente bzw. die Altersspanne der untersuchten Kinder zurückführen. Reijneveld et al. (2001) verglichen Prävalenzraten in einer niederländischen Population für zehn verschiedene Operationalisierungen des exzessiven Schreiens und fanden Werte von 1,5–11,9 %.
Wird die 3er-Regel von Wessel ( Kap. 1) zur Definition herangezogen, liegen aktuelle Prävalenzzahlen in europäischen Ländern zwischen 1,5 % (Niederlande; Reijneveld et al., 2001), 9,2 % (Dänemark; Alvarez, 2004) und 16,3 % (Deutschland; von Kries, Kalies, & Papousek, 2006). Fazil (2011) fand in einer populationsbasierten Beobachtungsstudie in Pakistan Prävalenzzahlen von 21,7 % für das exzessive Schreien, erfasst mit der Wessel-Regel. Außerdem zeigten sich keine statistisch bedeutsamen Unterschiede zwischen exzessiv und normal-schreienden Säuglingen in Hinblick auf das Geschlecht, das Gestationsalter, das Geburtsgewicht, den Geburtsmodus und die Ernährungsform. Lediglich bei Erstgeborenen fanden sich signifikant höhere Prävalenzen für das exzessive Schreien.
Auch aufgrund der hohen Entwicklungsabhängigkeit der Symptomatik schwanken die Prävalenzzahlen für das exzessive Schreien sehr stark – je nach Alter der untersuchten Säuglinge. So fanden von Kries et al. (2006), dass von den untersuchten Säuglingen zwar 16,3 % innerhalb der ersten drei Lebensmonate exzessiv schrien, aber nur 5,8 % über den dritten und 2,5 % über den sechsten Lebensmonat hinaus. Olsen et al. (2019) untersuchten in einer dänischen Studie, die Häufigkeit von Komorbiditäten zwischen den drei Störungen Schrei-, Schlaf- und Fütterungstörungen in einer populationsbasierten Stichprobe von 2 598 Säuglingen im Alter von 2–6 Monaten. Sie fanden dabei Prävalenzzahlen von 2.9 % (zwei Symptombereiche) und 8.6 % (drei Symptombereiche). Geringe mütterliche Schulbildung und ein Migrationshintergrund waren dabei die Hauptprädiktoren für das Persistieren der Regulationsproblematik. Wolke, Bilgin und Samara (2017) verglichen in ihrem systematischen Review Daten aus insgesamt 28 Studien und fanden keine statistische Evidenz für einen »universalen« Gipfel der Gesamtschreidauer mit ca. 6 Wochen, obwohl ein leichter Anstieg des Schreiens über die ersten 5–6 Wochen über alle Studien hinweg beobachtet werden konnte. Dagegen war die Abnahme der Schreidauer zum Ende der ersten 3 Lebensmonate in allen untersuchten Studien deutlich erkennbar. Die Autoren berichten von sehr unterschiedlichen Prävalenzen innerhalb der verschiedenen Länder und in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen des Säuglings. Die berichteten Zahlen lagen zwischen 2,1 % (5–6 Wochen, Japan) und 34.1 % (3–4 Wochen, Canada).