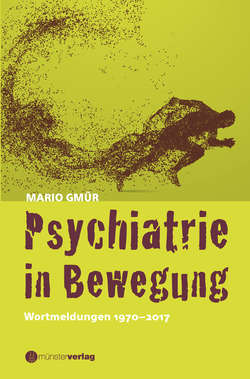Читать книгу Psychiatrie in Bewegung - Mario Gmür - Страница 11
Das verklungene Paranoid
ОглавлениеRemittierte Schizophrene, die uns etwa von der Klinik zur Nachbehandlung überwiesen werden, stellen sich zur verklungenen Krise verschieden ein. Die einen mögen sich kaum erinnern, was in ihnen und mit ihnen vorgefallen ist, oder betrachten die Sache ganz einfach als überwunden. Es erwiese sich als völlig verfehlt, das Vergangene zu erforschen und aufzuwühlen. Der Kranke entgegnete uns, er möge sich an nichts erinnern, oder, er wolle darüber nicht sprechen, das wäre für ihn ein Anstechen alter Wunden. Bei anderen – es sind nicht wenige – richtet sich das Aussprachebedürfnis auf die psychotische Episode, und einige unter ihnen wünschen gar eine eigentliche psychotherapeutisch-systematische Bearbeitung und Bewältigung des Erlebten. So war ein Student der Überzeugung, er sei am Arbeitsplatz vom Vorgesetzten hypnotisiert worden und seither ein veränderter Mensch. In der Klinik habe dann der Oberarzt ihn nächtlicherweise hypnotisiert. Jetzt verlangt er von uns eine Erklärung für all das. Oder, eine Lehrtochter will von uns wissen, ob sie nochmals einen Rückfall erleiden könne und was sie dagegen tun könne.
Häufig verlangen Schizophrene auch Auskunft über ihre Restsymptome: Sie erleben die Welt nicht mehr gleich wie vorher, viel blasser. Sie spüren in der Straßenbahn den Zwang, anderen Fahrgästen eine Ohrfeige zu geben. Oder, die Häuser an der Bahnhofstraße stürzen auf sie ein. Weshalb? Solchen Beunruhigung anzeigenden Fragen sind nach meinen Erfahrungen oftmals Entgegnungen angemessen, die man als Analogiedeutungen bezeichnen könnte. Ich meine damit eine Art von normalpsychologischen Korrelaten oder Pseudoerklärungen. Es geht dabei darum, dem Patienten eine mögliche, denkbare, nicht unbedingt die richtige Erklärung aus dem Verständnishorizont des Gesunden zu geben und damit das beunruhigende Ereignis oder Symptom in eine Verstehensgemeinschaft zwischen Arzt und Patient einzufassen. Etwa so: «Es ist bekannt, daß Leute, die vom Lande in die Stadt kommen, sich oft ausgesprochen klein vorkommen und das Gefühl haben, die Häuser stürzen auf sie ein». Oder: «Wenn man krank war, so ist sehr häufig die Angst da, die Krankheit könnte sich wiederholen». Einem Patienten konnte ich die Beunruhigung über sein Derealisationserleben (Verblassung der Umweltwahrnehmung) nehmen, indem ich diese depressiv gefärbte Erlebnisqualität mit den Worten beschrieb: «Sie haben seit Ihrer Erkrankung das Gefühl, das Leben habe sozusagen kein Aroma mehr». Eine kausale Verknüpfung solcher Wahrnehmungsstörungen mit dem Ausbruch der Psychose (Rezidiv) fördert oft die Toleranz und Geduld des Patienten gegenüber den beklagten Symptomen. Bei vorhandener Krankheitseinsicht haben auch fachmedizinische Benennungen einen spannungsvermindernden Effekt, etwa: «Man nennt dies Phobien oder Zwänge» etc.