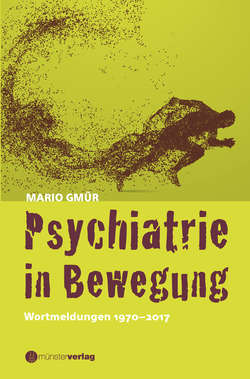Читать книгу Psychiatrie in Bewegung - Mario Gmür - Страница 8
Was geht im Schizophrenen Schizophrenes vor?
ОглавлениеDaß der Patient, der uns aufsucht und den wir für 10–30 Minuten in unserer Agenda eingeschrieben haben, schizophren ist, wissen wir oft nur vom Hörensagen oder von Krankheitsberichten, manchmal von persönlicher früherer Erfahrung mit ihm. Nichts weist im gegenwärtigen Moment darauf hin, daß da eine Schizophrenie vorliegt. Er ist voll besonnen, freundlich, gesprächig. Vielleicht etwas kontaktarm, wortkarg und gefühlsmäßig stumpf, oder er zeigt einige sonderlingshafte Merkmale. Zeichen einer Schizophrenie? Residualsymptome?, oder Wetterleuchten eines herannahenden schizophrenen Gewitters? Uns interessiert, was sich in seinem Innenleben abspielt, aus welchem wir einige Signale empfangen. Ein Eindringen in seine Innenwelt durch bohrendes und symptom-orientiertes Fragen ist da wohl verfehlt, würde vom Patienten als ein verletzendes Herumstöbern in seiner Intimsphäre oder als ein Aufwühlen schmerzlich erlebter Vergangenheit empfunden. Die Psychopathologie leistet uns da einige Hilfe, allerdings nicht als ein Konglomerat von feststellbaren Einzelsymptomen, sondern als ein nachvollziehbares dynamisches System innerer psychischer Vorgänge, die sich, für uns wahrnehmbar und beobachtbar, an die Oberfläche als psychopathologische Symptombildungen projizieren. Nicht dieser Oberfläche des Symptombildes gilt unsere Zuwendung, sondern dem Geschehen im Patienten, das wir am besten zu erfassen vermögen, wenn wir Analoges im Gesunden suchen. BLEULER hat dieses Verständliche etwa im Begriffe der Ambivalenz gefunden und geprägt, das jedem Menschen vertraut ist als Hin- und Hergerissen sein zwischen Wollen und Nichtwollen, Tun und Nichttun usw. Die Lebenserfahrung lehrt uns, daß demjenigen, wogegen wir mit besonderer Heftigkeit den Donnerkeil unserer Empörung schleudern, oftmals auch unsere besondere Zuneigung gilt. Zitate der Literatur bringen diese Widersprüchlichkeit zum Ausdruck. Etwa: «… ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft …», «Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust».
Nach BLEULER hat uns auch CONRAD [1] einen Schlüssel zum Verständnis der schizophrenen Vorgänge gegeben, der uns für die Einschätzung und Behandlung schizophrener Verhaltensstörungen in der Ambulanz als wertvolle Verständnisgrundlage dient. Im Zentrum der schizophrenen Erkrankung steht nach CONRAD die Veränderung als verändertes Bedeutungsbewußtsein: Der Schizophrene regrediert gewissermaßen vom kopernikanischen Weltbild des Gesunden zum ptolemäischen des Schizophrenen. Er rückt selber in den Mittelpunkt allen Geschehens, von dem aus er alle Vorgänge in sich und um sich auf sich bezogen erlebt. Er ist in einer diffusen Wahnstimmung, aus der er mit übersteigerter Aufmerksamkeit der Dinge harrt, die da sind und kommen und, ehemals zufällig und selbstverständlich, ihm jetzt bedeutungsträchtig vorkommen. Sie faszinieren, ängstigen, bedrücken, bedrohen ihn. In diesem Zustand der Auflösung nimmt er die Umgebung in deren hervortretenden elementaren Wesenseigenschaften wahr: Der Schimmel wird, aufgegliedert in die beiden Wesensmerkmale «Pferd» und «weiß», erfaßt und als das «pferdene Weiß» wahrgenommen und bezeichnet. Die Welt wird in ihrer vielfältigen Symbolträchtigkeit erfahren, das Denken folgt assoziativ symbolischen Gleichungen, mitunter mit einer virtuosen Beweglichkeit, die manchen, der nicht übermäßig phantasiebegabt ist, neidisch machen könnte. Viele Menschen ergreifen die Flucht zu Drogen, um einen ebenbürtigen eidetischen Erlebnishunger zu stillen. Beim Schizophrenen ist indessen dieser veränderte Zustand oft begleitet von Gefühlen des Unbehagens, der Verunsicherung, der Angst. Dieses diffuse und nebulose Erleben verlangt nach Konkretisierung und Verdinglichung: Der Schizophrene mobilisiert in dieser bedrohlichen Verfassung alle möglichen Hilfsmittel, um die Bedrohung in den Griff zu bekommen, den unorganisierten Zustand zu organisieren. Er verlegt die Bedrohung von seinem Inneren nach außen. Es droht jetzt der Weltuntergang in Australien. Die Lokalisierung hilft, wenn auch unvollkommen, die apokalyptische Bedrohung zu bannen. Oder: Der Wirt vom «Goldenen Kreuz» hat Gift in die Suppe getan – Sündenböcke helfen in der Krankheit ebenso wie in der Politik, eine unerträgliche Situation besser auszuhalten.
Körperbewegungen, Schreien, Verwerfen der Arme usw., im Sprachschatz der Psychopathologie als «katatone Symptome» festgehalten, helfen ferner, das entschwundene Gefühl der körperlichen vitalen Leibhaftigkeit zurückzugewinnen und dem in Auflösung Begriffenen die Gewißheit zurückzugeben, «ich bin noch da, ich bin mich selbst». SCHARFETTER [2] hat diesen ich-psychologischen Aspekt in letzter Zeit herausgearbeitet. Das Ich als psychische Instanz der organisierenden Vermittlung zwischen innerem und äußerem Geschehen, des Ordnens und Ausrichtens des Denkens, Fühlens und Handelns, ist die Stätte des schizophrenen Geschehens in der bipolaren Anordnung von Desintegration (Auflösung) und Reparation (Wiederherstellung). Wahnbildungen und katatone Symptome stellen reparative Selbstheilungsversuche dar, die dem in einer Krise von Umbruch und Auflösung verlorenen Kranken Halt und das Gefühl von Eigenbestimmung verleihen. Verletzung und Narbenbildung sind die äquivalenten Erscheinungen (von Auflösung und Reparation) in der körperlichen Medizin. Als Ärzte lassen wir die Narbenbildung als Selbstheilungsvorgang gewähren, wenigstens solange sie nicht derart entartet, daß sie selbst zur Krankheit wird.
Wir haben bisher den inneren Zustand des Ichs als inneres Ordnungsprinzip in Betracht gezogen*). Die Auflockerung des inneren Zusammenhaltes hat indessen weitere Auswirkungen im Gefolge, nämlich eine Störung des Verkehrs zwischen dem Ich und seiner Umwelt. In einem Lande, dessen Regime aus den Fugen gerät, wird bekanntlich auch der Grenzverkehr· in Mitleidenschaft gezogen, Waren und Devisen können schrankenlos ohne Zollabfertigung ein und ausgeführt werden. Beim Schizophrenen, dessen innere Ordnung in Chaos versinkt, treten nicht minder Durchlöcherungen seiner Ich-Grenzen auf, was sich in seiner Eigen- und Fremdwahrnehmung dahingehend auswirkt, daß er zwischen innen und außen nicht mehr zu unterscheiden vermag, die innere Bedrohung als von außen kommend erlebt, seine eigenen Empfindungen auch beim Nachbarn vermutet usw.