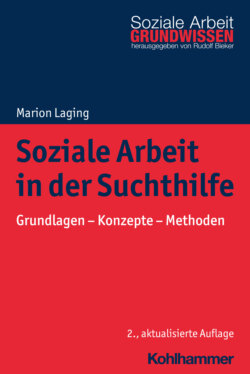Читать книгу Soziale Arbeit in der Suchthilfe - Marion Laging - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4.1 Lebensweltorientierung
ОглавлениеIm Kontext der Lebensweltorientierung findet sich ein etwas längerer Aufsatz von Hans Thiersch zum Thema »Drogenprobleme in einer süchtigen Gesellschaft« aus dem Jahre 1996, auf den auch in den wenigen aktuellen und knappen Veröffentlichungen (z. B. Füssenhäuser 2016) zentral Bezug genommen wird.
Die lebensweltorientierte Perspektive auf Drogenkonsum und Sucht versteht Drogenkonsum zunächst einmal als ein individuelles und spezifisches Deutungs- und Handlungsmuster, in und mit dem Menschen ihr Leben gestalten. Dabei wird der Begriff »Droge« nicht in Hinblick auf den rechtlichen Status einer psychoaktiven Substanz unterschieden. Drogenkonsum wird insofern als ein »eigensinniges« Verhalten charakterisiert, mit dem Menschen das Ziel verfolgen, sich mit den Anforderungen des Alltags zu arrangieren (Thiersch 1996). Drogenkonsum wird dementsprechend von einem breiten Spektrum von Motiven und Funktionen angetrieben, die wiederum in den Kontext der aktuellen sozialen und gesellschaftlichen Anforderungen an das Individuum gestellt werden. Leistungssteigernde Drogen werden konsumiert, um besser mit den Anforderungen einer Leistungsgesellschaft Schritt halten zu können. Andere Drogen ermöglichen wiederum das Aushalten oder die Kompensation von Belastungen, Irritationen und Frustrationen, oder sie werden konsumiert, um Glücksgefühle hervorzurufen. Drogenkonsum wird von daher in verschiedene Kontexte eingeordnet: zum einen als ein Deutungs- und Handlungsmuster, das in den Dienst der Alltagsbewältigung gestellt wird, wobei die alltäglichen Anforderungen des Individuums wiederum die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse und Zumutungen abbilden. Alltag ist dabei im Thiersch’schen Sinne ein ambivalentes Konstrukt: Die alltäglichen Routinen stabilisieren und vermitteln Sicherheit, können aber in ihrer Unhinterfragbarkeit, ihrer »Borniertheit« auch einengen und Möglichkeiten beschneiden. Zusammengefasst wird Drogenkonsum in den Kontext der subjektiven Deutungs- und Handlungsmuster gestellt. Diese sind funktional im Sinne der Alltagsbewältigung, können aber auch Entwicklungsmöglichkeiten beschneiden und reflektieren zugleich die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse. Für das Verständnis des individuellen Drogenkonsums sind dementsprechend im Kontext der lebensweltorientierten Theorie die damit verbundenen Funktionalitäten zentral – sie werden verstanden als ein partielles Moment in der Gesamtheit der Lebensstrategien.
Dominieren die drogenbezogenen Bewältigungsmuster und verkümmern demgegenüber andere Bewältigungsstrategien, kommt es zu Missbrauch und/oder zur Sucht. Ausdrücklich wird aber davor gewarnt, »Drogenkonsum vom Ende her« zu denken, das heißt mit Drogenkonsum per se und unhinterfragt Sucht und Verelendungsprozesse zu verbinden. Stattdessen sollte Drogenkonsum immer im Kontext der Lebensbewältigung betrachtet werden. Gleichfalls wird davor gewarnt, dass mit einer Vorstellung von Sucht, die sich aus dem funktionalen Konsum ergibt, heimlich eine puritanische Vorstellung von einem gelingenden Leben transportiert wird, das der Selbstbestimmung des Subjekts entgegenstehen kann (Thiersch 1996).
Die lebensweltorientierte sozialpädagogische Perspektive fokussiert dementsprechend weder auf einzelne Suchtstoffe noch auf die Frage der Abstinenz bei der Bearbeitung und Überwindung von Sucht. Prävention konzentriert sich in diesem Sinne auf eine lebensweltliche und alltagsorientierte Stabilisierung, die spezifische Angebote weitgehend überflüssig macht. Stattdessen kommt der Selbstbestimmung der Menschen im Kontext der Entwicklung von Angeboten für suchtkranke Menschen besondere Bedeutung zu.