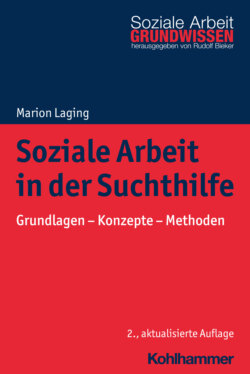Читать книгу Soziale Arbeit in der Suchthilfe - Marion Laging - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.5 Vergleichende Diskussion
ОглавлениеIn diesem Abschnitt wurden vier unterschiedliche Ansätze zur Erklärung von Suchtentstehung vorgestellt. Sie entstammen der Gesundheitswissenschaft, der Psychologie und der Wissenschaft Sozialer Arbeit bzw. der Sozialpädagogik.
Die entwicklungspsychologische Perspektive, die Lebensweltorientierung und das Konzept der Lebensbewältigung betonen gleichermaßen die Bedeutsamkeit der Funktionalität für ein Verständnis des Substanzkonsums und einer möglichen Abhängigkeitsentwicklung. Dabei operieren alle drei Ansätze mit dem Paradigma der Bewältigung, buchstabieren dieses jedoch jeweils unterschiedlich aus: Während die entwicklungspsychologische Perspektive die jugendtypischen Entwicklungsaufgaben in den Blick nimmt, die es zu bewältigen gilt, geht es bei Thiersch um den gelingenden Alltag, während Böhnisch existenzielle Hilflosigkeitserfahrungen als Ausgangspunkt des Bewältigungsverhaltens beschreibt. Damit weist der Ansatz der Lebensbewältigung den deutlichsten Problembezug bei der Beschreibung der zu bewältigenden Ausgangslage aus.
Die Bewältigungsanforderungen an das Individuum werden in allen drei Ansätzen gleichermaßen in sozialen und gesellschaftlichen Räumen verortet, wobei Thiersch hier am präzisesten beschreibt, wie spezifische gesellschaftliche Konstellationen süchtige Verhaltensweisen geradezu herausfordern und in welchem Ausmaß Menschen heute mit äußerst ambivalenten Anforderungen konfrontiert sind. Böhnisch vermittelt demgegenüber eindrücklich – vergleichbar der Psychoanalyse – Einblicke in die Tiefenstruktur des Erlebens und Erleidens einer Suchterkrankung, die ihren Ausgangspunkt in der Dramatik abgespaltener Hilflosigkeitserfahrungen nimmt.
Darüber hinaus unterscheiden sich die vorgestellten Ansätze durch ihr jeweiliges Theorie-Empirie-Verhältnis. Während die Entwicklungspsychologie auf theoretischen Konzepten basiert, die durch empirisches Wissen gestützt, verifiziert oder falsifiziert werden, verzichten die sozialpädagogischen Theorien auf jede Bezugnahme zu empirischen Daten und Fakten, die die theoretischen Konstrukte bestätigen oder in Frage stellen könnten. Das multifaktorielle Modell hingegen, eine Zusammenstellung und Ordnung empirischer Daten, kommt weitgehend ohne theoretische Rahmung oder Erklärung aus. Die Stärke des multifaktoriellen Modells liegt vielmehr in seiner integrativen Kraft, fortlaufend neue Forschungsergebnisse aufnehmen und bündeln zu können.
Zusammenfassend zeigt sich die Funktionalität des Substanzkonsums als ein Schlüsselkonzept für das Verständnis von Suchtentstehung. Darüber hinaus besteht Einigkeit, dass es sich bei der Suchtentstehung um ein multifaktorielles, komplexes Geschehen handelt. Dabei stellen die einzelnen Ansätze – mit Ausnahme des multifaktoriellen Modells – unterschiedliche Faktoren in den Vordergrund bzw. gewichten diese unterschiedlich.