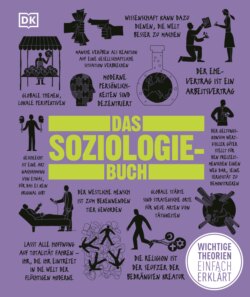Читать книгу Big Ideas. Das Soziologie-Buch - Маркус Уикс - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDAS PROBLEM DES 20. JAHRHUNDERTS IST DAS PROBLEM DER RASSENTRENNUNG
W.E.B. DU BOIS (1868–1963)
IM KONTEXT
SCHWERPUNKT
Rasse und Volkszugehörigkeit
WICHTIGE DATEN
1857 Roger B. Taney, oberster Richter der USA, entscheidet gegen das Freiheitsgesuch des Sklaven Dred Scott: Schwarze seien keine freien Bürger und könnten daher nicht in gleicher Weise vom Gesetz geschützt werden wie Weiße.
1906 Max Weber sagt: Gemeinsame Auffassungen und Bräuche, nicht biologische Merkmale unterscheiden ethnische Gruppen voneinander.
1954 Im Fall »Brown vs. Board of Education« erklärt der Oberste Gerichtshof in den USA separate, nach Hautfarbe getrennte Schulen für verfassungswidrig.
1964 Das Bürgerrechtsgesetz verbietet die Rassentrennung im öffentlichen Raum: In den USA endet die gesetzliche Diskriminierung von Rasse, Hautfarbe, Religion oder Geschlecht.
Ende des 19. Jahrhunderts lenkte Frederick Douglass, ein Gesellschaftsreformer und befreiter Sklave, die Aufmerksamkeit in den USA auf fortbestehende Vorurteile gegenüber der schwarzen Bevölkerung. Obwohl Schwarze niemandem mehr gehörten, waren sie noch immer Sklaven der Gesellschaft. Aus dem Herzen der Sklaverei, so Douglas, »sind Vorurteil und Rassentrennung entstanden«, durch die die weiße Vorherrschaft am Arbeitsplatz, an den Wahlurnen, in den Gerichtshöfen und im Alltagsleben sichergestellt wurde.
1903 untersuchte W.E.B. Du Bois in Die Seelen der Schwarzen die Rassentrennung. In diesem soziologischen und politischen Grundlagenwerk erforscht er die Veränderungen der gesellschaftlichen Stellung der Afro-Amerikaner vom Bürgerkrieg bis ins frühe 20. Jahrhundert – und zwar anhand der persönlichen, ökonomischen und politischen Beziehungen zwischen Weißen und Schwarzen im Süden des Landes. Du Bois’ Schlussfolgerung zu den unterschiedlichen Aussichten und Möglichkeiten für Schwarze und Weiße in den USA lautet: »Das Problem des 20. Jahrhunderts ist das Problem der Rassentrennung.«
Du Bois beginnt seine Studie mit der Feststellung: Weiße wollen nicht über das Thema Rasse diskutieren, legen im Verhalten aber zahlreiche Vorurteile an den Tag. Was sie indes wirklich wissen wollen, ist dies: »Wie fühlt es sich an, ein Problem zu sein?«
Die Frage ist aus Du Bois’ Sicht nicht zu beantworten – ist sie doch nur Ausdruck der weißen Perspektive, denn Schwarze sehen sich selbst keineswegs »als Problem«. Im Anschluss untersucht er, wie diese »Zweiheit« der Perspektive zustande kam und berichtet von seiner ersten Begegnung mit dem Rassismus: In der Schule verweigerte einer seiner Mitschüler die Annahme seiner Glückwunschkarte; da »dämmerte es mir, dass ich anders war als die anderen«.
Innerlich fühlte Du Bois wie die anderen, sagte er, doch er merkte, dass er »von ihrer Welt durch einen riesigen Vorhang ausgeschlossen« blieb. Zunächst noch unverdrossen, spürte er erst als Heranwachsender – als er sah, dass all die fantastischen Möglichkeiten nur Weißen vorbehalten blieben – die Notwendigkeit, diesen Vorhang beiseitezuziehen. Hier war eine Trennungslinie und er stand auf der Seite, der Macht und Möglichkeiten, Würde und Achtung versagt blieben.
»Das zentrale Paradox des Südens: die gesellschaftliche Trennung der Rassen.«
W.E.B. Du Bois
Identitätskrise
Die Rassentrennung verlief nicht nur äußerlich. Schwarze sahen sich selbst, so Du Bois, auf zweierlei Weise: als Spiegelbild der weißen Welt, von der sie mit amüsierter Verachtung und Mitleid betrachtet wurden, und aus einem durchlässigeren, nicht starr definierten Selbstverständnis heraus. Aus beidem entsteht, was Du Bois das »doppelte Bewusstsein« nennt: »zwei Seelen, zwei Gedanken, zwei unversöhnliche Bemühungen, zwei streitende Ideale in einem dunklen Körper«.
Die Geschichte der schwarzen Persönlichkeit in den USA ist die Geschichte eines inneren Konflikts, der selbst Resultat der äußeren Schlacht zwischen Schwarz und Weiß ist. Ein Schwarzer, so Du Bois, versucht stets, dieses doppelte Bewusstsein in einem Zustand zu vereinen und den wahren afrikanisch-amerikanischen Geist zu finden, der Amerika nicht afrikanisiert, aber auch nicht »seine afrikanische Seele in einer Flut weißen Amerikanismus’ ausbleicht«.
Das doppelte Bewusstsein – mit diesem Begriff beschreibt Du Bois die eigentümliche »Zweiheit« der Afro-Amerikaner: Sie müssen ein Selbstverständnis entwickeln und sich gleichzeitig bewusst sein, was andere in ihnen sehen. Ein junger Schwarzer kann z. B. Arzt sein (oben links und rechts), dennoch wird ihm das Stereotyp der weißen Gesellschaft vom jungen Schwarzen als z. B. gefährlichem Kriminellen oder Gettogangster (rechts oben) stets präsent sein.
Ulysses S. Grant und seine Generäle auf dem Vormarsch im amerikanischen Bürgerkrieg – entscheidend für seine Wahl zum Präsidenten 1868 waren die Stimmen der neuen schwarzen Wählerschicht.
Das »Freedmen’s Bureau«
Wie aber waren die Schwarzen »das Problem« geworden? Eine Antwort auf die Frage sucht Du Bois in der Geschichte der Sklaverei und im Wendepunkt des amerikanischen Bürgerkriegs.
Als 1861 die Unionisten im Süden einmarschierten, flohen dort die Sklaven, um sich den Nordstaatlern anzuschließen. Zunächst wurden sie noch zu ihren ehemaligen Besitzern zurückgeschickt, später behielt man sie als Arbeitskräfte in der Armee.
1863 wurden Sklaven für frei erklärt und die Regierung eröffnete mit »Freedmen’s Bureau« eine Stelle für Flüchtlinge und Befreite und gab dort Essen, Kleider und verlassene Grundstücke an die Flut mittelloser geflohener Ex-Sklaven aus. Die von Militärbediensteten geführte Stelle war für eine solche gesellschaftliche Reorganisation jedoch nicht ausgerüstet und angesichts des Ausmaßes der Aufgabe überfordert: Das Versprechen, einst von Sklaven bewirtschaftete Plantagen diesen zu übergeben, schmolz regelrecht dahin, als deutlich wurde, dass es sich um mehr als 800000 Acres Land handelte.
»Die Sklaverei ist vorbei, doch ihr Schatten ist noch immer da … und vergiftet … die moralische Atmosphäre in allen Bereichen der Republik.«
Frederick Douglass US-amerik. Gesellschaftsreformer, um 1818–1895
Einen Erfolg erzielte das Bureau indes mit der Bereitstellung von kostenlosen Schulen für alle schwarzen Kinder. Du Bois zeigte aber auch hier das Problem auf – denn »der Süden glaubte, ein gebildeter Neger sei ein gefährlicher Neger«. Und der Widerstand gegen schwarze Schulen »zeigte sich in Form von Asche, Beleidigung und Blut«.
Gleichzeitig wurde in Gesetzesdingen Zwietracht gesät. In den Gerichtsverhandlungen wurde »das Unterste nach oben« gekehrt, indem das Bureau schwarze Prozessparteien bevorzugt behandelte, während in den Zivilgerichten einstige Sklavenhalter unterstützt wurden. Du Bois beschreibt Weiße, die von den Gerichten des Bureaus »herumkommandiert, festgesetzt, eingesperrt und wieder und wieder bestraft wurden«, während Schwarze von wütenden und rachsüchtigen Weißen eingeschüchtert, geschlagen, vergewaltigt und niedergemetzelt wurden.
1865 eröffnete das Bureau eine »Freedmen’s Bank« für ehemalige Sklavinnen und Sklaven. Die Initiative wurde jedoch durch Inkompetenz behindert und die Bank schließlich geschlossen, wobei die eingezahlten Summen nicht an ihre Besitzer ausgezahlt wurden. Dies aber war nur der geringste Verlust, so Du Bois, denn »der Glaube ans Sparen und viel vom Glauben an den Menschen gingen ebenfalls dahin. Und das war ein Verlust, den eine Nation, die heute über die schwarze Hilflosigkeit spottet, bisher nicht wiedergutgemacht hat«.
Das Bureau etablierte zudem ein System aus freier Arbeit und Eigentum einstiger Sklaven. Es sicherte in Gerichtshöfen Schwarzen die Anerkennung als freie Menschen zu und eröffnete Gemeindeschulen. Sein größtes Versäumnis lag jedoch darin, nicht für das nötige Wohlwollen zwischen einstigen Sklavenbesitzern und Ex-Sklaven zu sorgen, sondern zu wachsender Feindseligkeit beizutragen. So blieb die Rassentrennung erhalten und äußerte sich von nun an subtiler.
Kompromiss oder Aufruhr?
Nach dem Bürgerkrieg gingen manche der neuen Rechte der Schwarzen wieder verloren. So gestattete ein Gerichtsurteil von 1896 die Rassentrennung (Segregation) im öffentlichen Raum und gab damit das Muster vor, das in den Südstaaten bis 1954 vorherrschen sollte. Und der Ku Klux Klan und seine Behauptung eines weißen Suprematismus erlebte ein Wiedererstarken, das von einem Anstieg rassistischer Gewalt und Lynchmorde begleitet wurde. 1895 propagierte der afro-amerikanische Politiker Booker T. Washington, was als »Kompromiss von Atlanta« bekannt wurde: Schwarze sollten Geduld zeigen und wie die weiße Mittelschicht nach Bildung und sozialem Aufstieg streben, um ihren gesellschaftlichen Wert zu zeigen. Durch Verzicht auf politische Rechte im Gegenzug zu wirtschaftlichen und Gleichheitsrechten vor dem Gesetz werde, so Washington, die gesellschaftliche Veränderung auf lange Sicht möglich.
Dem widersprach Du Bois entschieden und hoffte stattdessen, Rassismus und die Rassentrennung mithilfe der Sozialwissenschaften zu eliminieren. Doch später sah er die politische Agitation als einzig effektiven Weg.
Eine Erweiterung der Trennungslinie
1949 besuchte Du Bois das Warschauer Getto in Polen, wo zwei Drittel der jüdischen Bevölkerung von den Nazis ermordet worden waren. Die Erfahrung schockierte ihn, ermöglichte ihm aber auch »ein vollständigeres Verständnis des Negerproblems«. Die anschließende Überprüfung seiner Analyse der Rassentrennung führte ihn zu der Erkenntnis, dass sie jede kulturelle oder ethnische Gruppe treffen konnte.
In einem 1952 veröffentlichten Essay für das Magazine Jewish Life schrieb er: »Das Rassenproblem … verlief entlang von Trennungslinien der Hautfarbe und Körpermerkmale, des Glaubens wie des Status’ und war ein Ausdruck … menschlichen Hasses und menschlicher Vorurteile.« Es war daher weniger die Hautfarbe, um die es ging, als vielmehr die »Trennlinie« selbst, die aus Hass zwischen gesellschaftlichen Gruppen gezogen werden konnte.
Aktivist und Wissenschaftler
Du Bois war ein Gründungsmitglied der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Seine Ideen kreisten um Menschen afrikanischer Herkunft, und in den 1920er-Jahren organisierte er weltweit eine Reihe pan-afrikanischer Kongresse. Gleichzeitig beleuchtete er mit seinen methodisch systematischen Studien bisher vernachlässigte Segmente der Gesellschaft. Er nutzte empirische Daten, um ein detailliertes Bild vom Leben der schwarzen Bevölkerung zu zeichnen und so verbreitete Vorurteile zu zerstreuen. In seiner Studie The Philadelphia Negro (1899) trug er z. B. eine Fülle von Beobachtungen über die Bedingungen des städtischen Lebens der Afro-Amerikaner zusammen. Sie zeigten, dass Kriminalität ein Produkt der Umgebung (und nicht etwa angeboren) war. Seine Sozialstudien hatten immensen Einfluss auf spätere Bürgerrechtler wie Martin Luther King. Heute gilt W.E.B. Du Bois als einer der bedeutenden Soziologen des 20. Jahrhunderts.
W.E.B. Du Bois
William Edward Burghardt Du Bois war der erste schwarze Soziologe, außerdem Philosoph, Historiker und ein politischer Führer. Drei Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs in Massachusetts (USA) geboren, studierte er an der Fisk University in Nashville/Tennessee sowie in Berlin; dort traf er Max Weber.
1895 promovierte er als erster Afro-Amerikaner in Geschichte an der Harvard University. 1897–1910 lehrte er Ökonomie und Geschichte in Atlanta, von 1934 bis 1944 war er Dekan des Fachbereichs Soziologie.
1961 ging Du Bois nach Ghana und begann dort mit seiner Encyclopedia Africana, starb jedoch bereits nach zwei Jahren. Er verfasste zahlreiche Bücher, Aufsätze und Essays und gab mehrere Zeitschriften heraus.
Hauptwerke
1903 Die Seelen der Schwarzen
1920 Darkwater: Voices from Within the Veil
1939 Black Folk, Then and Now