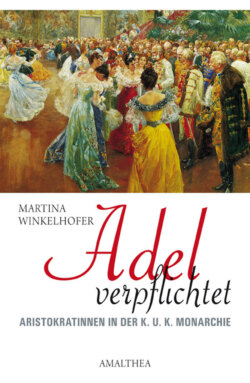Читать книгу Adel verpflichtet - Martina Winkelhofer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIn der Kinderstube, der Erziehung der Krabbel- und Kleinkinder, wurden Mädchen und Buben noch gemeinsam betreut, meist ausschließlich von Kinderfrauen und Kammermädchen. Erst mit Beginn des Unterrichts wurden sie nach Geschlecht getrennt. Die ersten Jahre wurden alle Kinder zu Hause von Hauslehrern erzogen, danach schickte man zumindest die Buben öfter in Pensionate – gegen Ende der Monarchie – in öffentliche Gymnasien. Mädchen wurden fast immer zu Hause erzogen, nur in Einzelfällen besuchten sie untertags katholische Schulen.
Die Erziehung der heranwachsenden Mädchen der Aristokratie war ganz auf ihr künftiges Leben als Ehefrau, Mutter und Gesellschaftsdame ausgerichtet. Sie mussten lernen ein tadelloses Heim zu führen, schöne Blumenarrangements zu erstellen, Klavier zu spielen und geschmackvolle Handarbeiten herzustellen. Auch Fremdsprachen sollte ein Mädchen beherrschen, vor allem Französisch musste sie tadellos sprechen. Bei der Erziehung der Mädchen galt die Herausbildung einer Charaktereigenschaft als besonders wichtig: die Herzenswärme. Mädchen sollten mitfühlend, gütig und bescheiden sein und sich nicht in den Vordergrund drängen.
Standesgemäß erzogen im ursprünglichsten Sinn wurden die Kinder durch das lebende Beispiel ihrer Eltern – indem sie beobachteten und nachahmten, was diese ihnen vorlebten. Durch »Vorleben« erfolgte auch die Herausbildung eines aristokratischen Habitus; weniger durch gezielte Erziehung. Was die Kinder an angemessenen Grußformeln, ordentlicher Aussprache und geistvoller Konversation hörten, übernahmen sie automatisch, so dass die aristokratische Kultur wie selbstverständlich von einer Generation auf die nächste weitergegeben wurde. Dieses soziale Herkunftskapital war der eigentliche »Mitgliedsausweis« in der Aristokratie. Es konnte weder im Nachhinein erworben werden, noch war es an Besitz und Reichtum gebunden. Selbst der mittelloseste Aristokrat war aufgrund dieser typischen – und allen gemeinsamen – Erziehung ein gleichberechtigtes, von allen akzeptiertes Mitglied seines Standes. Während der noch so reiche Industrielle, dessen Lebensstil oft nicht nur dem eines vermögenden Aristokraten entsprach, sondern diesen noch in den Schatten stellte, durch das Fehlen dieses sozialen Grundkapitals sofort als nicht zugehörig auffiel. Aufsteigerfamilien brauchten mindestens zwei Generationen, um jene Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander zu erwerben, die nur von Eltern an Kinder weitergegeben werden konnte.
Der Tagesablauf der Mädchen war sehr genau und pünktlich eingeteilt – jede Abweichung von dieser Norm wurde von den Kindern daher als angenehmes Ereignis begrüßt. In der Früh gab es immer ein einfaches Frühstück, gemeinsam mit den Erziehern. Nach den Lernstunden folgte ein kurzes Mittagessen, meist ebenfalls nur im Kreis des Erziehungspersonals. Danach gab es Zeichen- und Klavier-, eventuell Gesangsstunden sowie Stunden, die der Handarbeit dienten. Am Nachmittag ging man spazieren, was die Kinder zumeist als »fade« empfanden.9 Begeistern konnten sie sich allenfalls für Spaziergänge während der winterlichen Wien-Aufenthalte, denn diese führten entlang der Ringstraße – und Ringstraßenspaziergänge waren damals ein auch von Erwachsenen goutiertes Freizeitvergnügen. Jeder, wirklich jeder zeigte sich auf »dem Ring«, vom Offizier bis zum Bürger, vom Aristokraten bis zur Bürgersfrau. Bekannte Burgschauspieler und Opernsänger flanierten den Prachtboulevard entlang – das Motto hieß: »sehen und gesehen werden«. Die Kinder, die Lebhaftigkeit der Großstadt bestaunend, gingen artig in ihren Matrosenkleidchen neben den Gouvernanten. Im Winter durften die Kinder in Wien auch eislaufen gehen, eine bei Alt und Jung beliebte Sportart des Adels.10
Auf »natürlichen« Umgang mit den Standesgenossen wurde von klein auf großer Wert gelegt. In diesem Sinne erhielten die Mädchen schon im Kindesalter kleine, altersgerechte gesellschaftliche Aufgaben. An Sonntagen durften schon die jüngsten Mädchen ihre Freundinnen, die Töchter anderer Aristokratinnen, zur Jause einladen. Auch die Buben hielten ihre traditionellen »Bubenjausen« ab, zu denen sie ihre gleichaltrigen Freunde einluden.11
Prinz Ferdinand Kinsky mit seinen Kinder beim täglichen Spaziergang, 1906.
Ebenfalls von klein auf erhielten die Mädchen Tanzstunden, meist gemeinsam mit ihren Brüdern oder Cousins. Sobald die Mädchen einige kleine Tänzchen beherrschten, arrangierte die Mutter Kinderbälle, zu denen die Kinder anderer Adelsfamilien eingeladen wurden. Ein Klavierspieler sorgte für die Musik, zu der die kleinen Mädchen und Buben miteinander tanzten. Den Abschluss eines solchen Kinderfestes bildete eine Jause mit Tee und Süßigkeiten.12 Diese Kinderbälle waren nicht nur dazu gedacht, den Mädchen eine Unterhaltung zu bieten. In erster Linie sollten sie sich von klein auf an die Notwendigkeit gewöhnen mit ihresgleichen zusammenzusein, ungezwungen Konversation zu führen und, dies vor allem, als Gastgeberin ihren Pflichten in der Gesellschaft nachzukommen – freilich zunächst auf kindgerechter Basis.
Mit anderen Kindern als jenen der Aristokratie kamen die Mädchen und Buben niemals zusammen. Da die Aristokratie streng darauf achtete, dass es ja keine Vermischung mit der »Zweiten Gesellschaft«, der Gesellschaft der Ringstraßenbarone und Industriellen gab, wurde selbst den Kindern ein Zusammentreffen mit Nicht-Aristokraten untersagt. Graf Ferdinand Wilczek berichtet, dass seine Gouvernante, die sehr eigenständig agieren durfte, mit ihm und seinen Geschwistern öfters ins Cottage-Viertel fuhr, um dort die Kinder der Familie Des Renaudes zu besuchen, mit deren Nurse sie befreundet war. Die Mutter seiner Freunde war eine geborene Frau Waerndorfer, Schwester des Industriellen Fritz Waerndorfer, der mit seinem Reichtum die Gründung der Wiener Werkstätten ermöglichte. Die Waerndorfer-Renaudes waren reiche und angesehene Mitglieder der Zweiten Gesellschaft – doch als die Mutter Ferdinand Wilczeks von diesen Besuchen erfuhr, verbot sie sie sofort. Die Kinder von Industriellen waren eben keine standesgemäßen Spielgefährten für kleine Aristokaten.13
Zwei Mädchen, um 1906.
Die individuellen Kleidungswünsche kleiner Mädchen blieben völlig unberücksichtigt, ja, man nahm sie nicht einmal zur Kenntnis. So waren die kleinen Mädchen der Aristokratie alle gleich gekleidet. Über einem Baumwollkleid trugen sie eine Schürze mit Latz und Rüschen. Wochentags waren die Kleidchen dunkel, an Sonn- und Besuchstagen aber hell. Kleine Stiefelchen, zu denen sie derbe Strümpfe trugen, galten als einziges Schuhwerk für den Alltag. Die Kleider waren knielang, erst mit Eintritt in die Pubertät waren bodenlange Kleider gestattet. Haare durften im Kindesalter noch halb offen getragen werden; junge Damen mussten die Haare aber immer hochstecken. Die Alltagskleidchen der Mädchen wurden meist von geschicktem Kammerpersonal genäht, nur Sonntagskleider und spezielle Kleidungsstücke wurden von Schneiderinnen und Modesalons gefertigt. In der Aristokratie galt sowohl in Bezug auf die Kleidung als auch das Auftreten der Kinder Einfachheit als Tugend; aufgetakelte, affektierte Kinder empfand man als Gräuel.
Die Tochter des Grafen Felix Harnoncourt in einem Festkleid, um 1888.
Ein wichtiges Kriterium in der Erziehung, auch bei Mädchen, war die körperliche Ertüchtigung. Überhaupt sollten Kinder nicht verweichlicht werden, jegliche Mimosenhaftigkeit wurde auch den Mädchen früh ausgetrieben. Dem hohen Stand entsprechend sollten sie lernen, sich nicht gehenzulassen und körperliche Unpässlichkeiten ohne Gejammer zu ertragen, um auch im Hinblick auf ihre späteren Pflichten in der Gesellschaft ein angenehmes Gegenüber zu werden, das sich und seine Affekte in der Hand hat. Das verzärtelte Kind, wie man es in vielen Bürgersfamilien fand, entsprach absolut nicht dem Erziehungsideal der Aristokratie – die eher eine spartanische körperliche Erziehung präferierte.14
Mädchen wurden dazu angehalten, Tagebuch zu führen. Hiermit bezweckte man weniger, dass sie die schönsten und außergewöhnlichsten Erlebnisse als Erinnerung festhielten, sondern dass sie Selbstzeugnis ablegten. Mädchen sollten ihr Handeln auf seine Motive hin prüfen und sich – darüber schreibend – fragen, ob sie den hohen sittlichen Erwartungen ihrer Eltern auch gewissenhaft entsprochen hatten. Solches In-sich-Gehen, Sich-Prüfen galt als Voraussetzung für tadelloses Verhalten. In jungen Jahren musste man oftmals die Tagebücher der Mutter vorlegen, die so kontrollieren konnte, wie ernsthaft man das eigene Verhalten überdachte.
Kinder wurden zudem von klein auf zu sozialer Fürsorge angehalten. Dem christlichen Erziehungsideal gemäß, animierte man sie zu karitativem Verhalten, dazu, sich um Schwächere zu kümmern und wohltätig zu sein. Erhielten sie Geldgeschenke von Verwandten, mussten sie den Betrag fein säuberlich in einem Büchlein notieren und einen Teil davon für Almosen verwenden. Die Eltern kontrollierten streng, ob und wie viel ihre Kinder spendeten. Selbst kleine, von den Kindern gesuchte Aufgaben oder Freizeitbeschäftigungen sollten der Wohltätigkeit dienen.
Die Kinder der Aristokratie wurden zu körperlicher Betätigung angehalten, das verzärtelte Kind des Bürgertums, das in der Literatur häufig zu finden ist, entsprach nicht dem Ideal des Adels, 1908.
Ein Mädchen der Aristokratie: Thérése Colloredo, 1881.
Prinz Gottfried Hohenlohe-Schillingsfürst durfte zum Beispiel als kleiner Bub eigene Hühner in seinem kleinen Privatgärtchen, am Rand des Parks des Wiener Augartenpalais, in dem seine Eltern residierten, halten. Die Hühner waren sein größtes Hobby und eine willkommene Abwechslung zu den vielen Lernstunden. Über die Anzahl der Eier, die seine Hennen legten, und deren Verbleib führte der kleine Prinz genauestens Buch: Ein Drittel der wöchentlich erwirtschafteten Eier musste er in der Küche abgeben, ein weiteres Drittel gab er den Armen der Umgebung, und nur das letzte Drittel durfte er selbst verkaufen und den Verkaufserlös in Naschwerk oder Abziehbildchen investieren. Ein lustiger Nebeneffekt dieses Eierhandels zeigt zugleich, wie ernst Eltern die Almosenpflicht ihrer Kinder nahmen: Prinz Gottfrieds Vater, Erster Obersthofmeister am Hofe Kaiser Franz Josephs, fand unter seiner wöchentlichen Korrespondenz nicht nur die Berichte seiner Hofchargen sowie österreichischer Botschafter im Ausland, sondern auch die kleinen Briefchen seines Sohnes mit der Aufstellung der aktuellen Eierproduktion samt sorgsam vorgerechneter Abzüge für die Armen. Der viel beschäftigte Obersthofmeister ließ es sich nicht nehmen, die Briefchen stets genau zu kontrollieren und vergaß auch nie, seinen kleinen Sohn für die ordentliche Abrechung und ehrliche Aufteilung zu loben.15
Zwei kleine Prinzessinnen Kinsky beim Herumtollen, 1906.
Süßigkeiten bekamen die Kinder der Aristokratie auschließlich an hohen Festtagen – nicht etwa aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil man sie nicht verwöhnen wollte. Alljährlicher Höhepunkt war Weihnachten mit dem Christbaum. Dieser war über und über mit Naschwerk geschmückt und wurde völlig zur Plünderung durch die Kinder freigegeben. Prinz Konrad Hohenlohe, der älteste Sohn der reichen Prinzessin Sayn-Wittgenstein und des kaiserlichen Obersthofmeisters, schrieb jede Weihnachten mit Ausrufungszeichen in sein Tagebüchlein, dass der Baum mit allerhand Süßem geschmückt sei und die Kinder, ohne zu fragen, für ein paar Tage zugreifen durften – ein Höhepunkt auch im Jahr des kleinen, reichen Prinzen.16
Eine Pause vom strengen Leben brachten die Sommeraufenthalte in den Stammschlössern. Diese wurden von den Kindern das ganze Jahr über herbeigesehnt. Hier gestand man ihnen eine Freiheit zu, die es in der Stadt nicht gab. Sie durften, bis auf wenige Lernstunden, den ganzen Tag im Freien herumtoben, Obstbäume plündern, Fische fangen – vor allem aber mit den Kindern der Bediensteten und der benachbarten Bauern spielen. So strikt der Umgang der Kinder sonst gehandhabt wurde, auf den eigenen Familienschlössern gab es – anders als in der Stadt – für die Kinder keine gesellschaftlichen Schranken. Die Kinderbanden, die in den Sommermonaten den Schlosspark und die Umgebung unsicher machten, bestanden aus den Kindern der Herrschaften, der Bediensteten und der ansässigen Bauern. Trotz aller sozialen Unterschiede ergaben sich aus diesen Kinderfreundschaften oftmals Freundschaften für das ganze Leben.
Bei aller Strenge erkannte und berücksichtigte man doch die Bedürfnisse der Kinder. Gerade während der warmen Monate auf dem Land achtete man darauf, dass sie genug Bewegung hatten. Sie durften herumtollen, auf Bäume klettern, fischen, schwimmen, Ponyreiten und stundenlang spielen. Interessanterweise machte man hier zwischen Mädchen und Buben keinen Unterschied, sie durften herumtollen und Kind sein – in der Stadt dagegen wurden Geschwister schon bei ihren Freizeitbeschäftigungen nach Geschlechtern getrennt.
Eine luxuriöse Kindheit: ein Minikutsche für die Kleinsten, um 1870.
Kamen die Mädchen in die Pubertät, wurden so genannte »Adoleszentenbälle«, auch »Tanzerl«17 genannt, arrangiert – die Fortsetzung der Kinderbälle. Nun wurden die Backfische professionell im Tanz unterwiesen, meist von den Hofballettmeistern der Oper. Die Tanzstunden für die Mädchen fanden nun nicht mehr im engsten familiären Umfeld statt, sondern gemeinsam mit jungen Männern der weiteren Bekanntschaften. Die Mädchen konnten hier erstmals junge Männer außerhalb des familiären Umfelds kennenlernen, oder zumindest traf man einander erstmals nicht unmittelbar unter den Augen der Mütter und Gouvernanten.
Nach Abschluss der Tanzstunden veranstalteten jene Familien, die über ein Palais mit eigenem Ballsaal (oder zumindest großem Salon) verfügten, Adoleszentenbälle für die Jugend. Zu diesem Anlass gab es meist ein großes Buffet und Limonade. Anders als bei den Kinderbällen sorgte nun kein einzelner Klavierspieler mehr für die musikalische Begleitung, sondern ein kleines, mehrköpfiges Orchester spielte auf. Die Mädchen erhielten ihre ersten Ballkleider, freilich viel bescheidener als jene der Erwachsenen, und die Burschen erschienen im so genannten »Eaton suit«, einer Art Smoking-Festgewand der englischen Schule, und Glacéhandschuhen.18 Bei den Adoleszentenbällen wurde, als Höhepunkt des Abends, wie bei den Bällen der Erwachsenen, der Kotillon getanzt. Hierbei überreichten traditionellerweise die Burschen Blumen an die Mädchen, welche sich ihrerseits mit Ansteckmascherln in ihren Wappenfarben revanchierten.
Die prächtigsten Tanzerln veranstaltete um die Jahrhundertwende Erzherzog Friedrich, der reichste Habsburger, in seinem Wiener Palais Albertina. Bei acht heranwachsenden Töchtern fanden die beliebten Jugendbälle über Jahre hindurch statt. Jeder fieberte einer Einladung entgegen, denn beim Erzherzog gab es sogar ein »sitzendes Diner« (etwas, das sonst nur den Erwachsenen vorbehalten war). Außerdem musste man vorher seine Kotillondame, die zugleich die Tischdame war, bekanntgeben – was hektische Nervosität bei den Mädchen verursachte. Denn nun würden sie ihren ersten Ball besuchen und jeder konnte sehen, welcher junge Mann sich für sie entschied.
Bei Hof selbst gab es zu Zeiten Kaiser Franz Josephs nur äußerst selten Adoleszentenbälle. Da sie stets nur von der ranghöchsten Dame des Hofes ausgerichtet werden durften, fanden zu Zeiten von Kaiserin Elisabeth, die gesellschaftliche Aktivitäten nicht leiden konnte, keine Kinder- oder Jugendbälle statt. Erzherzogin Sophie, die Mutter des Kaisers, hatte noch unzählige Kinderfeste und Bälle für ihre Söhne und zahlreichen Neffen und Nichten ausgerichtet. »Sisi« hingegen machte lediglich für ihre jüngste Tochter Marie Valerie eine Ausnahme und veranstaltete einmal einen Adoleszentenball, zu dem einige Töchter und Söhne der Aristokratie geladen wurden.
Bei der Aristokratie waren die höfischen Adoleszentenbälle am beliebtesten, weil sie stets in kleinem Rahmen in der Hofburg stattfanden, maximal zwanzig Mädchen und Burschen, und man dem Kaiser und der Kaiserin wesentlich näherkam als bei den riesigen Hofbällen.
Die Adoleszentenbälle bei Hof hatten große Ähnlichkeit mit wirklichen Hofbällen. Kaiser und Kaiserin hielten Cercle mit Jugendlichen, diese benahmen sich entsprechend der höfischen Etikette, es gab Tanz und Buffet. Diese »Hofbälle im Kleinen« sollten die Jugend auf ihr späteres Auftreten bei Hof vorbereiten. Die geladenen Mädchen mussten artig sein, perfekte Manieren zeigen und stets höflich auf die Fragen der Erwachsenen antworten. Außerdem mussten sie bereits wissen, wie man respektvoll antwortete, wenn Kaiser oder Kaiserin ihnen die Gnade erwiesen, sie ins Gespräch zu ziehen.
Manche Mädchen waren aber eindeutig noch zu jung, um ein gleichbleibendes, selbstbeherrschtes Verhalten, das zudem den Regeln des Hofes entsprach, an den Tag legen zu können. Eine Hofdame Kaiserin Elisabeths notierte in ihrem Tagebuch eine reizende Szene: Zum Adoleszentenball der Kaisertochter Marie Valerie wurde auch die erst zehnjährige Prinzessin Dorothea Hohenlohe-Schillingsfürst, genannt »Do«, eingeladen. Um vier Uhr hat das Fest angefangen und um neun Uhr sitzt die kleine Do schon völlig schläfrig auf einem Sessel. Die Kaiserin nähert sich ihr und fragt ganz sanft: »Do, willst Du etwas essen?« Die Kleine, der man daheim eingeschärft hat, wie sie der Kaiserin oder dem Kaiser nach den Regeln der Etikette antworten solle, erwidert perfekt: »Ich danke Euer Majestät tausendmal, nein.« Die Kaiserin fragt das Mädchen noch einmal: »Willst Du kein Gefrorenes, Kompotte, Tee, Limonade, Backwerk?« Die kleine Do lehnt erneut nach allen Regel der Etikette dankend ab. Als die Kaiserin nun freundlich nachfragt: »Sage, Do, was willst du denn?«, fährt die kleine Prinzessin in die Höhe und sagt ärgerlich: »Ruhe möchte ich haben und schlafen möchte ich gehen!« Die Kaiserin war hingerissen von der kleinen Do und sagte lachend: »Du bist eine gescheite, kleine Person – das möchte ich auch oft.«19