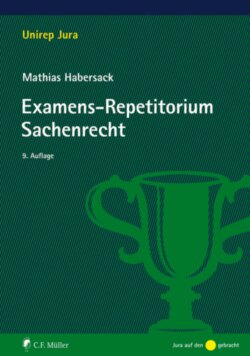Читать книгу Examens-Repetitorium Sachenrecht - Mathias Habersack - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Grundsatz
Оглавление5
Die Vorschriften der §§ 854 ff. regeln die Rechtsverhältnisse an Sachen und knüpfen damit an die Definitionsnorm des § 90 an.
→ Definition:
Sachen im Rechtssinne sind danach nur körperliche Gegenstände; grundsätzlich kann deshalb nur an ihnen Eigentum, ein beschränktes dingliches Recht oder Besitz bestehen.
Der Begriff der Sache wirft freilich eine Vielzahl von Fragen auf[10]. Dies gilt weniger für die – Symbolcharakter aufweisende – Sondervorschrift des § 90a, wonach Tiere zwar keine Sachen sind, indes den für Sachen geltenden Vorschriften unterliegen und somit ebenfalls einen Gegenstand dinglicher Rechte bilden. Schon die Frage, ob Daten eigentumsfähig sind, ist freilich nicht leicht zu beantworten. Klar ist zunächst, dass der Datenträger (etwa ein USB-Stick) Sacheigenschaft hat; auch können Daten, soweit sie, wie namentlich „Software“, das Resultat geistiger Leistung sind, immaterialgüterrechtlichen Schutz genießen[11]. Hingegen fehlt es Daten als solchen (mögen sie auf einem körperlichen Datenträger oder in der Cloud gespeichert sein) – ebenso wie beispielsweise elektrischer Energie[12] – de lege lata[13] an der im Rahmen des § 90 unerlässlichen Körperlichkeit[14]. Einen Schutz des Rechts an Daten nach § 823 Abs. 1 muss dies zwar nicht ausschließen[15]; für die Anerkennung von Dateneigentum im sachenrechtlichen, auf die Möglichkeit der Zuordnung eines körperlichen und damit beherrschbaren Gegenstands abstellenden Sinne ist hingegen kein Raum. Davon betroffen sind auch „digitale Wertpapiere“, darunter auch auf Blockchain-Transaktionen zurückgehende Kryptokoken (insbesondere BitCoins)[16]. Sie lassen sich de lege lata schon deshalb nicht als Wertpapiere qualifizieren, weil es ihnen an der Verkörperung eines Rechts in einer Urkunde (die nach §§ 929 ff. übertragen und nach Maßgabe der §§ 932 ff. auch vom Nichtberechtigten erworben werden kann, s. Rn. 353a) fehlt[17]. Doch plant der Gesetzgeber, digitale Wertpapiere durch Fiktion zu Sachen zu erklären und in einem elektronischen Wertpapierregister zu erfassen[18].
6
Von den körperlichen sind die unkörperlichen Gegenstände zu unterscheiden. Bei ihnen handelt es sich vor allem[19] um die bereits erwähnten geistigen Werke und Daten. Wie die Sachen existieren auch diese Gegenstände außerhalb der Rechtsordnung; auch insoweit steht die Rechtsordnung vor der Frage, ob und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen sie Rechte (nämlich die Immaterialgüterrechte) anerkennt, die sich auf diese unkörperlichen Gegenstände beziehen[20]. Man kann die körperlichen und unkörperlichen Gegenstände auch als Rechtsobjekte bezeichnen und dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie Gegenstand eines Rechts sind[21]. Davon zu unterscheiden sind die Verfügungsobjekte, also die Gegenstände, über die verfügt wird (Rn. 13).
7
Aus Gründen, die noch zu erörtern sein werden (Rn. 14 ff.), beziehen sich die dinglichen Rechte und der Besitz stets nur auf die einzelne Sache[22]. Sachgesamtheiten und das Vermögen als solches können mit anderen Worten nicht Gegenstand von Sachenrechten sein[23]. Auch der in §§ 1085 ff. geregelte „Nießbrauch an einem Vermögen“ ist keine Ausnahme, stellt doch § 1085 S. 1 ausdrücklich klar, dass die Bestellung in der Weise zu erfolgen hat, dass der Nießbraucher den Nießbrauch an den einzelnen zu dem Vermögen gehörenden Gegenständen erlangt.
8
Die Rechtsprechung qualifiziert freilich den „eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb“ als „sonstiges Recht“ im Sinne des § 823 Abs. 1 und spricht somit dem Unternehmer den deliktischen Schutz auch insoweit zu, als nicht die Verletzung eines Einzelnen, seinerseits nach § 823 Abs. 1 geschützten Gegenstands, sondern ein Eingriff in das Unternehmen als solches in Frage steht[24]. Indes versteht sich diese – von Teilen des Schrifttums zu Recht kritisierte[25] – Rechtsprechung als Ergänzung der auf ein Wettbewerbsverhältnis abstellenden und deshalb als lückenhaft empfundenen Vorschriften des UWG; das vermeintliche subjektive Recht am Unternehmen wird geschaffen, um es sodann mit Verhaltensgeboten zu umgeben. Damit wird freilich der genuine Anwendungsbereich des § 823 Abs. 1 verlassen. Diese Vorschrift ist nämlich, wie sich ihrer Entstehungsgeschichte entnehmen lässt[26], im Sinne einer „Verweisungsnorm“ konzipiert: Sie nimmt auf von der Rechtsordnung anerkannte Herrschaftsrechte Bezug und spricht diesen deliktischen Schutz zu[27], vermag aber nicht selbst „sonstige Rechte“ zu begründen. Ein auf § 823 Abs. 1 gründender Schutz des Unternehmens bildet mithin einen Fremdkörper und vermag nichts daran zu ändern, dass Herrschaftsrechte nur an einzelnen Gegenständen bestehen.