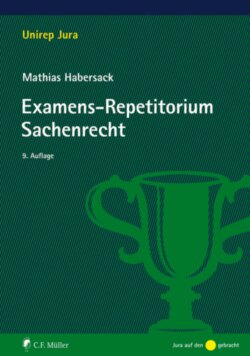Читать книгу Examens-Repetitorium Sachenrecht - Mathias Habersack - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Die Belastung eines Rechts
Оглавление10
Die Belastung eines Rechts begegnet inner- und außerhalb des Sachenrechts und wirft im vorliegenden Zusammenhang die Frage auf, ob das belastete Recht nunmehr seinerseits als (unkörperliches) Rechtsobjekt und damit als mit den Sachen auf einer Stufe stehender Gegenstand zu qualifizieren ist. Die Frage stellt sich für die Pfand- und Nutzungsrechte an beweglichen und unbeweglichen Sachen, aber auch für die in §§ 1068 Abs. 1, 1273 Abs. 1 vorgesehene Belastung eines „Rechts“ mit einem Nießbrauch oder Pfandrecht. Die Tatsache, dass das Recht als solches „belastet“ wird, könnte zu der Annahme verleiten, dass dieses Recht unverändert an dem Rechtsobjekt fortbesteht und als Vollrecht seinerseits Rechtsobjekt eines weiteren Rechts sei. Als zutreffend erscheint indes die Annahme, die Belastung eines Rechts führe zu einer Abspaltung und Verselbständigung bestimmter Befugnisse des Vollrechtsinhabers und damit letztlich zu einer Aufteilung der in dem (unbelasteten) Recht verkörperten Befugnisse[29]. Im Ergebnis stellt sich somit die Belastung als Teilübertragung des Rechts dar; dies entspricht auch der Regelungstechnik des BGB, das in §§ 1032, 1069, 1205, 1274 die Vorschriften über die Übertragung des Vollrechts für entsprechend anwendbar erklärt und in § 873 einheitliche Voraussetzungen für die Vollübertragung und die Belastung aufstellt. Die Belastung ist somit zwar Verfügung über das Vollrecht (Rn. 13); Letzteres ist jedoch nicht das Rechtsobjekt des beschränkten Rechts.
11
So verkörpert etwa das Eigentum der mit einem Pfandrecht belasteten Sache weiterhin die Veräußerungs- und Nutzungsbefugnis; die Verwertungsbefugnis geht dagegen auf den Pfandgläubiger über. Dabei bleibt es auch für den Fall, dass der Eigentümer sodann sein Eigentum aufgibt: Ungeachtet der Dereliktion besteht das beschränkte dingliche Recht fort (Rn. 253), da es Recht an der Sache und nicht Recht an einem Recht ist. Entsprechendes gilt für das Pfandrecht an einer Forderung. Auch seine Bestellung hat man sich als Abspaltung der Verwertungsbefugnis von der Forderung und Verselbständigung in der Person des Pfandgläubigers vorzustellen. Der Pfandgläubiger erlangt dadurch ein eigenes Forderungsrecht, welches zwar den Beschränkungen der §§ 1281 ff. unterliegt, aber seinerseits nach Maßgabe dieser Vorschriften das fortbestehende Forderungsrecht des Gläubigers beschränkt. Das Pfandrecht an einer Forderung existiert also nicht als Recht an der Forderung, sondern tritt als selbständiges Recht neben dieselbe. Auch insoweit gilt, dass die Aufhebung des Forderungsrechts die Rechtsposition des Pfandgläubigers unangetastet lässt; § 1276 sagt dies ausdrücklich.
12
Auf der Grundlage der hier vertretenen Ansicht ist nicht das Eigentum, sondern die Sache Rechtsobjekt des beschränkten dinglichen Rechts; das Eigentum ist dagegen Verfügungsobjekt (Rn. 13) und wird durch die Begründung des beschränkten dinglichen Rechts „belastet“ (Rn. 10, 57). Das beschränkte dingliche Recht ist deshalb ebenso wie das Eigentum Recht an einer Sache und damit „Herrschaftsrecht“ (Rn. 2, 57 f.). Für den Nießbrauch und das Pfandrecht an der Forderung gilt dagegen, dass sie ebenso wenig wie die Forderung selbst einen Gegenstand zuordnen und deshalb nur als relatives Recht qualifiziert werden können[30]. Wenn in §§ 1068 Abs. 1, 1273 Abs. 1 davon die Rede ist, dass Gegenstand eines Nießbrauchs oder Pfandrechts „auch ein Recht“ sein kann, so darf dies mithin nicht in dem Sinne verstanden werden, dass das Vollrecht selbst Objekt des beschränkten Rechts sei.