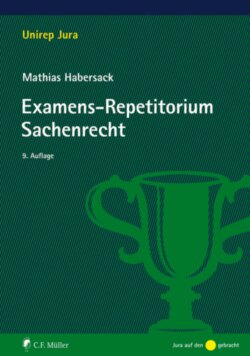Читать книгу Examens-Repetitorium Sachenrecht - Mathias Habersack - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеErster Teil Grundlagen › § 2 Die sogenannten Sachenrechtsgrundsätze
§ 2 Die sogenannten Sachenrechtsgrundsätze
Inhaltsverzeichnis
I. Der absolute Charakter der Sachenrechte als Ausgangspunkt
II. Die einzelnen Grundsätze
I. Der absolute Charakter der Sachenrechte als Ausgangspunkt
14
Wie das Schuldrecht ist auch das Sachenrecht durch eine Reihe von Strukturprinzipien gekennzeichnet, die allesamt darauf zurückzuführen sind, dass die Rechte an Sachen dem Rechtsinhaber eine Sache mit dinglicher Wirkung zuordnen und somit „Herrschaftsrechte“ sind (Rn. 2). Schon dieser Zusammenhang mit der absoluten Wirkung des Rechts deutet darauf hin, dass die Geltung der im Folgenden darzustellenden Grundsätze keineswegs zwangsläufig auf das Sachenrecht beschränkt ist.[1] Mit gewissen Abstufungen begegnen diese Grundsätze vielmehr in sämtlichen Fällen, in denen die Rechtsordnung absolute Rechte anerkennt, bisweilen auch darüber hinaus (Rn. 16 f.). Zudem gilt es zu beachten, dass es sich um „Grundsätze“ handelt, Regeln also, die mitnichten strikte Geltung beanspruchen, sondern durch Gesetzes- und Richterrecht durchbrochen sind. Die im Folgenden darzustellenden Grundsätze werden schließlich durch den Grundsatz der Übertragbarkeit von Sachenrechten und durch den Trennungs- und Abstraktionsgrundsatz ergänzt; diese Grundsätze sollen allerdings im Zusammenhang mit dem dinglichen Rechtsgeschäft dargestellt werden (Rn. 19 ff., 27 ff.).
II. Die einzelnen Grundsätze
1. Typenzwang und Typenfixierung
15
Ist es ein Kennzeichen des Herrschaftsrechts, dass es absolut wirkt, also von jedermann zu respektieren ist, so versteht es sich von selbst, dass solche Rechtspositionen nicht beliebig geschaffen werden können. Das Gesetz stellt vielmehr nur eine begrenzte Anzahl von Sachenrechten zur Verfügung und legt zudem den wesentlichen Inhalt dieser Rechte zwingend fest[2]. Nur unter diesen Gegebenheiten erscheint es ihm als akzeptabel, dass jedermann die Sachenrechte anderer zu respektieren hat. Freilich hat der Grundsatz des Typenzwangs nicht zuletzt durch die Herausbildung des Sicherungseigentums und des Anwartschaftsrechts eine nicht unerhebliche Relativierung erfahren (Rn. 204 ff., 241 ff.). Zudem darf der Grundsatz nicht im Sinne einer zwingenden Geltung des gesamten Sachenrechts missverstanden werden. Jenseits eines Kernbereichs der sachenrechtlichen Regeln, der vor allem die Entstehung, die Übertragung und den Inhalt des dinglichen Rechts umfasst, gibt es zahlreiche Vorschriften, die abdingbar sind. Dies gilt insbesondere für einen Teil der Vorschriften, die das Schuldverhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Inhaber eines beschränkten dinglichen Rechts regeln (Rn. 37, 58), ferner für Vorschriften aus dem Bereich des Nachbarrechts[3]. Auch in Fällen dieser Art wirkt aber die vom Gesetz abweichende Vereinbarung grundsätzlich nur inter partes; ein Einzelrechtsnachfolger braucht sich somit die Inhaltsänderung des Eigentums oder des beschränkten dinglichen Rechts grundsätzlich nicht entgegenhalten zu lassen.
2. Spezialität
16
Aus Gründen der Rechtsklarheit können dingliche Rechte nur an einzelnen Sachen bestehen. Das Gesetz bringt diesen Grundsatz der Spezialität etwa in § 929 S. 1 zum Ausdruck, wonach es zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache der Einigung und der Übergabe bedarf; noch deutlicher ist die schon erwähnte Vorschrift des § 1085 S. 1 (Rn. 7). Der Grundsatz der Spezialität begegnet freilich, soweit man ihn auf das Innehaben eines Rechts bezieht, auch außerhalb des Bereichs der Herrschaftsrechte; auch das Forderungsrecht steht als einzelnes Recht dem jeweiligen Gläubiger zu[4]. Von wesentlicher Bedeutung ist der Spezialitätsgrundsatz für den Bereich der Verfügungsgeschäfte: sie sind unmittelbar auf die Änderung der Rechtslage an einem Recht gerichtet und müssen sich deshalb, damit das Schicksal der subjektiven Rechte für jedermann klar ist, stets auf ein einzelnes Recht beziehen[5]. Auch der so verstandene Spezialitätsgrundsatz beansprucht freilich für sämtliche Verfügungsgeschäfte und damit auch für die Übertragung oder Belastung einer Forderung Geltung. Er ist also mitnichten ein Grundsatz allein des Sachenrechts, mag ihm auch insoweit angesichts der Publizitätserfordernisse (Rn. 18, 23 ff.) besondere Bedeutung zukommen.
17
Vom Spezialitätsgrundsatz wird bisweilen der Bestimmtheitsgrundsatz unterschieden[6]. Danach soll die Wirksamkeit einer Verfügung voraussetzen, dass der Gegenstand der Verfügung bestimmt oder doch bestimmbar bezeichnet ist. Indes wird genau dies durch den Spezialitätsgrundsatz erreicht. Muss sich nämlich das Verfügungsgeschäft auf ein einzelnes Recht beziehen, so ist damit zugleich gewährleistet, dass der Eintritt der Rechtsänderung für jedermann erkennbar ist. Der Spezialitätsgrundsatz zielt also auf die Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit von Verfügungsgeschäften, weshalb er zwar auch als Bestimmtheitsgrundsatz bezeichnet werden kann, sich von diesem aber nicht unterscheidet.
3. Publizität
18
Mit Rücksicht auf den absoluten Charakter des dinglichen Rechts ist das Sachenrecht bestrebt, die dingliche Rechtslage und jede Änderung derselben nach außen sichtbar zu machen. Es ist dazu ohne weiteres in der Lage, handelt es doch von körperlichen und damit „greifbaren“ Gegenständen (Rn. 5 ff.). Der Grundsatz der Publizität soll also sicherstellen, dass die Rechtsverhältnisse an Sachen, die wegen des absoluten Charakters der dinglichen Rechte von jedermann zu beachten sind, nach außen erkennbar sind[7]. Publizitätsmittel sind der Besitz und die Eintragung in das Grundbuch. Das Gesetz weist diesen Publizitätsmitteln drei Funktionen zu[8]:
| • | So ist die Publizität der Rechtsänderung grundsätzlich Teil des Verfügungstatbestands, so dass für die Offenkundigkeit einer jeden Änderung der dinglichen Rechtslage gesorgt ist (Rn. 23 ff.). |
| • | Zudem stellen §§ 891, 1006, 1065, 1227 die Vermutung auf, dass derjenige, der in seiner Person den Publizitätstatbestand erfüllt und somit nach außen als Berechtigter erscheint, auch tatsächlich Inhaber des jeweiligen dinglichen Rechts ist. |
| • | Schließlich knüpft das Gesetz an die Verwirklichung des Publizitätstatbestands die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten (Rn. 147 ff.). Bei Auseinanderfallen von materieller Rechtslage und Besitz oder Grundbuch besteht also die Gefahr des Rechtsverlusts; dadurch wird das Publizitätsprinzip immerhin mittelbar abgesichert[9]. |