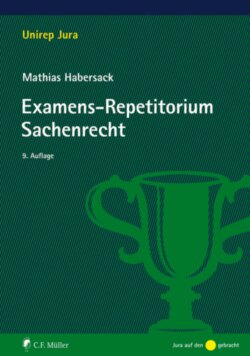Читать книгу Examens-Repetitorium Sachenrecht - Mathias Habersack - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
b) Das Abstraktionsprinzip
Оглавление29
Mit der Trennung zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft ist noch nichts darüber ausgesagt, in welchem Verhältnis beide Geschäfte zueinander stehen. Das BGB hat sich, wie sich wiederum den §§ 398, 873, 929 entnehmen lässt, für das Abstraktionsprinzip entschieden: Die Wirksamkeit des Verfügungsgeschäfts ist allein von dessen Voraussetzungen abhängig[7]. Was die Übertragung eines Rechts betrifft – für die Belastung gilt Entsprechendes (Rn. 57 ff.) –, so bedarf es also lediglich der Einigung über den Rechtsübergang sowie gegebenenfalls der Verlautbarung desselben. Nicht erforderlich ist dagegen, dass sich die Parteien über den Zweck der Verfügung verständigen[8]; die Verfügung ist vielmehr „zweckfrei“ und selbst dann wirksam, wenn die Parteien bei Vornahme des Verfügungsgeschäfts bewusst von dem Pflichtenprogramm abweichen[9]. Vor allem aber setzt die Wirksamkeit des Verfügungsgeschäfts nicht die Existenz eines wirksamen Verpflichtungsgeschäfts voraus[10]. Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft sind vielmehr jeweils für sich auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen; insbesondere hat die Unwirksamkeit des einen nicht zwangsläufig die Unwirksamkeit des anderen zur Folge.
30
Mit dem Abstraktionsprinzip hat der Gesetzgeber für Verkehrsschutz sorgen wollen: Mängel des Verpflichtungsgeschäfts sollen nicht auf das Verfügungsgeschäft durchschlagen. Der Erwerber wird vielmehr auch dann Inhaber des Rechts, wenn es an einem Rechtsgrund für den Erwerb (an einer „causa“) fehlt; er kann als Berechtigter über das wirksam erworbene Recht verfügen, so dass es eines Rückgriffs auf die – ohnehin nur für Sachenrechte bestehende – Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs nicht bedarf. Ist somit die causalose Verfügung, sofern sie nicht ihrerseits unter einem Mangel leidet (Rn. 31), wirksam, so bedeutet dies freilich nicht, dass der Erwerb von Bestand ist. In Ermangelung eines „Behaltensgrundes“ ist der Erwerber vielmehr nach § 812 Abs. 1 S. 1 Fall 1 verpflichtet, das erlangte Recht zurückzugewähren; zur Erfüllung dieser Verpflichtung bedarf es eines actus contrarius und damit eines erneuten Verfügungsgeschäfts. Gerade in diesem Erfordernis liegen die aus Sicht des Veräußerers bestehenden Gefahren des Abstraktionsgrundsatzes begründet. Solange nämlich der Erwerber seiner Verpflichtung zur Rückgewähr nicht nachgekommen ist, unterliegt das Recht dem Zugriff seiner Gläubiger und des Insolvenzverwalters. Der Veräußerer hat somit nicht nur den Verlust seines auf Rückgewähr gerichteten Primäranspruchs, sondern vor allem den Ausfall mit seinem Wertersatzanspruch aus § 818 Abs. 2 zu befürchten. Er trägt mit anderen Worten das Risiko der Insolvenz des Erwerbers. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist das Abstraktionsprinzip Gegenstand rechtspolitischer Kritik[11].