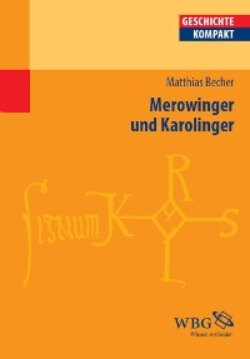Читать книгу Merowinger und Karolinger - Matthias Becher - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Q
Оглавление„[I.] Euren scharfen Geist haben die Anhänger von allerlei Sekten mit ihren verschieden gerichteten, vielfältigen, aller Wahrheit baren Lehrmeinungen als dunkle Christen zu benebeln gesucht. (…) Ja, es hat für unsere Zeit die göttliche Vorsehung einen Mann der Entscheidung gefunden! Indem Ihr für Euch wählt, gebt Ihr das Urteil für alle; so ist Euer Glaube – Unser Sieg. [II.] Es pflegen die meisten in einem solchen Fall – wenn Mahnung der Priester oder Zuspruch irgendwelcher Genossen sie dahin bringt, daß sie im Glauben Gesundung suchen – sie pflegen die Gewohnheit ihres Geschlechtes und den Brauch von vatersher entgegenzusetzen. So stellen sie zum Verderben ihre Scham über ihr Heil, und indem sie ihren Eltern in Bewahrung des Unglaubens unnütze Verehrung erweisen, bekennen sie, daß sie eigentlich gar nicht wissen, worum die Wahl geht. Möge nun, nach so wunderbarem Geschehen, die schädliche Scham auf diese Entschuldigung verzichten! Ihr, dem von dem ganzen uralten Stammbaum der bloße Adel genug ist, Ihr habt gewollt, daß alles, was den Gipfel der Hoheit irgend zu zieren vermag, für Eure Nachkommenschaft bei Euch den Ausgang nehme. Gutes habt Ihr geerbt, Besseres wolltet Ihr vererben: Ihr verantwortet Euch vor den Vorfahren dahin, daß Ihr auf Erden regiert; Ihr gabet es den Nachfahren zum Gesetz, daß Ihr im Himmel regieren möget.“ (Avitus, Opera, S. 75f.; Übers.: VON DEN STEINEN, Chlodwigs Übergang, S. 480ff.).
Avitus deutet an, dass Chlodwig mit der Taufe auf wichtige Zuschreibungen aus seinem bisher behaupteten Stammbaum verzichtete. Vermutlich meinte er damit eine Abstammung von den Göttern, die bis dahin Chlodwigs Herrschaft über die Franken legitimiert haben dürfte. Die Abwendung vom Heidentum war also schon an sich ein revolutionärer Akt, nur dass dieser Aspekt in der Forschung oft genug hinter der Alternative Katholizismus – Arianismus zurücktritt. Den meisten Franken fiel die Abkehr von der alten Religion sicher nicht leicht. Es ist daher wohl kein Zufall, dass der König seinen populus, sein Volk oder besser seine Großen, zunächst befragte und dass sich zusammen mit ihm 3000 seiner Gefolgsleute taufen ließen. Beides hebt Gregor von Tours eigens hervor. Auch wenn diese Zahl wohl der Bibel (Apg 2, 41) entlehnt ist, spricht der Bericht doch insgesamt dafür, dass der König diese Entscheidung nicht allein getroffen hat, sondern dass er sich in dieser fundamentalen Frage mit seinem Volk abgestimmt hatte. Womit aber hatte Chlodwig seine Krieger von der Richtigkeit des Religionswechsels überzeugt? Hier mag Gregor von Tours mit seiner Deutung des Alemannensieges letztlich das Richtige gesehen haben: Der militärische Erfolg Chlodwigs war es, der es ihm ermöglichte, sich vom alten Glauben ab- und dem neuen zuzuwenden. Das Kriegsglück war Chlodwigs eigentliche Legitimation zu herrschen und damit auch die Religion zu wechseln, unabhängig von der Frage, ob er sich während einer bestimmten Schlacht dazu entschied.
Was machte nun die christliche Religion in ihrer katholischen Form so attraktiv für den Frankenherrscher? Rom, das Vorbild des römischen Reiches und die Anerkennung durch den römischen Kaiser waren für sämtliche Barbarenkönige, die sich auf römischem Reichsboden niederließen, besonders wichtig. Seit Konstantin dem Großen, also seit dem ersten Viertel des 4. Jahrhunderts, war das Christentum die dominierende Religion im Imperium und seit Theodosius dem Großen, also seit dem Ende des 4. Jahrhunderts, sogar die Staatsreligion. Seither entwickelte sich eine Verbindung von Staat und Kirche: Der Kaiser entschied nun auch über Fragen des Glaubens, wie dies erstmals im Konzil von Nicäa 325 geschah, das Konstantin der Große – damals noch Anhänger einer aus christlicher Sicht heidnischen Religion – faktisch leitete. Es ist sicherlich kein Zufall, dass 511 in Orléans das erste gesamtfränkische Reichskonzil noch unter Chlodwig zusammentrat. Insgesamt eignete sich das Christentum in seiner römisch-imperialen Ausprägung ungleich besser für die herrscherliche Selbstdarstellung als die alte heidnische Religion. Als Beispiel kann Chlodwigs Grablege dienen. An seinem Regierungssitz Paris, seiner cathedra regni, ließ er eine prachtvolle Kirche bauen, die den Aposteln geweiht war. Auch Konstantin der Große ruhte seit 337 in Konstantinopel in einer den Aposteln geweihten Kirche. Diese Parallele ist wohl kein Zufall, denn auch Theoderich der Große berief sich fast zur gleichen Zeit bei der Gestaltung seines Grabes in Ravenna auf die zwölf Apostel. Beide Germanenkönige suchten also, das kaiserliche Vorbild nachzuahmen und sich so in die Traditionen des römischen Kaisertums zu stellen.
Der rasche Übertritt der Franken zum katholischen Glauben ist eine, möglicherweise sogar die wichtigste Voraussetzung dafür, dass sich ihr Reich allen anderen germanischen Reichsgründungen auf dem Boden des Imperiums als überlegen erweisen sollte. Auch Westgoten und Langobarden traten zwar schließlich zum Katholizismus über, aber erst zu Beginn des 7. Jahrhunderts. Zuvor hatte der religiöse Gegensatz zwischen ihnen als Arianern und der katholischen Mehrheit zu inneren Spannungen geführt, was der Stabilität ihrer Reiche nicht gerade zuträglich war. In Gallien kam es hingegen viel schneller zu einer Annäherung zwischen Romanen und Franken, und schließlich verschmolzen beide Bevölkerungsgruppen zu einem einheitlichen Personenverband, dessen Selbstverständnis fränkisch bestimmt war, dessen Sprache aber teils romanisch, teils fränkisch war, was auf den inneren Zusammenhalt des Volkes gleichwohl keine schwerwiegenden Auswirkungen hatte.
Aufstieg zur Großmacht
Auch nach seinem Übertritt zum Christentum eilte Chlodwig von Sieg zu Sieg. 498 kam es zu einem Krieg mit den Westgoten, in dessen Verlauf er bis Bordeaux vorstieß. Er nutzte diesen Erfolg jedoch nicht aus, sondern mischte sich in innerburgundische Auseinandersetzungen ein. 506 erhoben sich die Alemannen, die im Krieg zuvor die fränkische Oberhoheit anerkannt hatten. Chlodwig besiegte sie und setzte dann ihrer inneren Autonomie ein Ende. Künftig wurden sie von Herzögen regiert, die der König einsetzte. Auch bis dahin alemannische Territorien, wie etwa Worms und Speyer, fielen spätestens zu jener Zeit an die Franken. Viele Alemannen flüchteten damals in das ostgotische Rätien. Als die Franken den Besiegten folgten, gebot Theoderich der Große seinem Schwager Chlodwig Einhalt. Der Franke wagte keine direkte militärische Auseinandersetzung mit dem Ostgotenkönig, obwohl er in der Vergangenheit dessen Bündnispartner immer wieder angegriffen hatte. Ende des 5. Jahrhunderts war Chlodwig in das westgotische Aquitanien eingedrungen, hatte sich dann aber im Jahr 500 gegen die Burgunder gewandt. Der Übertritt des Burgunderkönigs Sigismund zum katholischen Glauben 507 gab – möglicherweise in Abstimmung mit dem oströmischen Kaiser – gleichsam das Signal zum Angriff auf die arianischen Westgoten. Bei Vouillé besiegte Chlodwig den westgotischen König Alarich II., der in der Schlacht fiel. Im folgenden Jahr eroberten die Verbündeten die westgotische Hauptstadt Toulouse. Erst jetzt konnte Theoderich in den Krieg eingreifen, da eine oströmische Flottenaktion ihn bisher davon abgehalten hatte. Er übernahm selbst die Herrschaft bei den Westgoten und stabilisierte die Lage im südlichen Gallien. Die fränkischen Eroberungen konnte er freilich nicht rückgängig machen: Chlodwig beherrschte nun Aquitanien und damit auch den größten Teil Galliens. Er verlegte jetzt seinen Sitz von Soissons nach Paris, das aufgrund seiner Lage im Verkehrsnetz nach der jüngsten Erweiterung des Reiches die ideale Hauptstadt war.
Das Frankenreich war mit Chlodwigs Sieg endgültig zu einer Großmacht geworden. Das Prestige des Franken konnte sich nun mit dem des großen Ostgotenkönigs messen. Das erkannte auch der oströmische Kaiser Anastasius I. an und ließ Chlodwig im Jahr 508 eine hohe Ehre zuteil werden, die dieser in Tours entgegennahm, der Stadt des fränkischen Reichsheiligen Martin: