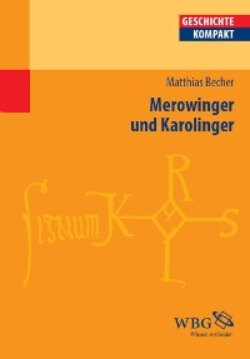Читать книгу Merowinger und Karolinger - Matthias Becher - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Die Franken: Siedlung, Recht, Sozialverfassung
ОглавлениеNur schemenhaft tritt uns das Volk der Franken entgegen. Demographische Angaben sind für das frühe Mittelalter kaum möglich. Aufgrund von Analogieschlüssen kommt man auf die Zahl von ca. 200.000 fränkischen Siedlern im Gebiet nördlich der Seine und südlich der Somme, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Franken nach ihren Erfolgen von anderen Völkern Zuzug erhielten bzw. kleinere germanische Völker, die bislang in diesen Gebieten gesiedelt hatten, in ihnen aufgegangen sind. Dieser relativ geringen Zahl von Franken standen zwischen sechs und sieben Millionen Gallorömer in ganz Gallien gegenüber. Die Besiedlung durch die Franken war aber in den verschiedenen Teilen Galliens verschieden intensiv. Neben der Analyse der Schriftquellen stehen uns zur Erforschung dieses Problems die Auswertung der Bodenfunde und eine Interpretation der Ortsnamen zur Verfügung.
Fränkische Siedlungen in Gallien
Um die Mitte des 4. Jahrhunderts tritt eine neue Form der Totenbestattung im nördlichen Gallien zwischen Rhein und Seine auf, die sogenannten Reihengräberfelder. Sie sind in der Nähe von spätantiken Kastellen oder anderen Militäranlagen zu finden und werden daher als Garnisonsfriedhöfe angesehen, zumal den Toten Waffen mit ins Grab gegeben wurden. Da dies bei römischen Soldaten nicht üblich war, handelt es sich vermutlich um barbarische Krieger in römischen Diensten, also auch Franken. Ihre Gräberfelder finden sich vor allem im Osten des Reiches an Rhein und Mosel; im Westen lassen sie „sich jenseits von Somme und Maas bis zur Seine und Marne, aber nur wenig darüber hinaus“ nachweisen (EWIG, Merowinger, S. 59). Das entspricht dem Ortsnamenbefund, der auf eine von Flandern bis an die Seine reichende fränkische Besiedlung hinweist, wobei die Siedlungsdichte (der Franken) von Norden nach Süden nachlässt.
Auf fränkische Ortsgründungen weisen insbesondere auch die Ortsnamen hin, die mit den Silben -ingen, -alach -dorf und -heim enden. Die -ingen-Namen belegen Sippen oder Gefolgschaftssiedlungen; die „altertümlichen und seltenen Toponyme auf -alach (…) sind kennzeichnend für noch nicht voll zur Ruhe gekommene Volksgruppen. Die -heim-Namen, die massiert am Rhein und in den südlichen Niederlanden auftreten, setzen dagegen feste Wohnplätze voraus. Sie reichen ‚ohne Bruch‘ in die Romania hinein, wo ihnen Bildungen auf -court und -ville entsprechen, und zeugen somit von der frankogallischen Symbiose der Merowingerzeit“ (EWIG, Merowinger, S. 56). Die Ortsnamen auf -dorf sind etwas jünger als diejenigen auf -heim und weisen auf Siedlungen hin, die mehrere Höfe umfassten. In den Zentren fränkischer Siedlung haben sich aber auch zahlreiche vorgermanische Ortsnamen erhalten. Die Franken gründeten also nicht nur neue Siedlungen, sie knüpften auch an bestehende an.
Die Sprachgrenze hat im frühen Mittelalter einen anderen Verlauf genommen als heute. Vermutlich hat sie sich während des frühen Mittelalters nach Norden hin zurückverlagert. Eine genaue Analyse ist schwierig, weil eine mit höchster Wahrscheinlichkeit anzunehmende Zweisprachigkeit genaue Grenzziehungen unmöglich macht. Schließlich muss auch bedacht werden, dass im geschlossenen germanischen Sprachbereich weiterhin romanischsprachige Enklaven bestehen blieben, so etwa in der Gegend von Trier bis in die Ottonen- und Salierzeit. Insgesamt spricht vieles dafür, dass der Anteil der Romanen in den Städten des Ostens wie Köln, Mainz oder Trier noch lange Zeit sehr hoch war. In Aquitanien und der Provence siedelten die Franken dagegen nicht. Dort übten sie also ‚lediglich‘ die politische Herrschaft aus. Südlich der Loire konnte daher die spätantike Kultur nahezu ungebrochen fortbestehen. Nicht umsonst bezeichneten die fränkischen Geschichtsschreiber die dortige Bevölkerung als Romani, als Römer. Langfristig gesehen liegt hierin sicherlich der Grund für die im Mittelalter bestehende Nord-Süd-Teilung des Frankenreiches bzw. Frankreichs.
Die unterschiedliche Siedlungsintensität der Franken im ehemaligen römischen Gallien hatte in ethnischer und sprachlicher Hinsicht also eine Dreiteilung zur Folge: Im Osten, am Rhein, in den heutigen Niederlanden und Flandern, dominierten eindeutig die Franken. Südlich der Loire siedelten sie dagegen nicht; hier existierte eine Zone spätantiker Kontinuität, die nach Süden hin immer stärker wurde. Zwischen Somme und Maas bis zur Seine und Marne, örtlich vielleicht auch bis zur Loire, siedelten die Franken schließlich inmitten einer Bevölkerungsmehrheit von Romanen. Das war die Voraussetzung für einen intensiven Kulturaustausch: Während die Franken allmählich die romanische Sprache annahmen, gaben die Romanen ihr Eigenständigkeitsgefühl auf und begannen, sich als Franken zu fühlen.
Lex Salica
Das Recht, nach dem die Franken lebten, war die Lex Salica, die Chlodwig kurz vor seinem Tod hatte aufzeichnen lassen. Sie bestand u.a. aus dem sogenannten Wergeldkatalog. Darin waren die Bußen aufgeführt, die als Strafe für verschiedene Vergehen an das Opfer oder seine Familie zu zahlen waren. Besonders wichtig sind hier die Bußen – Wergeld, d.h. Manngeld genannt – für Totschlag. Sie betrugen für die Tötung eines freien Mannes 200 Solidi (Schillinge) oder umgerechnet 8000 Denare (Pfennige). Ein Römer war dagegen lediglich 100 Solidi ‚wert‘, und das auch nur, wenn er Land besaß, während der Totschlag an einem zinsabhängigen Römer sogar nur mit 70, teilweise auch nur mit 62, 5 Solidi zu büßen war. Der Totschlag an einem Sklaven (servus) war mit 20 Solidi abzugelten, sofern der Täter seinerseits ein Sklave war. Man kann davon ausgehen, dass in einer Zeit zurückgehender bzw. gar nicht mehr existenter Geldwirtschaft diese Summen nicht bar entrichtet wurden, sondern in materielle Werte umgerechnet wurden. In der Lex Ribuaria, einer Überarbeitung der Lex Salica aus dem 7./8. Jahrhundert, werden etwa folgende Äquivalenzen angegeben: Ein Solidus entsprach einer gesunden Kuh, zwei Solidi entsprachen einem Stier, drei Solidi einer Spatha (Langschwert), sechs Solidi einem abgerichteten Habicht, sieben Solidi einem Hengst und zwölf Solidi einem Harnisch oder einem älteren Jagdfalken. Selbst der Totschlag an einem Sklaven war daher eine teure Angelegenheit, und der gewaltsame Tod eines freien Franken konnte den Täter und darüber hinaus auch seine weitere Familie ruinieren.
Die Lex Salica enthielt aber auch erbrechtliche Regeln, als deren wichtigste wohl die Bestimmung zu gelten hat, dass Töchter vom Erbe der Allode, also der Eigengüter, bzw. der Terra Salica ausgeschlossen sein sollten. Dies erschien der älteren Forschung als eine Übernahme des von Tacitus überlieferten germanischen Erbrechts. Dennoch befand sich Landbesitz vielfach in den Händen von Frauen. Daher ist die moderne Forschung darum bemüht, die erwähnte Bestimmung der Lex Salica anders zu erklären, etwa mit der Annahme, unter Terra Salica sei nicht der gesamte salfränkische Boden zu verstehen, sondern das ererbte Gut im Gegensatz zu erworbenem Landbesitz. Die erbrechtliche Sonderstellung könnte mit der Ansiedlung der Franken in Gallien als Wehrbauern in römischen Diensten zusammenhängen. Die Terra Salica wäre dann ursprünglich Militärgut gewesen, das der Ausrüstung der Soldaten gedient hatte und aus diesem Grunde nicht an Frauen fallen durfte.
Die Sozialverfassung der Franken
Die Lex Salica gilt aber auch als wichtige Quelle für die Sozialverfassung. Gerade die zitierten Wergeldkataloge kennen keinen Adel, weshalb sich die Franken nach den Vorstellungen des 19. Jahrhunderts aus einer homogenen Schicht von Freien, liberi homines oder Franci, zusammensetzten. Diese Freien hatten das Privileg, Waffen zu tragen, und bildeten daher auch das fränkische Heer; außerdem konnten sie sich vor Gericht selbst vertreten; und schließlich hatten sie das Recht, an den Volksversammlungen teilzunehmen. Diese von der älteren Forschung ‚Gemeinfreie‘ genannten Männer machten also nicht nur die große Mehrheit des Volkes aus, sondern auch die politisch entscheidende Schicht. Auf der anderen Seite ist schon in der germanischen Frühzeit ein Adel belegt. Daher ging man davon aus, der alte Adel sei mit dem Erstarken des Königtums unter Chlodwig einfach in seiner Bedeutung zurückgetreten oder sei durch Chlodwig sogar ‚ausgerottet‘ worden; ein neuer Adel habe sich seitdem im Königsdienst als Amts- und Dienstadel entwickelt.
Tatsächlich regierten die fränkischen Könige, auch Chlodwig, nicht allein, sondern im Konsens nicht nur mit dem ‚Volk‘, einer letztlich unbestimmbaren Größe, sondern vor allem auch mit den Großen. Stets beriet sich der König mit ihnen, gleich ob es sich um Gesetze, die Entscheidung über Krieg und Frieden oder die Aburteilung eines Hochverräters handelt. Genaue Untersuchungen haben gezeigt, dass selbst dann nur die Großen gemeint sind, wenn in den Quellen einfach von Franci oder dem populus, dem Volk, die Rede ist. Diese Großen werden von Gregor von Tours als maiores, maiores natu, meliores, optimates, seniores oder auch proceres bezeichnet. Um ihre Bedeutung entbrannte besonders in den 1970er Jahren eine Forschungsdebatte, die sich an zwei Namen festmachen lässt, Franz Irsigler und Heike Grahn-Hoeck. Die Frage lautete, ob es bei den Franken einen Adel gegeben habe oder ob man lediglich von einer Oberschicht innerhalb des homogenen Rechtsstandes der Freien sprechen könne. Bereits durch diese Alternative wird man bei der Suche nach einer Antwort auf Rechtsquellen festgelegt, im Falle der Franken auf die Lex Salica.
Die Lex Salica nun scheint eindeutig zu beweisen, dass es bei den Franken nur einen homogenen Rechtsstand der Freien gegeben hat. Im Gegensatz zu anderen Volksrechten werden in ihr keine nobiles erwähnt. Diese werden etwa in den Volksrechten der Sachsen, Alemannen und Bayern durch ein im Vergleich mit den Freien dreimal höheres Wergeld ausgezeichnet. Aber auch die Lex Salica kannte einen dreifach erhöhten Wergeldsatz: Die Antrustionen, d.h. die königlichen Gefolgsleute, waren durch Wergeld in Höhe von 600 Solidi geschützt. Dreifach erhöht war auch das Wergeld des römischen conviva regis, des königlichen Tischgenossen, das bei 300 Solidi lag. Wenn man so will, hat man hier die Belege für die Dienstadelstheorie: Königsdienst bzw. -nähe adelt. Freilich waren auch Frauen im gebärfähigen Alter mit einem Wergeld in Höhe von 600 Solidi geschützt, genossen also einen im Vergleich zu den anderen Frauen und Männern dreifach erhöhten Schutz, aber als Adlige wird man sie dennoch nicht ansprechen wollen. Dies zeigt, dass die Wergeldordnung den Funktionswert von Personen und Gruppen im Hinblick auf den Fortbestand der Gemeinschaft bewertete. Nur sehr eingeschränkt gibt die Wergeldordnung daher Auskunft über die ständisch-soziale Gliederung. Dagegen belegt Gregor von Tours gewaltige soziale und politische Unterschiede und damit die Existenz eines Adels.
Dazu fügt sich das Zeugnis der archäologischen Quellen, denn sie zeigen eine starke soziale Differenzierung. Viele Gräberfelder sind auf zentrale Gräber hin ausgerichtet, was Rückschlüsse auf die einstige politische Funktion der dort bestatteten Toten zulässt. Die reichen Beigaben zeigen, dass es sich bei diesen Verstorbenen zudem um außerordentlich reiche Personen gehandelt haben muss. Als Beispiel soll das zu Beginn des 20. Jahrhunderts freigelegte Gräberfeld von Lavoye (in Lothringen, Département Meuse) dienen. Es wurde auf einer alten römischen villa rustica angelegt und enthält 362 Gräber, von denen 192 grob in die Zeit zwischen 500 und 650 datiert wurden. Das zentrale Grab ist das älteste, größte und reichste. Es enthält die Überreste eines 50- bis 60-jährigen Mannes mit wertvollen Beigaben: eine goldene, mit Granat-Steinen verzierte Gürtelschnalle, eine Geldbörse mit einer ähnlich geschmückten Spange, einen Dolch mit einem goldenen Griff, ein fast einen Meter langes Schwert, verziert mit Gold, Silber und Granat-Steinen, die Spitzen von drei Wurfspießen, einen Schild, eine gläserne Schale sowie einen mit Bronze überzogenen Krug, der mit Szenen aus dem Leben Jesu verziert war und wohl der christlichen Liturgie gedient hatte – wahrscheinlich also Beutegut aus einer christlichen Kirche. In unmittelbarer Nähe des Anführers wurden drei Frauen ebenfalls mit reichen Beigaben bestattet. Die große Mehrzahl der Gräber, die sich um diesen Verband gruppieren, enthält wahrscheinlich die Überreste von einfachen freien Franken, nicht etwa von Unfreien. Einige dieser Gräber weisen ähnliche Funde auf wie das des Anführers, nur sind sie weniger reich ausgestattet. Diesen Reichtum, das mit ihm verbundene Ansehen und vor allem die politische Bedeutung vererbten diese Anführer sehr wahrscheinlich ihren Söhnen, so dass man dann doch von einer sozialen Schicht sprechen kann, die in allen wesentlichen Aspekten einem Geburtsadel entspricht.