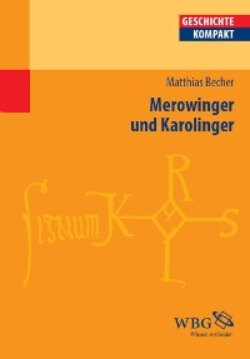Читать книгу Merowinger und Karolinger - Matthias Becher - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Die Söhne Chlodwigs: Reichsteilung und weitere Expansion
ОглавлениеChlodwig hinterließ bei seinem Tod 511 aus zwei Verbindungen die Söhne Theuderich, Chlodomer, Childebert und Chlothar, die sein Reich unter sich aufteilten. Die Brüder hielten sich dabei nicht an die römischen Provinzgrenzen, sondern die civitates bzw. Gaue waren die entscheidenden Einheiten, die in der Regel geschlossen an einen der Brüder fielen. Bei der Teilung bildeten die Francia, das nordgallische fränkische Kernland, und Aquitanien separate Einheiten, an denen jeder König einen Anteil haben sollte, weil Aquitanien vermutlich noch nicht als sicherer Besitz der Franken gelten konnte. Die Francia wurde folgendermaßen geteilt: Theuderich erhielt den Osten nördlich der burgundischen Grenze einschließlich Reims, Châlons, Troyes, Sens und Auxerre. Im Westen schloss sich das Gebiet Chlothars an, der die salfränkischen Kerngebiete zwischen dem Kohlenwald und der Somme sowie Noyon, Soissons und Laon erhielt. Childebert gewann die Küstenländer von der Somme bis zur Bretagne mit den Städten Rouen, Paris und Le Mans. Südlich davon schloss sich Chlodomers Anteil mit Nantes, Tours und Orléans an. Die Hauptstädte der vier Reichsteile lagen in der Francia eng zusammen: Reims (Theuderich), Orléans (Chlodomer), Paris (Childebert) und Soissons (Chlothar). In Aquitanien fielen an Theuderich der Osten mit der Auvergne, aber auch das zentral gelegene Limousin mit der Hauptstadt Limoges, dazu einige südlich angrenzende civitates (Rodez, Albi und Javols). Chlodomer erhielt den Norden Aquitaniens, der direkt an sein fränkisches Gebiet grenzte, mit Poitiers und Bourges. Im Süden Aquitaniens teilten sich Childebert und Chlothar die Herrschaft, mussten also eine deutliche Trennung ihrer fränkischen von ihren aquitanischen Herrschaftsgebieten in Kauf nehmen.
Dafür, dass überhaupt geteilt wurde, hat die ältere Forschung das in der Lex Salica festgeschriebene Prinzip verantwortlich gemacht, dass alle Söhne den Landbesitz des Vaters erben sollten, also doch wohl zu gleichen Teilen. Darauf spielt Gregor von Tours mit seiner Bemerkung, die Teilung sei 511 aequa lantia, eben zu gleichen Teilen, erfolgt, möglicherweise an. Dies ist aber keineswegs sicher. Außerdem ist Gregors Behauptung nicht ganz richtig, weil Theuderichs Anteil erheblich größer war als der seiner Brüder. Die jüngere Forschung geht daher mehrheitlich von einem politischen Kompromiss zwischen der Königin Chrodechilde und ihren teilweise noch sehr jungen Söhnen Chlodomer, Childebert und Chlothar einerseits und ihrem voll handlungsfähigen Stiefsohn Theuderich andererseits aus, der schon Jahre zuvor seinem Vater als Heerführer gedient hatte. Zudem hatte er bereits „einen stattlichen und tüchtigen Sohn mit Namen Theudebert“, wie Gregor eigens vermerkt. Mit diesen Adjektiven war die für den fränkischen Adel wichtigste Eigenschaft eines Königs angesprochen, seine Kriegstüchtigkeit. Theuderich verfügte also bereits über einen würdigen Nachfolger. Er war damit eindeutig der stärkste der vier Brüder und erhielt nicht nur ein Drittel der Francia, des fränkischen Kerngebiets, sondern auch das gefährdetste Gebiet im Osten des Reiches mit langen Außengrenzen, das aber zugleich das größte Expansionspotential bot, während seine Brüder innerhalb Galliens eigentlich nur noch die Burgunder zu Nachbarn hatten.
Die Teilreiche blieben infolge der Erbteilungen und Eroberungen der nächsten Generationen nicht stabil. Bereits 524 fiel Chlodomer in einem Krieg gegen die Burgunder. Die Erziehung seiner drei minderjährigen Söhne übernahm seine Mutter Chrodechilde, während Chlodomers Witwe Guntheuca sogleich von seinem Bruder Chlothar zur Frau genommen wurde, obwohl eine solche Ehe gegen das Kirchenrecht verstieß. Die Witwe eines Königs zu ehelichen, war im Frühmittelalter dennoch ein beliebtes Mittel, um Thronansprüche anzumelden, durchzusetzen oder zu legitimieren. Erst 532 gelang es Chlothar zusammen mit seinem Bruder Childebert, zwei ihrer Neffen zu beseitigen, während der dritte von ‚Mächtigen‘ gerettet wurde, dann aber in den Klerikerstand eintrat und so keine Gefahr mehr für die Herrschaftsübernahme seiner Onkel darstellte. Diese teilten Chlodomers Erbe unter sich auf, mussten dabei allerdings auch Theuderich berücksichtigen, wohl um ihn ruhigzustellen. Damit ergab sich eine Dreiteilung des Gesamtreiches, die im folgenden Jahr fast durch eine Zweiteilung ersetzt worden wäre. Denn 533 starb Theuderich von Reims, aber sein Sohn Theudebert konnte sich mit Hilfe der Großen seines Teilreichs gegen Childebert und Chlothar behaupten. Er konnte sich im Gegensatz zu seinen jungen Vettern durchsetzen, weil er damals bereits lange erwachsen war und sich schon als Feldherr seines Vaters bewährt hatte.
Die Art und Weise, in der Childebert und Chlothar die Nachfolge ihrer verstorbenen Brüder angetreten haben bzw. antreten wollten, zeigt die Probleme auf, die das fränkische Thronfolgeprinzip, möglichst viele männliche Angehörige der regierenden Dynastie mit einem Reichsteil auszustatten, mit sich brachte. Ein großer Teil der Forschung ist der Ansicht, dass das Erbrecht der Brüder das bessere gewesen sei, dass ihr sogenanntes Anwach sungsrecht dem Eintrittsrecht der Söhne vorgegangen sei. Dabei habe es sich um einen alten germanischen Rechtsgrundsatz gehandelt, der sich auf das private Vermögen einer Familie bezog: Beim Tod des Familienoberhaupts erbten zunächst seine Söhne als Mitglieder seiner Hausgemeinschaft, während die Enkel eben nicht zu dieser Hausgemeinschaft gehörten und daher auch nicht erbberechtigt waren. Falls also ein Sohn vor dem Vater verstarb und seinerseits bereits Söhne hatte, dann gingen diese anders als im römischen Recht leer aus. Diese Konstellation passt aber weder auf die Nachfolge Chlodomers noch auf die Theuderichs: Der Großvater, also Chlodwig, war gestorben, seine Söhne hatten das Erbe längst geteilt und regierten als gleichberechtigte Könige ihre Reichsteile. Anwachsungs- und Eintrittsrecht griffen in dieser Situation nicht. Vielmehr waren die Söhne des Verstorbenen voll erbberechtigt, und die Brüder kamen erst nach ihnen an die Reihe. Aus diesem Grund mussten Childebert und Chlothar die Söhne ihres Bruders töten, denn erst der Tod der Neffen machte sie zu Chlodomers Erben. Dabei war das Erbrecht allerdings nur ein vorgeschobener Grund, denn es handelte sich schlicht um eine machtpolitische Auseinandersetzung, bei der die Brüder eines verstorbenen Königs stets im Vorteil waren, weil sie als Könige die entsprechenden Machtmittel an der Hand hatten, während der oder die Söhne des verstorbenen Königs sich erst etablieren mussten. Das war schier aussichtslos, wenn sie noch minderjährig und entsprechend handlungsunfähig waren. Nur die Unterstützung einflussreicher Adelskreise konnte ihnen dann die Thronfolge sichern, was diesen Adligen wiederum ein Entscheidungs- oder Wahlrecht sicherte. Meist lag es im Interesse des Adels und besonders der Vertrauten eines verstorbenen Königs, dessen Reich fortbestehen zu lassen, da sie hier ihrerseits Macht und Einfluss am besten wahren konnten.
Weitere Expansion
Um 530 veränderte sich die außenpolitische Situation in Europa grundlegend. Mit dem Tod Theoderichs des Großen 526 brach sein gegen Ostrom und die Franken gerichtetes Bündnissystem endgültig in sich zusammen, und die Macht des Ostgotenreiches begann zu verfallen. Dies nutzten die merowingischen Brüder, um die Expansionspolitik ihres Vaters wieder aufzunehmen. Zwischen 529 und 534 wurde das rechtsrheinische Thüringerreich unterworfen, das an Theudebert, den König von Reims, fiel. 532 eroberten die Franken das Burgunderreich, das 534 zwischen ihren Königen aufgeteilt wurde. 537 besetzten sie die Provence, die ihnen der von Byzanz bedrohte Ostgotenkönig Witigis gegen fränkische Waffenhilfe abgetreten hatte. Die Franken erreichten also östlich der Rhône das Mittelmeer, den zentralen Wirtschaftsraum der damaligen Zeit. Damit war eine Expansionsrichtung vorgegeben, die insbesondere Theudebert von Reims weiterverfolgte. Er intervenierte seit 539 mehrfach in Italien, mischte sich dabei aber nicht in den Krieg zwischen Goten und Oströmern ein, jedenfalls nicht als fester Bündnispartner einer der Kriegsparteien, sondern nahm den Goten große Teile des heutigen Venetiens ab. Diese Intervention im Osten Italiens ergab sich aus seiner bisherigen Politik: Er hatte sein Reich im nördlichen Alpenvorland nach Osten hin erweitert und die fränkische Herrschaft bis nach Pannonien ausgedehnt.
Die Erfolge veranlassten Theudebert, prononciert kaiserliche Formen der Herrschaftsausübung zu imitieren, indem er in Arles, der letzten kaiserlichen Hauptstadt Galliens, Zirkusspiele abhielt und Goldmünzen schlagen ließ. Stolz beschrieb er in einem Schreiben an Kaiser Justinian von ca. 545 seinen Herrschaftsbereich, nach dem dieser sich erkundigt hatte: