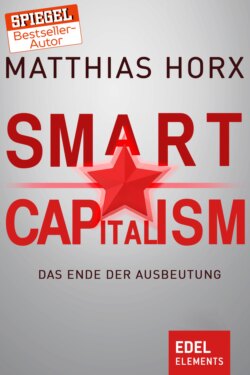Читать книгу Smart Capitalism - Matthias Horx - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE HÖLZERNEN MÄRKTE DER INDUSTRIEGESELLSCHAFT
ОглавлениеIn der industriellen Produktionsweise wird ein Gegenstand, ein Produkt, in hoher Stückzahl in einem langen, arbeitsteiligen Prozess unter ständigem Zusatz von Kapital, Material und Logistik hergestellt. Für die meisten Industrieprodukte hat sich dabei eine mehrgliedrige lineare Kette aus verschiedenen Schritten herausgebildet, die von der Bedarfsermittlung über den Einkauf von Teilen, das Erstellen der Logistik bis zur Lagerung und zur Auslieferung reicht (siehe Abb. 1).
Abb. 1: Die industrielle Wertschöpfungskette
Der Unterschied zu einem wirklichen, einem lebendigen Markt, fällt sofort ins Auge: Bei den meisten Produkten dauert es Jahre, bis sie ihren Weg in den Markt finden. Der ganze Prozess ähnelt einem Schießen ins Dunkle: Die Kalkulation, die den Preis erzwingt, ist »steif«, d.h. sie muss ohne flexibles Wissen darüber erfolgen, was der Kunde bereit wäre zu bezahlen. In einigen Jahren, wenn das Produkt auf den Markt gerät, kann sich die Bedürfnislage längst geändert haben. Der Preis entsteht nicht aus den Bedürfnissen des Kunden, sondern aus der Angebotslogik der Produktion, des Kapitaleinsatzes heraus.
Diese steifen ökonomischen Ketten machen Produkte trotz aller Rationalisierung und Produktivität industrieller Systeme teuer. Sie erfordern Heerscharen von Mediatoren zwischen Märkten und Menschen: Psychologen, Marktforscher, Meinungsexperten, Berater. In jeder Einkaufspassage lungern die Befrager der Konsuminstitute, in unzähligen Haushalten stehen komplizierte Apparate, die Werbezeiten und Einschaltquoten messen, Konsumenten werden auf die Couch gelegt und durch die Mühlen der Tiefenpsychologie gedreht, um ihnen ihre intimsten Wünsche zu entlocken. Und dennoch: 80 Prozent aller Marktneueinführungen sind heute millionenteure Flops.
Die industrielle Produktion hat ein Babylon des Angebots und der Nachfrage erzeugt, in der Sprachlosigkeit und Überdruss herrschen. Die meisten Innovationserfolge der vergangenen Jahrzehnte, vom Van bis zum Handy, wurden in Markttests von den Konsumenten vorher abgelehnt. Umgekehrt wurden eine Unmenge guter Ideen gar nicht erst produziert, weil sie nicht in die Produktionsraster der Industrie passten. Industrieller Markt ist eine Wüste von Verschwendung, in der der Wind immer aus der Luvseite des Angebots weht. Schon die Sprache verrät dies. Am Ende der Kette steht der »Verbraucher«, der brave Vertilger des Endprodukts, der brave Verwerter am Ende der Wertschöpfungskette. Ver-brauch-er! – man lasse das Wort für sich sprechen!
Die Sprache des Marketings ist verräterisch. Sie erzählt die Geschichte von einer Markt-Wirtschaft, in der der Mensch an den langen Drähten der industriellen Produktion zappelt. Er ist Objekt, nicht Subjekt des Marktes. Er ist »Zielgruppe«, »Cluster«, »Target«; gewaltige Geldsummen werden ausgegeben, um das »Target« aufzuspüren und zu »penetrieren«. Und der Staat mit seinem Hunger nach Marktregulierung verstärkt diesen Effekt der Entfremdung zwischen Mensch und Markt. Die Obstberge und Milchseen der EU, der Rinderwahnsinn der Fleischerzeugung, die sinkende Qualität der Lebensmittel – auf einem echten Markt würde man den Händlern solche Ware um die Ohren hauen! Auf jedem echten Markt würden überschüssige Güter schnell billig werden und sich die Produktion über Nacht den Wünschen der Käufer anpassen. Industriekapitalismus in unseren Breiten hingegen beschäftigt eine riesige Anzahl von Menschen mit der Erzeugung, Verwaltung, Regulierung und Dauererhaltung von nicht-marktfähigen Produktionssystemen: Stahlarbeiter sollen Stahlarbeiter, Bauern wie gehabt Bauern bleiben. Kein Wunder, dass der heilige Zorn des Konsumenten immer größer und größer wird – und sein Misstrauen sich in Boykotten, Kaufunlust und gnadenlosem smart shopping Luft verschafft (und bisweilen in antikapitalistischen Ausfällen).