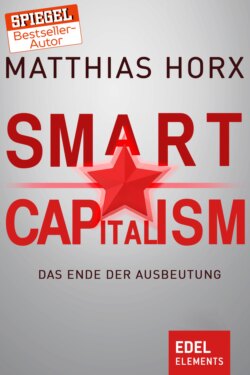Читать книгу Smart Capitalism - Matthias Horx - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
TRANSPARENTE MÄRKTE
ОглавлениеMitte der achtziger Jahre, zu Beginn des ersten Börsenbooms, schossen in den Großstädten Cafés und Kneipen mit Namen wie »Cash Flow« oder »Zitterkurs« aus dem Boden. Auf Monitoren über der Theke wurden die Getränkekurse notiert, und man bezahlte soviel fürs Bier, wie die Gäste Nachfrage erzeugten. Je mehr Nachfrage nach einem bestimmten Getränk, desto höher der Preis. Die Folge waren grässliche Kopfschmerzen, denn die Kunden einigten sich schnell darauf, keine allzu große Nachfrage nach einem bestimmten Getränk zu erzeugen. Und tranken alles durcheinander.
Was als Beitrag zur Spaßkultur begann, war in Wirklichkeit ein Hinweis auf die Zukunft. Das Internet macht die Preise – alle Preise – verhandelbar und disponibel. Die klassische Marktsituation im Internet ist eben nicht die Ja-Nein-Situation des klassischen Klick (»In den Einkaufskorb«), sondern die Versteigerung. Ich biete den Preis, der »Kunde« = Hersteller reagiert. Oder das Flohmarkt-Prinzip: Ich biete einen Gegenstand, eine Innovation, und teste, ob eine Nachfrage dafür existiert.
Natürlich werden wir in Zukunft nicht jeden Gegenstand des täglichen Bedarfs ersteigern wollen. Aber die Kunden-Kompetenz wächst – der smart shopper ergreift die Macht auf den Konsummärkten. Jeder, der einmal mit einer virtuellen Preisagentur gearbeitet hat, weiß, dass man mit wenigen Kommandos über den ganzen Kontinent den billigsten Anbieterpreis für eine Segeljacht, einen Videorecorder oder ein Auto abfragen kann. Selbst wenn man sich dann nicht für das billigste Angebot entscheidet (zum Beispiel aus Servicegründen) – man kennt es. Und kann mit diesem Wissen den nächsten stationären Händler am Ort unter Druck setzen!
Durch das Instrument Internet wird der Preis in lauter kleine Scheiben geschnitten und damit für den Kunden decodiert. Wird demzufolge der »empowerte« Konsument des Internetzeitalters immer nur den billigsten Preis zahlen wollen und dadurch ganze Branchen in den Ruin treiben? Das ist eher unwahrscheinlich. Zur Eigenschaft dynamischer Märkte gehört auch, dass sich Erfahrungen schnell herumsprechen. Ein Auto ohne Service, ein Computer ohne Systemhilfe ist wenig wert (das ist einer der Gründe, warum der PC-Markt in die Krise geriet: Computer sind nicht wirklich billig, sie erfordern enorme Investitionen in technische Assistenz oder eine gigantische Zeit-Lern-Investition des Users). Was sich durchsetzen wird, ist vielmehr Preistransparenz: Wir Kunden verstehen ein Produkt mehr in seinen gesamten Nutzungskomponenten, und was wir verlangen sind unverschleierte Preise: Welcher Anteil vom Preis bezieht sich auf Marketing, Produktion, Handel, Servicequalität? Ist der angeblich so kundenfreundliche Großhändler, bei dem man weder etwas zurückgeben noch ein Produkt fachgerecht reparieren lassen kann, nicht nur ein Trugbild?
Menschen lernen schnell, wenn man sie lernen lässt. Sie lernen auch, dass es sinnvoll sein kann, mehr für Service und Komfort zu bezahlen! Transparente Märkte fördern deshalb mittelfristig auch Dienstleistungen. Und sie sind immer auch mit Meinungen und Erfahrungen verknüpft. Auf dem alten Marktplatz gab es nicht nur das Display der Waren und den Preisvergleich, sondern auch die Vielzahl der Meinungen, die im Marktgeschnatter verfügbar waren. In der Welt der »Dynamiconomy« ersetzen Test-Sites wie Dooyoo diese Meinungs- und Informationsmärkte.
Für viele industrielle Anbieter bleibt diese neue Transparenz jedoch ein wahrhafter Alptraum. Low-Interest-Produkte, Warengruppen mit wenig Stil und Phantasie, Gegenstände des so genannten täglichen Bedarfs, eingeschliffene, bleierne Märkte ohne Glanz: Hier geht es immer nur um den Preis, und das bis auf die Knochen! Denn einen großen Teil unseres spätindustriellen Wohlstands verdanken wir eben nicht effektiven, kundenfreundlichen, smarten Produkten und Dienstleistungen, sondern den diversen Techniken der Marktintransparenz. In unseren heutigen Wertschöpfungsketten haben sich jede Menge toter Ecken eingenistet, Weidegründe für Schmarotzer, Pfründe für Leistungen, die keine Leistungen sind. Der Kunde gewinnt an Macht, indem er das geschickt getürmte Gebäude aus Zuschlägen, Handelsspannen und Werbekosten durchschaut und gegebenenfalls torpediert. Alles, was ihm keinen realen Nutzen bietet, fällt aus der Wertschöpfungskette heraus. Auch wenn der Produzent noch so sehr zu seinem Händler hält – im virtuellen Raum steht stets die Drohung, die gesamten Kosten des Handels zu sparen und dort zu kaufen, wo die Ware die Produktionsstätte verlässt. Der Internetbuchhändler Amazon nutzt die neue Situation zunächst für sich, indem er den Kunden zum Zwischenhändler macht und ihm für Käufervermittlung über dessen Homepage zehn Prozent Provision zahlt. Die Folge der Transparenz ist eine völlige »Nacktheit« des Käufer-Produzenten-Verhältnisses. Handel wird zertrümmert und in reale Dienstleistungen aufgelöst.
Als im Winter 2001 mehrere US-Fluglinien Meilengutschriften an ihre Kunden schickten, um sich für Verspätungen zu entschuldigen, dabei aber Kunden in New York aussparten, stürmten Zehntausende wütende Kunden per E-Mail die Beschwerdebriefkästen und drohten mit Flugstreik. Der Kunde, der immer der Depp war, zieht dem Verkäufer die Hosen herunter. Er diktiert die Bedingungen. Zehn Sesterzen? Wenn deine Fische drei Sesterzen kosten, schicke mir eine E-Mail!