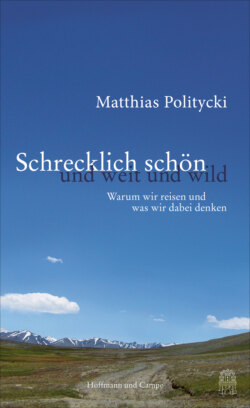Читать книгу Schrecklich schön und weit und wild - Matthias Politycki - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Haltung wahren
Оглавление»Ich will lässig aussehen, weder wie ein abgerissener Backpacker noch wie ein Reisesnob in edler Funktionskleidung. Vor allem nicht wie ein Tourist! Ich besitze keine Sandalen.« Das gibt Konsul Walder auf die Frage, wie er sich auf Reisen kleidet, zu Protokoll, und er wird noch deutlicher: »Backpacker passen sich meist krampfhaft an, bei ihnen ist anscheinend nicht nur die Pumphose, sondern auch der Verstand gebatikt. Beim Versuch, während einer Reise wie ein Einheimischer auszusehen, kann man ganz schnell seine Würde verlieren.«
Ob in Dschallabija oder anderen arabischen Spielarten der römischen Tunika, ob als Indienfreak mit allerlei Schmuck und Tüchern oder mit Rastazöpfchen auf Jamaika, man läuft schnell als Karikatur der Einheimischen herum. »Als ob man dann weniger Tourist wäre«, schüttelt Dr. Black den Kopf.
Hinter dem Versuch, sich Land und Leuten anzupassen, steht der Wunsch, sich für die Dauer der Reise in einen anderen zu verwandeln. Die plattere Variante besteht darin, bereits beim Hinflug als Freizeitclown mit Sonnenhütchen einzuchecken. Männer in Bermudashorts und Trekkingsandale, dem mißratnen Halbbruder der Adilette. Frauen in fröhlich gemusterten Pluderhosen und Flipflops. Es soll vom Start weg Ungezwungenheit demonstrieren – Konditionierung durch Kleidungswechsel auch hier.
Eine dritte Spezies an Reisenden setzt aus praktischen Erwägungen auf Nachlässigkeit. Mit Bedacht wählt sie diejenigen Teile aus ihrem Schrank, die eigentlich längst in die Altkleidersammlung gehören und vor dem Heimflug an Einheimische verschenkt werden. Dr. Black: »Allerdings ist es mir auch schon vorgekommen, daß die ›Bedürftigen‹ meine ausgefransten Klamotten nur zögernd annahmen, weil ich sie schon so abgetragen hatte, daß ihre eigene Kleidung besser war als meine.« Für Indra ist es völlig unverständlich, »daß man sich auf Reisen achtlos kleidet. Warum ist das so? Weil man niemanden kennt und es einem deshalb egal ist? Will man denn niemanden kennenlernen? Kommt denn keiner auf die Idee, daß man die Einheimischen dadurch beleidigt?«18
Drei Arten, sich urlaubsfein zu machen, drei Haltungen, die dahinterstehen: Anpassung bis hin zur Verkleidung als Einheimischer; Verharmlosung bis hin zur Kindlichkeit; optisches Downgrading als Anpassung weniger an die Bevölkerung als an deren härtere Lebensumstände.
Gut, seitdem Outdoor-Kleidung von der Modebranche entdeckt wurde, treten sogar Pauschalurlauber gern mal als (schicke) Abenteurer auf. Und natürlich gibt es auch immer wieder spektakuläre Einzelfälle: Ich erinnere mich an die indonesische Insel Batam, direkt vor Singapur gelegen, erinnere mich an eine Touristin, die dort in Sommerkleid und schwarzen Lackpumps durch den Regenwald – nein, nicht etwa ging, sondern schritt. Eine solche Szene kann man sich nicht ausdenken, dazu wäre sie viel zu unglaubwürdig, vergessen kann man sie erst recht nicht.
Aber um Ausnahmen soll es hier nicht gehen – und auch nicht um passende oder weniger passende Urlaubskleidung. Sondern um die Haltung, die wir in einem fremden Land einnehmen. Durch unsre Kleidung bringen wir sie bereits bis zu einem gewissen Punkt zum Ausdruck. Die Sehnsucht des Urlaubsdeutschen zielt nicht nur auf das Erlebnis des Exotischen, sie zielt auch darauf, im Ausland möglichst positiv wahrgenommen zu werden. Inbesondere ältere Jahrgänge, die noch mit einem historischen Bewußtsein aufgewachsen sind, möchten zeigen, daß die Deutschen »längst nicht mehr so sind«, wie sie sich während der NS-Zeit ins welthistorische Gedächtnis eingraviert haben. Im Grunde ist das ein ehrenwertes Anliegen, und über die Jahrzehnte haben deutsche Touristen tatsächlich zu einem anderen Bild Deutschlands in der Welt beigetragen. Geliebt werden und geachtet werden ist allerdings zweierlei.
Weil die Deutschen geliebt werden wollen, machen sie mitunter nicht nur in ihrer Urlaubskleidung, sondern auch in übertragener Hinsicht eine schlechte Figur. Anders als Engländer, die auf Reisen gern in postkolonialer Attitüde auf die Einheimischen herabblicken und sich über alles lustig machen, wollen die Deutschen unbedingt wieder zur Weltgemeinschaft dazugehören und blicken sicherheitshalber zu allen anderen auf. Sie versuchen zu verstehen. Wenn sie nichts verstehen, lächeln sie verständnisvoll und halten sich diskret beiseite. Böse faßt der K zusammen: »Im Ausland sind sie Chamäleon, zu Hause quatschen sie sich das Barbarische schön.«
Wie eifrig wir bemüht sind, den Einheimischen Komplimente über ihr Land zu machen (»Oh, very much, great«)! Doch weder die englische Selbstüberhöhung noch die deutsche Unterwürfigkeit ist angemessen, wenn man ein Reiseland jenseits der Sehenswürdigkeiten begreifen möchte. Wie würden wir denn einen Touristen in unsrer Heimatstadt empfinden, der uns erzählen möchte, daß er an Deutschland alles super findet und nur super? Wir würden glauben, er wolle sich über uns lustig machen.
Auf die Frage, wie ich ihr Land finde, antworte ich mittlerweile lieber: Ich wisse es noch nicht. Wie es der Fragende denn selber finde? Die Antworten führen oft auf überraschend direktem Weg hinter die Kulissen des Reiselands. In Westbengalen habe ich auf diese Weise erfahren, daß alle Angst hatten vor der Unzahl an illegalen Einwanderern aus Bangladesch:19 Moslems würden sich nicht integrieren, sie blieben nur unter sich, man wisse überhaupt nicht, was sie dächten und in Zukunft vielleicht tun würden. Jeder meiner Gesprächspartner fand, daß Indien ein wundervolles Land sei (»Oh, very much, great«), doch mehr für die Sicherheit seiner Außengrenzen tun müsse. So weit weg von Europa, wie ich dachte, war ich hier gar nicht.
Haltung bewahren beginnt im Alltag: Sofern man nur darauf bedacht ist, nicht aufzufallen, wird man in vielen Ländern einfach beiseitegedrängt. Sofern man aber die Signale der lokalen Körpersprache lernt, sofern man die Stimme zu erheben lernt und die Ellbogen auch mal auszufahren, wird man selbst in zentralafrikanischen Ländern Achtung erringen und seinen Platz behaupten. Opportunismus bedeutet dort das Gegenteil von Duckmäusertum.
Im Grunde fängt es bereits beim Feilschen an. Gerade Intellektuelle drücken sich gern davor, indem sie sich einreden, die einheimische Bevölkerung hätte »eh fast nichts zu beißen«, man solle ruhig etwas großzügiger sein. Daß sie für ebendiese Haltung von den Einheimischen verachtet werden, wollen sie nicht wahrhaben. So verderben sie nicht nur die Preise, sondern auch das Image der Länder, aus denen sie kommen. Natürlich lohnt es aus unserer Perspektive nicht, vor einer Taxifahrt um hundert Rupien zu streiten. Aber aus Sicht des indischen Taxifahrers lohnt es sehr wohl! Indem wir die Spielregeln nicht einhalten, beleidigen wir ihn; anstatt seine Arbeit adäquat zu entlohnen, rücken wir ihn durch unsre Großzügigkeit in die Nähe von Schnorrern und Bettlern. Feilschen wir hingegen hart mit ihm, erfährt seine Arbeit die ihr angemessene Achtung. Geht es um mehr als eine Taxifahrt, wird die Einigung nicht selten durch einen kräftigen Händedruck besiegelt.
Auch wenn wir es übertrieben finden, unzeitgemäß oder unangemessen: Beim Feilschen wie bei jeder anderen Handlung – also nicht etwa nur dann, wenn wir selbst es beabsichtigen – werden wir überall auf der Welt als Vertreter unsres Landes gesehen. Und in zweiter Linie als Repräsentant Europas beziehungsweise der westlichen Welt. (Oft habe ich auf die Frage, woher ich komme, aus vollem Herzen »Europa« geantwortet. Das hat allerdings keiner gelten lassen, jeder wollte wissen, woher ich »wirklich« komme.) Dies gilt in besonderem Maß für die weltanschaulichen Debatten, die wir im Ausland immer mal wieder führen müssen: Mitreisende in öffentlichen Verkehrsmitteln wollen partout für 100 bis 200 Kamele unsre Freundin kaufen oder bedrängen sie dreist, wenn wir kurz auf der Toilette sind. Statt sich dafür zu entschuldigen, verwickeln sie uns in eine Auseinandersetzung über männliches und weibliches Rollenverständnis. Sie eröffnen uns ihre Verehrung Hitlers, ihre Verachtung der westlichen Dekadenz – bei den jamaikanischen Rastas heißt der Westen bezeichnenderweise »Babylon« – oder ihren Glauben daran, daß Gott groß sei.
In Tadschikistan wird man öfter, als einem lieb sein kann, zur Verbrüderung genötigt, weil man als Deutscher ebenfalls »Arier« sei. Die Tadschiken gehören zur indogermanischen Völkerfamilie und legen großen Wert darauf, sich von den Usbeken und allen anderen Turkstämmen (die gleichfalls in Tadschikistan leben) abzugrenzen. Gern zeigen sie auf ihre runden Augen – und auf die eher geschlitzten des nächstbesten Usbeken. Auch wenn es als Scherz verpackt ist, ist es dennoch ernst gemeint.
Weichen wir aus Höflichkeit aus, erweisen wir uns als genau die Schlappschwänze, die sie in uns vermuten. Sie – das sind natürlich nicht die Intellektuellen eines Landes, denn die werden wir auf einer Reise kaum treffen. Es sind Taxifahrer, Wirte, Zufallsbekanntschaften auf der Straße, meist einfache und nicht selten sehr einfache Menschen. Ihre Wahrheiten sind hart und direkt, sie decken sich nicht im geringsten mit den interkulturell korrekt verschlüsselten Verlautbarungen von Delegationen und Konferenzen.
Insbesondere Gespräche über Glaubensfragen können schnell heikel werden.20 Aber auch jedes andre Thema. Wolle hat in gewisser Weise resigniert: »In manchen arabischen Ländern darfst du als fremder Mann ja nicht mal einer Marktfrau das Geld für ihre Ware geben, weil du dann ihre Hand berühren würdest. Wie sollte man da über Frauenrechte und Demokratie diskutieren?« Man muß es meiner Meinung nach gerade deshalb. Die Verachtung des Westens in weiten Teilen der Welt fußt keinesfalls nur auf Propaganda durch staatlich kontrollierte Medien. Wir selbst sind es, die aufgrund unsres Verhaltens die Verachtung immer wieder hervorrufen oder bestätigen, weil wir im entscheidenden Moment kein Rückgrat zeigen und nicht für unsre Sache eintreten, die Weltanschauung einer freien Welt.
Nein, die Beschwörung wechselweiser Toleranz hilft uns in den meisten Ländern nicht weiter. Toleranz ist ein zentraler Wert der Aufklärung und das Einklagen derselben eurozentristischer Natur, schon indem wir an ihn appellieren, zeigen wir, daß wir die Werte unsrer Gastgeber geringer schätzen: Glauben, Gemeinschaft, Familie, Sicherheit. Wenn überhaupt, dann müssen wir uns schon dazu aufraffen, Toleranz als unseren Wert zu reklamieren und ihn dann auch auf intolerante Weise zu verfechten. Notfalls muß man unversöhnt auseinandergehen, man kann nicht jedermanns Freund sein, auch nicht als Deutscher im Ausland.
2010 wurde es im Samarkander Nachtclub Randevu richtig brenzlig für mich. Ich weigerte mich, mit einem Usbeken darauf zu trinken, daß alle Deutschen Verbrecher seien, wie er es von seinen Großeltern gelernt hatte. Als er mich nötigen wollte, den spendierten Wodka zu kippen, kippte ich ihn – in einen großen Blumenkübel. Bevor er auf mich losgehen konnte, stürzten sich seine Freunde auf ihn. Wir einigten uns darauf, daß Deutsche mitunter Verbrecher seien wie Usbeken auch, in der Regel jedoch nicht.
Auch 2011 geriet ich in einen heftigen Disput, diesmal in Milga alias St. Katharin Village auf dem Sinai. Ich hatte mich in der kleinen Moschee eingefunden, als der Imam gerade zum Gebet aufrief. Sowie sich die Gläubigen wieder zerstreuten, lud er mich auf eine Tasse Tee ein, vier seiner Jünger schnitten uns dazu eine Melone auf. Natürlich wollte der Imam mit mir über Gott diskutieren und ging auch gleich in die Vollen: Gott zeuge nicht! Per Handy-App zeigte er mir die entsprechende Sure samt Exegese auf Deutsch, dazu ein selbstbewußtes Grinsen.
Menschen mit festem Glauben sind zwar in ihrem Entscheidungsrahmen eingeengt, innerhalb dessen aber meist zufriedener, fröhlicher und – unbelehrbarer als Freigeister wider Willen aus der entgötterten Welt des Westens. Wie dogmatisch auch dieser Imam war! Gott zeuge nicht, also sei Jesus nur ein Jünger, sprich Mensch, kein Gott, das Christentum damit Götzendienst. Nun habe ich meinen Glauben zwar seit der Konfirmation verloren, in solchen Fällen fühle ich mich jedoch auf der Stelle wieder als überzeugter Christ. Ich fing bei Zeus an, der sehr wohl gezeugt habe, und hörte so schnell nicht wieder auf. Das nötigte dem Imam zwar am Ende keinen Respekt ab, wohl aber seinen Jüngern. Einer von ihnen bat mich, trotz aller Einwände irgendwann einmal den Koran zu lesen. Ich versprach es – unter der Bedingung, daß er seinerseits die Bibel lesen werde. Auch er versprach es. Bevor wir auseinandergingen, gaben wir einander die Hand, der Imam stand etwas abseits und lächelte.