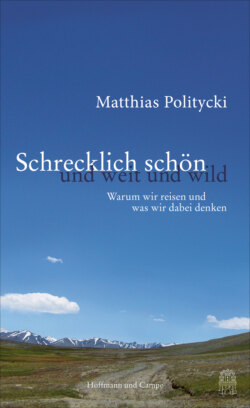Читать книгу Schrecklich schön und weit und wild - Matthias Politycki - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nach Tourplan reisen
ОглавлениеJede Reise ist eine Prüfung, die man am Ende gut bestanden haben will. Doch »gut« ist nicht gleich »gut«. Es hängt vom Schwierigkeitsgrad des Reiselandes ab, vom Tourplan, den man sich für die Reise gemacht hat, und dem Schwierigkeitsgrad der Stationen, die darin vorgesehen sind. Ein Tourplan ist nichts weiter als die Darstellung unsrer Sehnsüchte und Hoffnungen in Form eines Kalenders.
Der begrenzte Zeitraum, die Zahl der Stationen, die wir erreichen möchten, Hindernisse, mit denen wir nicht gerechnet haben, plötzliche Verlockungen, die uns von der geplanten Route abbringen, all das erzeugt latenten Leistungsdruck. Tagtäglich müssen wir uns entscheiden, für oder gegen einen spontanen Abstecher, für oder gegen Einheimische, die einen besseren Weg zu wissen glauben, und jede dieser Entscheidungen kann uns das ganz große Glückserlebnis bescheren oder die ganz große Katastrophe. Je ehrgeiziger die Reise geplant war und je knapper wir die Vorgaben an den entscheidenden Punkten erfüllt haben, als desto »besser« werden wir sie im Rückblick empfinden.
Natürlich unternimmt man eine Reise nicht zuletzt, weil man dabei sein Vergnügen haben will. Es tatsächlich vor Ort zu finden ist oft harte Arbeit, Glückssache oder unmöglich. Selbst dezidierte Vergnügungsreisen garantieren kein durchgehend reines Vergnügen: Während einer Kreuzfahrt kann man bei ziemlich vielen festlichen Gelegenheiten eine ziemlich schlechte Figur abgeben. Bei Städtereisen schafft man’s meist nicht mal, die Sehenswürdigkeiten abzuhaken, die der Reiseführer als »Top-Tip« listet, trotzdem will man nebenbei auch noch irgendeinen Restaurant-Geheimtip finden, der nicht im Reiseführer steht. Nicht umsonst fliegen auf Reisen gern auch mal die Fetzen, und nicht nur unter Ehepaaren.
Dabei wird gerade von Vielreisenden in verdächtiger Einstimmigkeit zu Protokoll gegeben, daß sie sich auf ihre Reisen kaum vorbereiten, daß sie es vor Ort locker angehen und das meiste dem Zufall überlassen: »Je weniger Reiseführer, desto besser. Selbst TripAdvisor schränkt ein« (Konsul Walder). Der Topos »Sich einfach treiben lassen« suggeriert wunderbar entspannte Reiseerfahrungen und nebenbei grandiose Überraschungen. Einmal habe ich es selber auf diese Weise versucht.
Im Sommer 1979 unternahm ich mit meiner Freundin eine spontane Radrundfahrt durch Süddeutschland. Einen Abend lang hatten wir uns über eine Straßenkarte gebeugt und die Route grob festgelegt: von München über Regensburg und Nürnberg nach Würzburg, dann im Rheintal bis Freiburg und von dort zurück nach München. Nebenbei hatten wir Burgen, Schlösser, Kirchen auf der Karte entdeckt, die wir uns ansehen würden – oder auch nicht. »Bloß kein Streß«, das war die Devise.
Unsre erste Etappe führte bis Landshut, lediglich 70 Kilometer, doch danach hatte ich solche Knieschmerzen, daß ich abends kaum mehr aus dem Zelt kam. Bislang waren wir nur von unsrer Wohnung bis zur Uni und zurück geradelt, ein bißchen Training vorab hätte uns gutgetan. Und nach Landshut ging es mit den Bergen erst richtig los! Vielleicht hätten wir unsre Fahrt doch besser anhand einer topographischen Karte geplant. Als erstes strichen wir die Sehenswürdigkeiten, die auf Anhöhen neben unsrer Route lagen. Bald strichen wir die Route selbst zusammen. Schließlich fuhren wir unsre Tagesziele auf möglichst direktem Weg an, ohne Energie an irgend abseitig Gelegenes zu verschwenden. Wir sahen nur noch Teer. Und hatten jeden Tag Streß. Nachdem es im Rheintal endlich einmal wie geplant lief, kam auf der Tagesetappe von Freiburg nach Donaueschingen der Schwarzwald. Ich fuhr damals ein Stadtrad von der Stange mit Torpedo-3-Gang-Nabenschaltung, aufgemotzt mit Easy-Rider-Lenker und Dreiklanghupe. Nicht gerade das, was sich für eine Tour durch deutsche Mittelgebirge aufdrängt. Meine Ehre bestand darin, nicht zu schieben, selbst jetzt nicht. Die Beifahrer in den vorbeipreschenden Autos kurbelten die Scheibe runter und verhöhnten uns. Das war die erste und letzte Radtour, die wir unternahmen.
Dabei war die Idee ja nicht schlecht gewesen. Nur wie wir sie umgesetzt hatten, war weniger lässig als überheblich. Aufgewachsen in München, hatten wir geglaubt, genug von Süddeutschland zu wissen, um mit einer bloßen Straßenkarte durchzukommen. Und mußten am Ende feststellen, daß wir diese Reise gar nicht unternommen hatten, sondern von ihr unternommen worden waren.28 »Unwissenheit ist ein schlechter Reiseführer«, schreibt Kipling.29 Wer einfach so drauflosreist wie wir, will spontan und cool sein, de facto ist er ein Dilettant. Ein Dilettant des Abenteuers; professionelle Abenteurer erkennt man an ihrer Vorbereitung.
Es ist immer wieder befriedigend, sich Ziele zu setzen, verschiedene Wege zum Ziel zu bedenken und das Ziel dann auch, sei’s auf Umwegen, zu erreichen. Ließe man sich in der Fremde nur treiben, man triebe an vielem Interessanten vorbei. Eine interessante Reise ist zwar noch lang keine gute, aber eben auch keine ganz mißlungene mehr. Hakt man die Stationen eines Tourplans der Reihe nach ab, reist man zumindest auf dem Weg zur Zufriedenheit. Das Glück kommt urplötzlich dazu, das Unglück auch.
Es ist wie beim Romanschreiben: Die Gliederung sorgt dafür, daß ich auch an mittelmäßig kreativen Tagen vorankomme. Vor allem liegt sie für den Moment bereit, da das Unerwartete eintritt – wenn die Phantasie in eine Richtung davonschießt, die ich im wahrsten Sinn des Wortes nicht auf dem Zettel hatte. Falls die Euphorie den Plot dann auf andere Weise voranbringt als geplant: gut. Falls nicht, finde ich aus der erzählerischen Sackgasse nur heraus, indem ich mich auf den nächstgelegenen Hauptpunkt der Gliederung konzentriere, den ich für den Gesamtablauf unbedingt brauche, und ohne Rücksicht auf womöglich geplante Nebenpunkte einen Weg dorthin suche. Im Rückblick sind gerade das die großen Momente beim Schreiben.
Und beim Reisen sind sie’s nicht minder. Selbstverständlich modifiziere ich meinen Tourplan im Verlauf der Reise, ja setze ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit außer Kraft. Erst wenn zur Pflicht des Geplanten als Kür das Ungeplante dazukommt, wird es eine gute Reise, eine gute Romanniederschrift, ein gutes Leben.
Und wenn diese großen Momente ausbleiben? Und jeden Tag nur eine neue Pflicht ruft, die bewältigt werden will? Dann geht mir irgendwann die Energie aus, dann verkrieche ich mich in meinem Hotelzimmer und nehme eine Auszeit. Ich liege unterm Ventilator und höre ihm zu, von draußen dringen Gehupe, Geschrei, Gezänk, die Rufe der Straßenhändler, der Gesang des Muezzins, das Geblök der Esel, das Gezwitscher der Vögel. Plötzlich wird ein Generator angeworfen, ein Zug fährt vorbei, indem er ununterbrochen sein Signal ertönen läßt. Und immer gibt es mindestens einen, der auf einem Blech herumhämmert. Man hört den Soundtrack des Landes ganz anders, als wenn man gleich die passenden Bilder dazu wahrnimmt. Im Nichtstun kann Segen liegen, auch beim Reisen.
*
Jede Reise braucht ihre unverhofften Höhepunkte, sonst erscheint sie uns am Ende, selbst wenn alle Stationen des Tourplans abgearbeitet sind, als unbefriedigend. 1981, ein Jahr nach dem Militärputsch, hatten wir die Türkei bereist – Wolle, ein weiterer Freund, meine Freundin, ich – und nach einigen Wochen das flaue Gefühl, nur Kulissen gesehen zu haben. Erlebt hatten wir einige Straßensperren und Stromausfälle, verstopfte Klos und arg nach Fußschweiß stinkende Teppiche in den Moscheen. Das durfte es nicht gewesen sein!
In Bursa, fünf Tage bevor wir in Istanbul den Rückflug antreten mußten, hatten wir abends eine Idee. Am nächsten Tag saßen wir im Nachtbus nach Malatya. Zum Frühstück gab es dort Eintopf mit Gehirn, wir nickten uns zu, es wurde spürbar spannender. In Adyaman nahmen wir einen Minibus nach Kahta, von dort noch einen Bus hoch nach Eski Kahta, dann waren wir da: in einem Bergdorf mitten in Kurdistan.
In den Wochen zuvor hatten wir in Fahrkartenschaltern, Banken, Amtsstuben häufig ein Farbfoto von der Spitze des Nemrut Dağı gesehen. Es zeigte kolossal aus Stein gemeißelte Adler-, Löwen- und Menschen- oder auch Götterköpfe vor einem riesigen Schotterhaufen, offensichtlich eine künstlich errichtete Bergspitze, vielleicht ein Grab, vielleicht eine Kultstätte. Von Kayseri aus hätten wir vor einigen Wochen relativ einfach hinfahren können, aber … es war nicht auf unserem Tourplan gestanden. Nun hatten wir den Berg mit einer zweitägigen Gewalttour doch noch erreicht, ein Tag blieb uns für Auf- und Abstieg, die restlichen beiden für die Rückfahrt, schon allein das empfanden wir als angemessen aufregend verrückt. Eski Kahta … Der Bus war noch nicht außer Sichtweite, als wir schon von allen umringt waren, die hier lebten. Eine Weile bestaunten wir uns gegenseitig, schließlich wurden wir bei einer Familie untergebracht, die ihren Wohnraum für uns räumte. Ein Sohn, der ein paar Brocken Englisch konnte, ließ uns ungefragt wissen, hier würden sich alle als Türken fühlen, es gebe keinen Konflikt zwischen Kurden und Türken. Wir spitzten die Ohren. Unsre ganze bisherige Reise war nur das Präludium gewesen, jetzt ging es richtig los.
Um fünf Uhr morgens begannen wir mit dem Aufstieg zum Gipfel, dem Sohn als unserem Bergführer hinterher. Frühstück gab es in einem Dorf weit oberhalb der Straße, auf der wir gekommen waren. Wieder beteuerten alle, sie fühlten sich als Türken, obwohl sie Kurden seien. Um zwölf standen wir auf dem Gipfel: zwischen kopflosen Göttern aus Stein, ihre Köpfe da und dort in der Landschaft, die Realität übertraf das Foto bei weitem. Schweigend versuchten wir, uns einen Reim darauf zu machen, denn in unserem Türkeiführer war der Nemrut Dağı mit keinem Wort erwähnt. Wir wußten nichts und vermuteten alles. Natürlich stiegen wir auch noch den Schutthaufen hoch, eine vierzig oder fünfzig Meter hohe Geröllpyramide, und betrachteten von dort aus eine Mondlandschaft aus bronzefarbenen Gebirgszügen. Um halb drei mußten wir mit dem Abstieg beginnen, weit nach Einbruch der Dunkelheit waren wir zurück bei unsrer Gastfamilie.
Erst in dieser Nacht fingen wir uns die Flöhe ein, die uns dann während unsrer beiden letzten Urlaubstage begleiteten. Über hundert Bisse hatte ich am Morgen gezählt, in einem der Busse, die wir Richtung Istanbul nahmen, waren die Flöhe plötzlich weg. Zurück in Deutschland, kaufte ich mir ein Buch über den Nemrut Dağı, um endlich zu erfahren, was wir dort gesehen hatten. Wenige Jahre später brach der Konflikt zwischen Kurden und Türken offen aus. Heute ist der Nemrut Dağı längst UNESCO-Weltkulturerbe, es soll eine Straße bis zum Gipfel führen. Wahrscheinlich steht er auf dem Tourplan eines jeden Türkeiurlaubers. Wer am Ende der Rundreise ein flaues Gefühl haben sollte, muß sich etwas anderes einfallen lassen.