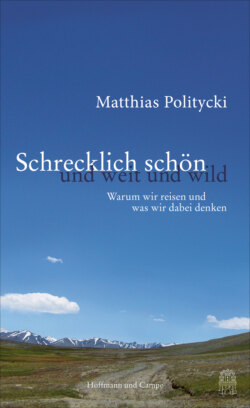Читать книгу Schrecklich schön und weit und wild - Matthias Politycki - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mein Abschied vom Reisen
ОглавлениеSeit über vierzig Jahren reise ich. Zunächst nur für ein paar Wochen nach Worthing an der englischen Südküste, wo ich mit meinem Schulfreund Robs Englisch lernen sollte, aber lieber nach Brighton oder London fuhr, um Plattenläden abzuklappern. Wenige Sommer später als Tramper kreuz und quer durch Europa oder, mit knappem Budget und umso größerer Naivität, als Rucksackfreak, der so ziemlich alles falsch machte, was man bei ersten Ausflügen auf die andre Seite des Mittelmeers falsch machen kann. Im Gegensatz zu den heutigen Backpackern, die im Grunde ein von der Globalisierung gezähmtes Völkchen sind, verstanden wir uns als Nonkonformisten, die sich auch in ihrer Form zu reisen von der Elterngeneration absetzen wollten. Ob wir wirklich »freier« als sie waren, wenn wir wild in griechischen Buchten campten oder neben dem jugoslawischen Autoput unsern Schlafsack ausrollten? Spätestens seit Mitte der neunziger Jahre reise ich als einer, der sich die Hälfte seiner Zeit sonstwo herumtreibt oder eingemietet hat, ob als Pauschaltourist oder auf eigne Faust, ob für ein Buch, eine Reisereportage oder »einfach so«, ob für ein verlängertes Wochenende oder für Monate, ein halbes Jahr lang war ich sogar »Writer-in-non-residence« auf einem Kreuzfahrtschiff. Obwohl ich das früher nicht mal im Traum für möglich, ja geradezu für abwegig gehalten hätte.
Seit über vierzig Jahren schreibe ich. Zunächst nur Gedichte auf herausgerissenen Seiten meiner Schulhefte. Wenige Sommer später … Und schließlich … Doch während ich noch in meiner Studentenzeit heimlich schrieb und meine Texte nur einem einzigen Freund anvertraute, befand ich mich beim Reisen in allerbester Dauergesellschaft: Nahezu jeder war bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf und davon, nicht zuletzt deshalb, um nach der Rückkehr jedem bei jeder sich bietenden Gelegenheit davon erzählen zu können. Vielleicht war Reisen so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner meiner Generation, mit Sicherheit galt es uns als Synonym für Freiheit schlechthin. Bei Billigbier und Erdnüssen aus der Dose diskutierten wir die aberwitzigsten Reiseziele; wer nur mal Badeurlaub an der Adria machte, mußte es heimlich tun, um nicht als Spießer abgestempelt zu werden. Niemals jedoch diskutierten wir die Sache selbst.
Im Rückblick mutet es seltsam an, daß wir als Vertreter einer notorisch kritischen Generation das Reisen nicht mal ansatzweise »hinterfragten«. Und erst recht keiner die Frage aufwarf, die das Zwanghafte eines permanenten Willens zum Aufbruch ins Visier hätte nehmen können – die Frage, warum wir überhaupt reisen. Wieso waren wir so anhaltend heiß darauf, Abenteuer in der Fremde zu bestehen, und was brachte derlei am Ende außer Erkenntnissen, die man besser gar nicht gewonnen hätte? War das Reisen – also alles, was mehr oder weniger prononciert über einen Urlaub hinausgeht – nicht eine furchtbar ambivalente Angelegenheit? Und, im Gegensatz zu den Reisen der Phantasie, nicht fast immer auch desillusionierend?
Nun wäre ich gern noch im Sommer 2015 um eine Beantwortung der Frage herumgekommen und einfach so weitergereist, wie ich es blauäugig begonnen und mit einer gewissen Unbeschwertheit über Jahrzehnte fortgeführt hatte: als etappenweises Unterfangen, im Anderen nicht nur das Eigene besser zu erkennen, sondern auch ein Stück der Utopie, die seit je die Sehnsucht des Reisenden ist. Im Sommer 2015 hatte sich allerdings auch ein unübersehbarer Menschenstrom auf den Weg nach Deutschland gemacht und dem Wort »Reisen« eine ganz andere, tiefernste Dimension verliehen. Mit meiner Unbeschwertheit war es vorbei. Natürlich hatte das eine mit dem anderen nichts direkt zu tun. Doch was da als »Flüchtlingskrise« mitzuerleben war, empfand ich schon bald als tiefe Zäsur auch in meinem Alltag. Wenn ich mich der Frage nach meinem Alltag als Reisender stellen wollte, so konnte ich die Suche nach Antworten nicht länger verschieben.
Reisen war schon seit dem Ende des Kalten Krieges und der damit verbundenen Freisetzung ethnischer Konfliktpotentiale zunehmend problematisch geworden. Anschläge auf Touristenhotels wurden ebenso zum festen Bestandteil terroristischer Strategien wie Zerstörung kultureller Sehenswürdigkeiten und Entführungen – nicht etwa von Pauschalurlaubern, sondern von Individualreisenden, die fernab massentouristischer Ziele unterwegs waren. Eine Zeitlang konnte man derlei als »Einzelfall« verdrängen und in vermeintlich sicheren Reiseregionen so weitermachen wie bisher. Seit 9/11 wurden die Möglichkeiten der Routenplanung gerade in abgelegeneren Regionen immer stärker eingegrenzt. Je interessanter die Destinationen waren, die man ins Auge gefaßt hatte, desto aufmerksamer mußte man die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes studieren. Doch erst im Sommer 2015 wurde mir klar, daß ich in diesem Leben wohl nie wieder in den Jemen würde fahren können, daß ich kaum mehr eine Chance hatte, nach Damaskus zu kommen oder nach Babylon.
Andrerseits: Was würde ich mir denn dort noch erhoffen? Das Fremde, das mich bislang gelockt hatte, mittlerweile begegnete ich ihm in meiner eigenen Stadt auf Schritt und Tritt, ich brauchte gar nicht mehr hinzureisen. Was als Multikulti verheißungsvolle Einsprengsel in den deutschen Nachkriegsalltag gesetzt hatte, mittlerweile hatte es als Globalisierung eine Stadt wie Hamburg durchgehend internationalisiert. Die altvertraute Weltordnung und damit verknüpfte Werte und Überzeugungen, wie sie sich trotz aller historischen Umbrüche mein Leben lang gehalten hatten, waren längst mächtig in Bewegung geraten – ich hatte es bislang bloß nicht in dieser Dimension wahrgenommen. Der Flüchtlingsstrom des Sommers 2015 war gewissermaßen nur eine sehr spezielle Ausprägung der Bewegung, bald würde »meine« Welt Geschichte sein. Oder war sie’s bereits?
Meine Welt als Reisender war weit und wild gewesen. Dem jugendlichen Grundgefühl, daß »da draußen« ein unerschöpfliches Reservoir an Rätseln und Abenteuern auf mich wartete, hatte ich über Gebühr lange gefrönt. Jetzt wurde mir klar, daß das Reservoir Jahr für Jahr überschaubarer und letztlich endlich geworden war. Daß es hinterm Horizont wahrscheinlich nichts mehr zu entdecken gab, was ich nicht schon aus den neuen Medien kannte, und falls doch: daß ich dort niemals mehr wirklich allein sein würde in einer tatsächlich fremden Fremde. Mit der großen Freiheit, wie ich sie ein paar Jahrzehnte ausgekostet und, vor allem, von der ich auch zu Hause geträumt hatte, war es wirklich und endgültig vorbei. Wenn ich mich der Frage nach meinem Alltag als Reisender tatsächlich stellen wollte, konnte ich nicht länger weiterträumen – oder eigentlich: nicht länger so tun, als könnte ich mein restliches Leben einfach weiterträumen.
Denn eine weitere Reisefibel wollte ich ja nicht vorlegen. Dazu hätte ich meine Fahrten systematischer oder bis ins Extrem betrieben haben müssen, und statt Rekorden und Legenden habe ich nur Mitbringsel und Anekdoten gesammelt. Ich bin auch kein Reiseschriftsteller, sondern Schriftsteller, und als solcher reise ich – sofern ich Anlaß dazu habe. In den meisten Fällen freilich um der Sache selbst willen. Also nicht etwa, weil ich von der Fremde Inspiration oder zumindest Notizen erhoffe, eine Heimkehr ohne jede Notiz ist mir eigentlich die liebste. Und doch wären meine Bücher ohne all die Reisen nicht diese meine Bücher geworden, das schon.
Immer gibt es jemanden, der einen größeren Tiger im Dschungel gesehen hat als man selbst, immer jemanden, der eine ekelhaftere Speise aufgetischt bekam, der höhere Berge erklimmen und größere Meere austrinken durfte. Doch Grenzerfahrungen lassen sich auch schon am Fuß des Kilimandscharo machen oder, ganz ohne Höllenritt und Hardcore-Trip, in einem Kloster des Zen-Buddhismus. Auch ich betreibe das Reisen mit zum Teil ehrgeizigen und manchmal sogar vermessenen Ambitionen, zumindest für meine Verhältnisse. In der Hauptsache jedoch ist Reisen für mich praktische Philosophie. Den Wert einer Reise bemesse ich nicht nach ihrem Schwierigkeitsgrad, ihrer Exotik oder sonstigen Rahmenbedingungen, sondern nach den Erkenntnissen, die auf den Wegen der Neugier als Stolpersteine lagen.
Erleuchtung lauert überall, ob in den Hochgebirgswüsten Tadschikistans oder am Ballermann in Mallorca. In beiden Fällen muß man bloß mit dem gleichen Blick hinsehen. Selbst wenn ich gerade nur eine Lesereise absolviere, bin ich kein ganz untypischer Vertreter unsrer Zeit. So wie der Reisende früherer Epochen einer besonders ehrgeizigen Form des Müßiggangs frönte, die in Form der Bildungsreise vielleicht die schönste Spielart des Individualismus hervorgebracht hat, so ist der Reisende unsrer Zeit nicht selten ein Verdammter, der von den Verlockungen der globalisierten Welt unentwegt zu neuen Enttäuschungen getrieben wird, selbst dann noch, wenn er vor ihnen flieht.
Wo auch immer ich gerade bin, sobald ich aus der Haustür trete, sehe ich Menschen, die zumindest einen Rollkoffer hinter sich herziehen. Wo auch immer ich Leute treffe, kommen sie trotz aller drängenden Gegenwartsfragen irgendwann auf ihre Reisen zu sprechen und auch gleich ins Schwärmen, als hätte das eine mit dem andern nichts zu tun. Ja was ist das denn, so frage ich mich rückblickend, was uns jahrzehntelang so beseelt und hinausgetrieben hat aus der Geborgenheit unsrer Behausungen? Was ging in uns vor, wenn wir in der Fremde versuchten, die selbstgesteckten Ziele halbwegs erfolgreich abzuarbeiten und en passant noch ein paar kleine Sensationen zu erhaschen, was dachten wir dabei und danach und darüber, wie gingen wir mit unsern Hoffnungen um, mit unsern Ernüchterungen? Was kam zur Sprache, wenn wir unter uns waren, was mußten wir verschweigen, wenn wir im öffentlichen Gespräch weiterhin als politisch korrekt gelten wollten? Was ließ uns beharrlich neue Reisen planen, auf daß jedes Lebensjahr Sinn und Form bekam, und ließ uns … vielleicht erst jetzt los, im Sommer 2015, da die Faszination des Reisens durch die Schrecken und Fährnisse eines ganz anderen Reisens so überdeutlich in Frage gestellt wurde? Natürlich werden wir auch weiterhin die eine oder andre Fahrt unternehmen! Doch bestimmt nicht mehr mit der unsagbaren Leichtigkeit vergangener Jahrzehnte.
Wir, das sind zunächst einmal all die, mit denen ich irgendwann gemeinsam verreist bin – Freunde, Freundinnen, ob zu zweit oder in der Clique, manchmal sogar im Rahmen einer Reisegruppe. Aber auch jene, mit denen ich nur in Gedanken aufbrach, im Gespräch. Es sind ihrer zu viele, um sie im Verlauf dieses Buches alle angemessen vorstellen zu können, namentlich gehen, wandern, reiten, fahren, fliegen darin nur einige meiner Reisegefährten mit: Wolle, mit dem ich das Kurvenanschneiden auf griechischen Bergstraßen übte und, Jahre später, in einer japanischen Kleinstadt so lange »Schaug hi, da liegt a toter Fisch im Wasser« als Karaoke-Beitrag lieferte, bis alle mitsangen und im Takt auf den Tisch trommelten. Mein belgischer Freund Eric, mit dem ich in Afrika und Zentralasien lange Wege ging, manchmal über unsre Grenzen hinaus. Oder Dschisaiki, mit dem ich auf Schrottplätzen der amerikanischen Südstaaten herumkletterte und im kubanischen Regenwald Geld bei illegalen Hahnenkämpfen verzockte. Konsul Walder, den ich als einen der Weltreisegäste bei meiner Fahrt mit der Europa kennenlernte. Achill und Susan, mit denen ich (bislang) eher zivile Reisen innerhalb Europas unternahm, obwohl auch sie in der ganzen Welt unterwegs waren und sind. Schließlich Indra, der K und Dr. Black, mit denen ich zwar noch kein einziges Mal gemeinsam unterwegs war, jedoch schon viel Zeit im Gespräch über unsre Reisen verbracht habe.
Indem sie mit ihren Ansichten gegenhalten oder beipflichten, stehen sie freilich für etwas, das über das begrenzte »Wir« einer real existierenden Reisegruppe hinausweist: Mögen die Meinungen andrer Reisender anders gewichtet sein, der Austausch darüber wird ähnlich unverblümt und ehrlich ablaufen. Reisen ist gut und schön, mit Freunden reisen, und sei’s nur beim Einander-Erzählen, ist besser und schöner. Insofern liegt im gelegentlichen »Wir« des Buches ein Bekenntnis, das niemanden vereinnahmen will, jedoch all jene gern mit einschließt, die sich bei ihren Reisen auch mal an die Bar stellen und von den Äußerungen anderer überraschen lassen.
Wir, das sind in meinem konkreten Fall ein Literaturprofessor, eine Marketingexpertin, ein Bankkaufmann, ein … ach, das ist doch egal. Sobald wir am Heck eines indischen Überlandbusses hängen oder uns einer Affenhorde erwehren, die es im afrikanischen Busch auf unsre Essensvorräte abgesehen hat, zählen ganz andre Kriterien. Wir, das sind lauter Menschen, die immer wieder ihren Platz in der Fremde gesucht und notfalls auch verteidigt haben. Manche ihrer Meinungen sprechen mir aus dem Herzen. Manche regen mich auf. Weswegen sie unbedingt in dies Buch hineingehören.
Das große Versprechen, das die Welt einmal war, hat sich – nicht etwa in Luft aufgelöst, sondern in sein Gegenteil verkehrt. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, hoffnungsvoller Beginn einer friedlicheren Zeit, ist die Welt nicht nur kleiner geworden, sondern auch weniger freundlich, verheißungsvoll, beflügelnd. All das, was man für ein Abenteuer früher zähneknirschend auf sich genommen hat – Konfrontation mit dem Fremden in jeglicher Weise –, nun rückt es in einer Massivität näher, daß es für viele in Europa bereits zur Drohkulisse einer neuen Alltagskultur geworden ist. Fast erscheint es ein Gebot der Stunde, nicht länger zu reisen, als wäre nichts geschehen, sondern die Geborgenheit zu Hause wenigstens jetzt schnell noch schätzen zu lernen.
Aber genau das wäre die Kapitulation vor der Gegenaufklärung, wie sie sich in den verschiedensten Spielarten überall auf der Welt ausbreitet. Indem ich mich mit alldem beschäftige, was man früher eine Phänomenologie des Reisens genannt hätte, versuche ich wahrscheinlich, meinen Abschied vom Reisen noch eine Weile hinauszuschieben, meinen geistigen Abschied, wie gesagt. Oder befördere ich ihn dadurch erst recht? »Man predigt oft seinen Glauben, wenn man ihn gerade verloren hat«, schreibt Nietzsche, »und man predigt ihn dann nicht am schlechtesten.«1 Auch die mit dem Glauben verbundenen Werte verteidigt man hartnäckiger als zuvor, da sie – im Fall des Reisens als Ausdruck interkultureller Verständigungsbereitschaft – so selbstverständlich schienen, daß man wähnte, sie seien Allgemeingut einer modernen Weltgemeinschaft und nie mehr in Frage zu stellen.
Was nun gedruckt vorliegt, ist bestimmt kein Buch für den, der wissen will, wo sich vielleicht doch noch ein weißer Fleck auf der Landkarte entdecken läßt oder zumindest ein Weg, auf dem man ganz sicher zu sich selbst wandert. Derlei gibt es, und als Reisender wie als Leser habe ich stets einen weiten Bogen darum gemacht. Geschrieben habe ich für jene, die uns im Ohrensessel begleiten und am Ende froh sind, den Fährnissen der Fremde nur auf dem Papier ausgesetzt gewesen zu sein. Erst recht für jene, die tatsächlich aufbrechen, immer wieder aufbrechen – und manchmal mit dem Gefühl heimkehren, gerade noch mal davongekommen zu sein. Vor allem für diejenigen, die sich nicht nur mit Fahrplänen, Restaurant-Tips und der neuesten Generation an Trekkingstöcken beschäftigen, sondern auch damit, was hinter all der Reiselust stehen mag als unser Antrieb und unsre Sehnsucht. Die sich mit mir fragen, wohin wir eigentlich reisen, jenseits aller Destinationen.
MP, 31/12/16