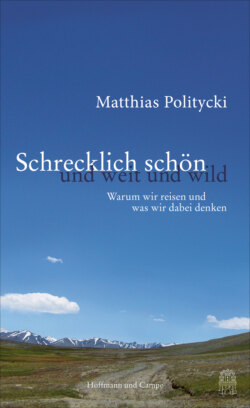Читать книгу Schrecklich schön und weit und wild - Matthias Politycki - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Landkartenlust
Оглавление»Wer die erste Landkarte gezeichnet hat, hat den ersten Roman geschrieben.« Diesen Satz soll Italo Calvino gesagt haben,8 und ich unterschreibe ihn bedingungslos. Nicht jeder Roman läßt sich als Landkarte erzählen, doch jede Karte trägt mindestens eine Geschichte in sich. Schon das Studium eines Stadtplans ist eine Art Lektüre. Freilich ist das Erzähltempo von Plänen und Karten gleichmäßiger als das von Texten, der Leser ist gefeit gegen plötzlichen Spannungsabfall und Mangel an Ideen.
In meinem Exemplar der »Odyssee« war keine Karte abgedruckt. Als Schüler konnte ich den Plot nur verstehen, indem ich die Irrfahrt des Protagonisten Station für Station in meinen »Diercke Weltatlas« einzeichnete – verbotenerweise, der Atlas war Eigentum der Schule und durfte nicht »beschmiert« werden. Je mehr ich einzeichnete, desto begeisterter las ich weiter. Am Ende des Epos hatte ich eine interessantere Karte des Mittelmeerraums als jeder meiner Klassenkameraden, in ihr war die gesamte Route des Odysseus eingezeichnet samt antiker Ortsbezeichnungen und ergänzender Stichworte. Ein schwerer Tag, als der Atlas vor den Sommerferien abgegeben werden mußte.
Ja, ich liebe Karten, sammle Karten, will ohne Karten nicht sein. Vor einer Reise, während einer Reise, nach einer Reise und vor allen Dingen überhaupt. Zwecks Planung, zwecks Orientierung, zwecks Recherche, zwecks Betrachtungsglück per se. Indra scheint es ähnlich zu gehen: »In einem guten Stadtplan kann man einen Ort ablesen, erkennt die Routen und erfährt mit viel Phantasie auch, wie die Menschen dort leben könnten. Das ist für mich eine wichtige Aneignung von etwas Fremdem und geht oft auch noch nach der Reise weiter.«
Betrachtet man einen Stadtplan lang genug, sieht man durch ihn hindurch. Man sieht die Stadt. Natürlich nicht deren konkrete Erscheinung, sondern ihre Idee. Städte ähneln sich. Hat man sich nicht nur mit ihren Sehenswürdigkeiten auseinandergesetzt, sondern auch mit ihrer Struktur, wird man bald vergleichbare Strukturen in anderen Städten wahrnehmen. Fortan kann jede weitere Reise lang vor dem Tag der Abreise beginnen, man liest sie vorab. Dr. Black: »Unendlich lange kann ich Karten erforschen, als ob ich selbst in der Region unterwegs wäre. Schöngeistige Literatur schläfert mich ein, aber Landkarten machen mich richtig munter.«
Landschaften entziehen sich zwar manchmal der Kartographie, trotz Reliefschummerung und farbig abgestuften Höhenschichten; Städte hingegen sind Variationen des immergleichen Themas, man kann sie bereits per virtuellem Rundgang besichtigen. Dazu braucht es nur eine gewisse Reiseerfahrung, gepaart mit Vorstellungskraft. Und einen Plan, der über den Innenstadtbereich hinausgeht. »Leuten, denen die Phantasie bei der Versenkung in ihn nicht wach wird und die ihren (…) Erlebnissen nicht lieber über einem Stadtplan als über Fotos oder Reiseaufzeichnungen nachhängen, denen kann nicht geholfen werden.« (Walter Benjamin)9
Aber nicht jeder Reisende ist ein »Kartenfex«, wie Steinbeck sie nennt.10 Wolle: »Ich habe keinen Bock auf Landkarten. Und wähle stets den einfachsten Weg, also Google Maps auf dem Handy.«
»Google Maps schafft Klarheit«, konzediert Konsul Walder, »schlimm ist allerdings Street View, ich will den Ort doch nicht schon vorab besichtigen, sondern mit eignen Augen sehen. Google Street View ist was für Feiglinge.«
Dschisaiki: »Digitale Routenplaner beziehungsweise Navis dienen der schleichenden Verdummung der Menschheit beziehungsweise der Rückbildung des Hirns.«
Der K: »Es kommt ganz auf die Art des Reisens an. Zum Ankommen sind die neuen Tools wie Google Maps, Navi et cetera unverzichtbar und hochwillkommen, bei der Adreßsuche in einer Stadt wie San Francisco zum Beispiel. Ist man erst mal unterwegs, reicht jedoch eine Karte.«
Im realen Reisealltag findet Google Maps immer öfter für uns den Weg. Doch wir sind dem Programm auch ausgeliefert. Mit einer Karte in der Hand sind wir zwar Old School, haben aber auch ein kleines Erfolgserlebnis, wenn wir aufgrund unsrer Orientierungskraft das Ziel gefunden haben. Das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten auch in der Fremde ist für Eric so entscheidend, daß er selbst beim Autofahren Karten benutzt: »GPS schlägt dir immer nur eine Lösung vor, eine Karte auf Papier bietet viel mehr Möglichkeiten, außerdem mehr Überblick und damit Kontrolle.« Google Maps benutzt er nur zur Vorbereitung seiner Reisen – außer denjenigen im Gebirge, da sei es einfach nicht genau genug: »Ein Bergführer aus Fleisch und Blut ist sicherer.«
Denn auch mit einer klassischen Karte aus Papier ist man keineswegs schon auf der sicheren Seite. Die Stadtpläne, die von Fremdenverkehrsämtern verteilt werden, reduzieren auf eine Weise, daß man mit ihnen kaum mehr als die Sehenswürdigkeiten findet. Vielleicht ist das ja Absicht, so wird der Touristenstrom kanalisiert und die restliche Stadt den Einheimischen vorbehalten. Für die entscheidenden Abstecher ins Fremde des Fremden sind sie nicht zu gebrauchen. »Die Karten, die ich in Thailand bekam, waren alle ziemlich verzerrt«, gewinnt ihnen Konsul Walder wenigstens noch etwas ab, »da wurde Orientierung wieder zum spannenden Abenteuer.«11
Besondere Verdienste im Anfertigen solch verzerrter und »aufs Wesentliche« konzentrierter Karten haben sich die Städte des früheren Ostblocks erworben. Angeblich damit potentielle Angreifer gezielt fehlinformiert würden. Es klingt naiv, doch auch heute noch gibt es Staaten, die darauf vertrauen: In Usbekistan gilt der Besitz von maßstabsgetreuen Karten sogar als strafbar. Als ich mir unter der Hand einen maßstabsgerechten Plan von Samarkand verschaffen konnte und damit endlich die verwinkelte Altstadt begriff, wurde mir sehr eindringlich eingeschärft, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu benutzen. Ein Stadtplan, mit dem man sich nicht erwischen lassen darf, das sagt eigentlich alles. Wer ihn besitzt, darf sich trotz Google Maps (das im Fall von Samarkand völlig versagte) als Geheimnisträger betrachten.
»Landkarten sind Kunstwerke und seit Jahrhunderten eine subversive Irritation der ›Realität‹«, sagt Dschisaiki, »denn sie packen ja zwangsläufig ›das Runde ins Eckige‹ beziehungsweise Flache.« Das trifft auch auf Karten zu, die in bester Absicht erstellt wurden. Der Fundus an Datenmaterial und Satellitenfotos mag für alle in etwa gleich sein, dennoch fällt die Umsetzung frappierend unterschiedlich aus. Schließlich werden Karten auch noch im Zeitalter der Digitalisierung per Hand vollendet, erst durch die abschließende Arbeit des Kartographen entstehen Lebendigkeit und Schönheit eines Kartenblatts. Und damit ein völlig anderer Gesamteindruck: Die Vorliebe französischer (Michelin-)Kartographen für weißbelassene Nebenstraßen auf kaum kolorierter Landschaft macht ihre Karten schwerer lesbar als die kräftiger kolorierten deutschen. Die gelbe Grundkolorierung bei Stadtplänen wirkt im Zusammenspiel mit den weißen Nebenstraßen ähnlich, wohingegen die rosa Kolorierung deutscher Stadtpläne stärkere Kontraste schafft und damit Klarheit. Am schwersten zu lesen sind die englischen (A–Z-)Blätter, hier fehlt es nicht allein am durchgängigen Kontrast, hier sind sämtliche Straßen so breit und unbeholfen eingezeichnet, als hätte sich ein Dilettant an ihnen versucht. Daß ausgerechnet ein Volk der Entdecker heutzutage so schlechtes Kartenmaterial produziert, verstimmt.
Ein Fest für den Liebhaber sind amtliche Meßblätter. Ich besitze ein paar, die den Raum rund um München abdecken, produziert vom bayerischen Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Sie sind nicht weniger als Ausschnitte eines Weltgemäldes, in denen man immer wieder Neues entdeckt. Dennoch fehlt selbst darin manchmal gerade das Entscheidende – jedenfalls nach eigener Einschätzung, nachdem man den realen Ort gesehen hat: ein Triumph dessen, der eine andere Auswahl der Wirklichkeit getroffen und die Karte dann im Geiste oder gar mit dem Stift ergänzt und korrigiert hat. Bei einer Fahrt nach Weimar im Jahr 1983 fanden wir erst nach langer Suche das Nietzsche-Haus, das zu DDR-Zeiten in keinem Stadtplan ausgewiesen war. Es dann per Hand einzuzeichnen fiel fast schon unter Systemkritik. In jedem Fall eingezeichnet werden wollen die Strecken, die wir selber zurückgelegt haben. Der simple Vorgang macht gleichermaßen stolz wie demütig, erkennt man dabei doch auch, wie wenig man abgelaufen und gesehen hat.
Erst durch derlei Ergänzungen werden Karten unser geistiges Eigentum, vergleichbar den Anstreichungen in Büchern. Noch nach Jahren legen sie Zeugnis ab von den erkundeten Weltausschnitten und speichern Erkenntnisse, die wir damals gewonnen haben. Oder bilden die Grundlage für Erkenntnisse, die wir erst viel später gewinnen: Als ich 2016 zum zweiten Mal nach Tokio kam, hatte ich meinen U-Bahn-Plan des Jahres 1988 dabei. Der Vergleich mit dem aktuellen Plan las sich wie eine Erfolgsgeschichte in Piktogrammen. Während sich in den Jahrzehnten, da ich in Hamburg lebe, kaum etwas am dortigen U-Bahn-Netz verändert hat, gab es in Tokio mittlerweile doppelt so viele Linien mit doppelt so vielen Stationen, so jedenfalls mein Eindruck. Man sah anhand der beiden U-Bahn-Pläne, wie die Zukunft einer Stadt tatsächlich gemacht wird.
Denn jede Karte, welcher Art der Wirklichkeitsauswahl und gegebenenfalls -verzerrung sie auch zuarbeitet, ist als Weltinterpretation eine Setzung und damit, streng genommen, Untersuchungsgegenstand der Erkenntnistheorie. Einzig übertroffen in ihrer Kunst der Komprimierung wird sie von der handgefertigten Skizze. Kann es einen reduzierteren Text geben? Eine Skizze, zur Erläuterung einer Wegstrecke wie ein Aphorismus aufs Papier geworfen, ist die Verkörperung des Wesentlichen schlechthin. Eine Karte für Fortgeschrittene.
Einheimische, die bei mündlichen Auskünften oft ungenau sind, ja den Fremden bedenkenlos in die falsche Richtung schicken, können oft wunderbare Skizzen anfertigen. Sie führen zu Orten, die in keinem Reiseführer und auf keiner Landkarte verzeichnet sind. Natürlich sind die Dimensionen der Wegstrecken auch darauf verzerrt. Der Reiz besteht darin, die versteckten Sehenswürdigkeiten trotzdem zu finden, ohne ortskundigen Führer, dem man einfach hinterhergehen müßte. Damit sind Skizzen stets auch Aufgaben, die dem Fremden gestellt werden, und wenn er sie löst, darf er sich für den Rest des Tages als Entdecker fühlen.
Meine bislang schönste Skizze machte mir ein Lehrer namens Rishot, der sich sein Leben lang, wie er erzählte, den Regenwald rund um sein Heimatdorf Mawlynnong erwandert hatte. Ich war dorthin gefahren, um mir eine besonders berühmte der »Living Root Bridges« anzusehen, von denen ich bereits in Cherrapunjee beeindruckt war: Beide Orte liegen im indischen Bundesstaat Meghalaya; die dort ansässigen Khasi zogen in früheren Jahrhunderten Wurzeln der Banyanbäume quer über die Flüsse und bauten damit »lebende Wurzelbrücken« beziehungsweise ließen sie im Verlauf von fünfzehn bis zwanzig Jahren von den Bäumen selber bauen.
Weil es ein Sonntag war und die Wurzelbrücke im Nachbarort Riwai also völlig von indischen Touristen überlaufen sein würde, machte mir Rishot eine Wegskizze zu einer entlegenen Wurzelbrücke, sie sei garantiert touristenfrei. Inder seien viel zu faul, um den langen Weg dorthin zu gehen, überdies würde ja niemand außer ihm und den Dörflern im Dschungel davon wissen.
Seine Skizze führte mich im Verlauf einiger Stunden bergauf, bergab, bergauf, schnell weg von der einzigen Straße, die es hier gibt, und auf einen Weg durchs Dickicht wie vor Urzeiten. Allerdings war er länger als von Rishot angegeben – ich merkte, wie mir die Zeit davonlief, rannte den Rest des Weges, um die Brücke noch bei Tageslicht zu erreichen. Als sie vor mir auftauchte, dämmerte es bereits, und mit ihren verschlungenen Wurzelformationen sah sie noch märchenhafter aus als erhofft. Ein, zwei Minuten war ich mit ihr allein, dann rannte ich zurück, bis die Dunkelheit einbrach. Der Rest war nichts als Rückweg, begleitet vom Nachtkonzert des Regenwaldes.
Bevor ich zu meinem Guest House ging, suchte ich Rishot auf, um mich zu bedanken. Er erzählte mir von Dutzenden weiterer Brücken, sogar von einer Wurzelwendeltreppe, die man irgendwann an einer Felswand angelegt hatte, um zu einem Feld auf einem Bergvorsprung hinabzugelangen.
Eine Wurzelwendeltreppe?
Von der nur er und sein Freund wüßten, so versteckt läge sie. Bei meinem nächsten Besuch werde er sie mir zeigen.
Ob er mir wieder eine Skizze zeichnen würde, fragte ich ihn.
Nein, grinste er, er werde mich begleiten. Dieser Weg sei zu kompliziert für eine Skizze.12