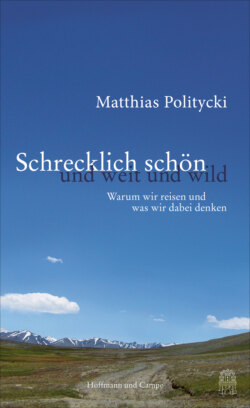Читать книгу Schrecklich schön und weit und wild - Matthias Politycki - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nicht aufbrechen wollen, wohin es uns treibt
ОглавлениеWer aufbricht, will nicht Zufriedenheit, sondern Glück. Oder wenigstens Unglück. Seine Sehnsucht ist ernst und will Ernst und macht Ernst. Überdies hat sie eine Kehrseite: Wohin wir auch reisen, in erster Linie reisen wir weg von uns selbst und unsresgleichen. Weil wir es wieder einmal satt haben, alle und alles satt haben, am allermeisten den, der wir selber sind, der uns bedrückt und beengt und ganz und gar nicht derjenige ist, der wir sein wollen.
»Jede Reise ist ein Fluchtversuch aus dem Gefängnis der Identität«, schreibt Hans Christoph Buch.2 Nicht nur Neugier, auch Unzufriedenheit treibt uns fort. Man mag so viel gereist sein, wie man will, irgendwann spürt man sie wieder, getarnt als unbestimmt nagende Rastlosigkeit, die nach Taten und Herausforderungen verlangt: eine stille Verzweiflung darüber, daß das Leben so ist, wie es ist, jedenfalls dort, wo man seinen Platz auf der Welt hat. Ob sich andernorts nicht ein anderes Leben finden läßt, es müßte nicht unbedingt besser sein, nur eben anders? Zumindest vorübergehend? Auch ich sehne mich dann nach dem nächsten Auf- und Ausbruch, weil ich die Gefühle wieder groß und die abwägenden Reflexionen klein haben möchte.
Aber das stimmt nur so lange, bis ich einen Entschluß gefaßt habe. Kaum stehen Reiseziel und -beginn fest, setzt die Reflexion wieder ein, am liebsten würde ich alles auf der Stelle abblasen. Muß es wirklich sein? Im Geiste sehe ich endlose Straßen, auf denen ich mäßig verlockenden Zielen entgegengehe, öde Orte, in denen ich tagelang festhänge, sehe Steilhänge und Wüsten, in denen ich nicht weiterweiß. Sehe schlechtgelaunte Hunde, die mich einzukreisen suchen, sehe Tsetsefliegen, die mich bereits eingekreist haben. Vor allem sehe ich Einheimische, die mir das Leben schwermachen, um es sich selbst ein bißchen zu erleichtern. Ich sehe mich im Nachtzug von Rabat nach Marrakesch, der so überfüllt war, daß die Fahrgäste an jeder Station die Waggontüren zuhielten, und wenn die Menschen dann durch die Fenster hereinkletterten, schlugen sie mit ihren gelben Schlappen auf sie ein, vergeblich. Mit Müh und Not verteidigte ich einen Stehplatz neben der Toilette, sieben Stunden lang. Ich sehe mich in einem Bus im tunesischen Bergland, umgeben von sechs Kleinkindern, die abwechselnd kotzten oder schrien, dazu krähte ein Hahn. Ich sehe mich in einem Hochhaus in Tokio, spüre die Mutlosigkeit, die mich beim Blick über den nächtlichen Glitzerteppich unter mir beschlich, den Wunsch, das Hotel gar nicht erst zu verlassen, weil eine solche Megacity in einem ganzen Leben nicht zu bewältigen sein würde. Ich sehe mich auf einem völlig verschissenen Toilettenhäuschen ohne Tür, mitten in Tamil Nadu über einem stinkenden Loch hockend, von Mücken umschwirrt. Ich sehe mich auf einer Bergtour im Pamir bei jeder Rast vor Erschöpfung einschlafen, sehe mich in den Bergen von Sikkim keinen Schlaf finden, weil sich mein Puls in dieser Höhe kaum beruhigen will. Gewiß, es ist schön, dies alles erlebt zu haben. Aber will man es – in modifizierter Form und mit vertauschter Kulisse – erneut erleben? Je älter ich werde, desto zahlreicher weiß ich Gründe, eine Reise besser gar nicht erst anzutreten.
Aufzubrechen ins Fremde, das heißt für viele von uns: die Geborgenheit einer moderat erlebnisreichen Schreibtischexistenz einzutauschen gegen die rauhe Außenwelt, obendrein eine, deren Gesetze des Zusammenlebens man nicht kennt und mit der man also zwangsweise kollidieren wird. Daneben treten, je nach Reisegebiet, physische Gefährdungen, im Zweifelsfall wird man auf seine Muskelkraft vertrauen müssen. Als aufgeklärter, zivilisierter Mensch? Aber ja, weil man mit einer aufgebrachten Menge Hindus im Tempel ebensowenig diskutieren kann wie mit einem Rudel Wölfe im Gebirge.
Sofern wir von der Fremde träumen, träumen wir sie groß und gewaltig. Wir träumen sie als das schlechthin Andere, in dem wir auch das neu erlernen und erleben werden, was wir zu Hause bei wachem Verstand als vormodern, ja archaisch verachten. Wir werden es erlernen müssen. Werden wir es auch schaffen? Zur Antizipation der Beschwernisse gesellt sich die Angst vor dem Versagen. Eine Reise ist kein Urlaub, im Gegenteil: »Eine Reise ist ein Stück der Hölle«, zitiert Chatwin einen Nomaden, der ihn durch den Sudan begleitete.3
Zumindest ist sie immer wieder harte Arbeit. Sie besteht im sukzessiven Abarbeiten eines Aufgabenkatalogs, dessen Schwierigkeitsgrad wir selbst bei bester Planung kaum ermessen können. Ein gelegentliches Scheitern wird auch diesmal nicht zu vermeiden sein, nach unsrer Rückkehr werden wir Pleiten und Pannen als Witze zum besten geben. Aber wollen wir wirklich aufbrechen, um sie auch erst einmal zu erleben?
Diese Frage enthält, wie die russischen Matrjoschka-Puppen, eine Reihe weiterer Fragen: Ist Zuhausebleiben eine Option? Und die Angst vor dem Aufbrechen, wie Wolle behauptet, nichts weiter als »Heimweh vorab«? Ist die vorübergehende Lust am Abenteuer, nüchtern betrachtet, vielleicht am Ende weniger wichtig für uns als der beständige Genuß all dessen, was wir als unser Zuhause im Lauf der Jahre aufgebaut haben: die Geborgenheit, die unser Alltag mit all seinen kleinen Dingen und Ritualen bietet, die Beziehung mit einem Partner, der den Alltag mit uns teilt und uns mit Liebe und Zuwendung von dessen Verletzungen heilt?
Hartmann von Aue hat auf diese Fragen vor über achthundert Jahren in zwei berühmt gewordenen Epen Antworten gesucht. Anhand der beiden Artusritter Erec und Iwein beschreibt er den Konflikt zwischen der Suche nach »aventiure«, wie sie der ritterliche Ehrenkodex gebietet, und dem »verligen« zu Haus mit einer geliebten Frau. Der eine von beiden (Erec) muß aufbrechen und sich erneut in der Fremde bewähren, weil er es sich auf dem Liebeslager daheim allzu dauerhaft eingerichtet hat. Der andre (Iwein) muß sich seine Liebe zurückerobern, weil er vor lauter Abenteuerdurst vergessen hat, zum versprochenen Zeitpunkt nach Hause zurückzukehren.
Die Mitte zwischen beiden Extremen zu finden ist für den hochmittelalterlichen Ritterstand, jedenfalls in seiner literarischen Selbststilisierung, das Problem schlechthin. Nicht nur die Reise ist ein heikler Balanceakt zwischen Heimweh und Fernweh. Auch das Zuhausebleiben ist es. Die moderne Wissenschaft sieht es nüchterner, für sie ist die Entscheidung zwischen Abenteurertum und Verharren im Vertrauten schon genetisch getroffen: Dutzende von Studien wollen herausgefunden haben, daß Abenteuerlust vererbt wird. Schon zu prähistorischer Zeit hätten »Träger des DRD4-Gens die Veranlagung gehabt, sich auf Wanderschaft zu begeben«; in einer Studie von 1999 hätten »fast alle Probanden mit diesem Gen eine umfangreiche Reisevergangenheit gehabt«.4
Nun wissen wir also, daß wir gar nicht anders können. Wer auch nur irgendetwas von der Welt sehen will, der will möglichst viel davon sehen, im Grunde alles. Wird die Zeit vor der Abreise dadurch erträglicher? Nein. Denn aus der Neigung, die Welt sehen zu wollen, wird schon im Planungsstadium Pflicht. Die Agenda, die wir uns auferlegen, ist jedes Mal viel zu ehrgeizig – vom Größenwahn befeuert, man habe als Reisender im Lauf der Zeit die Fähigkeiten dazu erworben. Thailand ist ein ideales Einstiegsland für Asien, Namibia für Afrika, die Vereinigten Emirate sind es für die arabische Welt. Mit den Jahren steigen die Ansprüche an Länder, die wir bereisen wollen, und mit ihnen die Ziele, die wir uns setzen. Manchmal müssen wir dabei an unsre Leistungsgrenze gehen, manchmal darüber hinaus. »Woran mir am meisten liegt«, schreibt Jack London vor Aufbruch zu seiner Weltumseglung 1907, »ist, eine persönliche Großtat zu vollbringen (…). Es ist das alte ›Ich hab’s geschafft! Ich hab’s geschafft! Ich habe es ganz allein geschafft!‹«5
Das Gefühl, etwas in der Fremde geschafft zu haben, das wir uns zu Hause nicht mal im Traum zugetraut hätten, kann ungemein beleben. Aber zunächst einmal müssen wir es auch schaffen. Und je mehr man im Leben geschafft hat, desto mehr hat man auch nicht geschafft, das ist ganz unvermeidlich und als verarbeitete Erinnerung nicht minder wertvoll als die Siege, die man errungen hat. Das Scheitern selbst freilich ist schmerzlich, in den schlimmsten Fällen mit Krankheit, Verletzung, Todesnähe verbunden. Dies zu wissen und trotzdem aufzubrechen wird schwerer, je älter man im Lauf seines Reiselebens geworden ist. Hat man nicht längst genug gesehen? Läßt sich überhaupt noch wirklich Neues entdecken, ist ein UNESCO-Welterbe nicht irgendwann wie das andere, eine Garküche am Straßenrand wie die nächste, ein Nationalpark, ein Felsenkloster, ein Dolmengrab … alles letztendlich eins und längst gesehen, ehe man hingereist ist? Dschisaiki: »Warum kann ich nicht wie andere auch einfach irgendwohin ins Warme fahren, und gut is’?«
Ist Urlaubmachen eine Option?
Ja, wenn man so einfach Urlaub machen könnte! Selbst wenn ich den festen Vorsatz hatte, »es mir diesmal wirklich nur ein paar Tage gutgehen zu lassen«, beispielsweise in einer schönen Hotelanlage am Meer, mußte ich schon am zweiten Tag ausbrechen und den Rest der Insel erkunden. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, daß da etwas zu entdecken sein könnte, gleich hinter der Mauer, die das vermeintliche Urlaubsparadies von der wirklichen Wirklichkeit trennte.
Nein, Zuhausebleiben ist keine Option, Urlaubmachen erst recht nicht. Konsul Walder: »Es reicht nicht, nach Sankt Peter-Ording zu fahren, um den Horizont neu zu sehen. Oder nach Garmisch, um ihn nicht zu sehen.« Achill: »Wir dürfen nicht aufhören, Suchende zu sein.«6
Der Reisende ist der Suchende per se, und was er auf seiner Suche auch findet, es spornt nur zu weiterer Suche an. Im Grunde sind wir auf immerwährender Reise, die Zeit zu Hause ist nichts als eine kurze Rast. Jeder Aufbruch ist eine Heimkehr in die Fremde. Ob wir wollen oder nicht, sobald die Zeit des Rastens abgelaufen ist, müssen wir wieder hinaus – das schiere Aufbrechen ist bereits die erste Mutprobe, die uns auferlegt wird.
»Alles prüfe der Mensch«, schreibt Hölderlin, »Daß er (…) verstehe die Freiheit, / Aufzubrechen, wohin er will.«7 Wir hadern und grübeln nur deshalb so lang, weil wir zu Hause, noch unterm Joch des Alltags stehend, den Gedanken der Freiheit erst wieder prüfen, in seiner erschreckenden Radikalität verstehen und ertragen lernen müssen. Eric behilft sich dabei mit einem simplen Trick: »Ich habe meine Packliste auf dem Computer, sobald sie ausgedruckt ist, habe ich zumindest schon mal den Geruch von Freiheit in der Nase.«